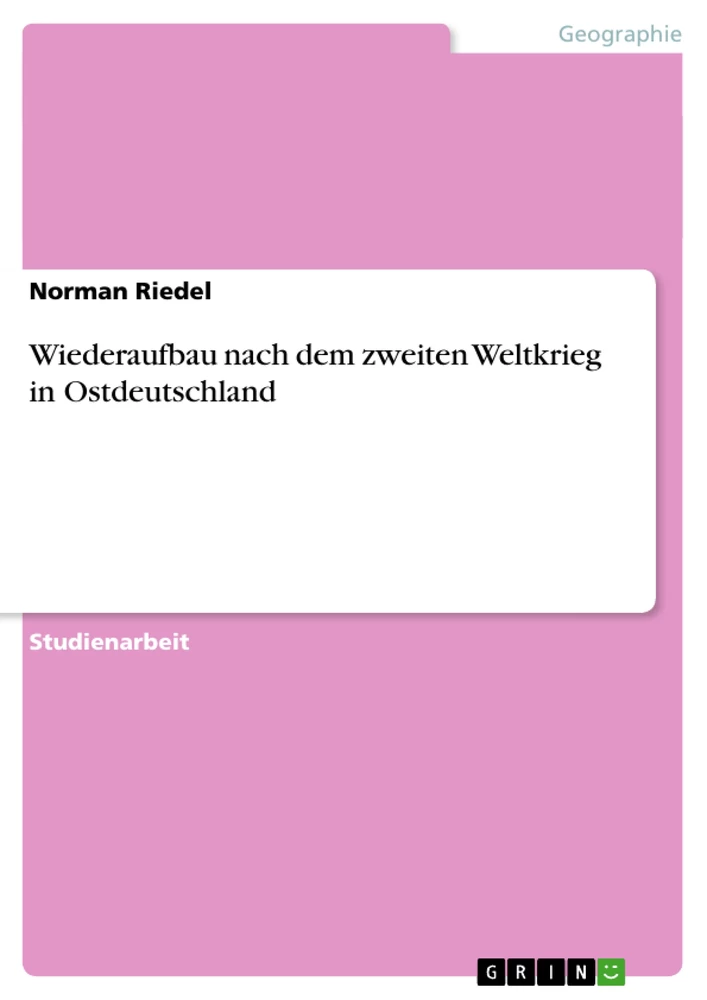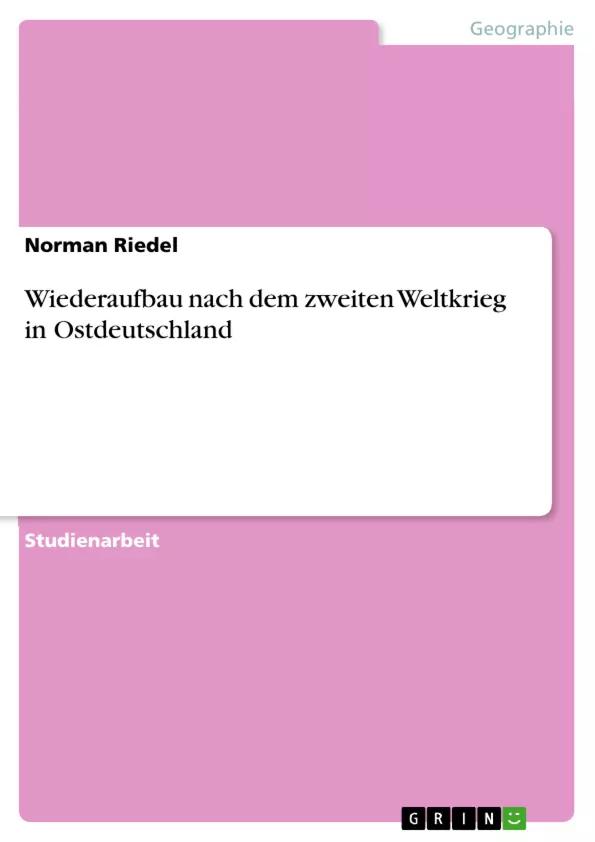Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit stadtgeographischen Aspekten des Wiederaufbaus Ostdeutschlands nach dem zweiten Weltkrieg. Nach der Niederlage Deutschlands und der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 wurde Deutschland in vier Besatzungszonen unterteilt. Die drei Zonen in Westdeutschland (USA, Frankreich, England) schlossen sich zu einer zusammen und bildeten die sogenannte Trizone. Damit grenzten sich die „westlichen Siegermächte“ von der sowjetisch besetzten Zone in Ostdeutschland ab (www.bpb.de).
Die Stadtentwicklung von Ost- und Westdeutschland wurde durch diese Trennung in unterschiedliche Richtungen gelenkt.
In Westdeutschland entstand ein kapitalistisch-marktwirtschaftlich orientiertes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, indem die privaten Aufbauinitiativen freie Entfaltung finden konnten.
In Ostdeutschland hingegen entwickelte sich ein sozialistisch-planwirtschaftlich orientiertes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, indem jegliche private Bautätigkeit untersagt wurde (HEINEBERG, 2001: 221-222; LICHTENBERGER, 1991: 225)
In der sowjetisch besetzten Zone waren 72 Städte zum Teil schwer zerstört und 40% des Industriepotentials, sowie 50% des städtischen Wohnraumes vernichtet (www.bpb.de).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Situation nach dem zweiten Weltkrieg
- 2. Stadtentwicklung in der DDR 1945-1990
- 2.1. Nachkriegszeit 1945-1949
- 2.2. Stadtentwicklung 1950-1955
- 2.3. Stadtentwicklung 1955-1990
- 2.3.1. Experimentalbau „P2“
- 2.3.2. Wohnungsbauserie 70 (WBS 70)
- 2.3.3. Der sozialistische Wohnkomplex nach der Wohnungsbauserie 70
- 3. Quantitative und qualitative Entwicklung der Neubauten
- 3.1. Quantitative Entwicklung
- 3.2. Qualitative Entwicklung
- 4. Umgang mit der historischen Bausubstanz
- 5. Rekonstruktion und Neubau der Innenstädte
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stadtentwicklung in Ostdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie analysiert die verschiedenen Phasen der Wiederaufbau- und Neuplanungsmaßnahmen in der DDR, beginnend mit der unmittelbaren Nachkriegszeit bis zum Ende der 1980er Jahre. Ein Fokus liegt auf der Entwicklung der Wohnungsbaupolitik und der angewandten Baumethoden.
- Wiederaufbau Ostdeutscher Städte nach dem Zweiten Weltkrieg
- Entwicklung der Stadtplanung in der DDR
- Einfluss der sozialistischen Planwirtschaft auf den Städtebau
- Entwicklung verschiedener Wohnungsbaukonzepte (z.B. P2, WBS 70)
- Umgang mit historischer Bausubstanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Situation nach dem zweiten Weltkrieg: Die Arbeit beschreibt die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen nach dem Zweiten Weltkrieg und die daraus resultierende unterschiedliche Stadtentwicklung in Ost und West. Ostdeutschland erfuhr erhebliche Zerstörungen und stand vor großen Herausforderungen beim Wiederaufbau.
2. Stadtentwicklung in der DDR 1945-1990: Dieses Kapitel gliedert sich in verschiedene Phasen der Stadtentwicklung in der DDR. Die Nachkriegszeit (1945-1949) konzentrierte sich zunächst auf die Wiederherstellung der Bewohnbarkeit. Die Periode von 1950-1955 sah die Umsetzung der sozialistischen Bodenordnung und die Einführung der „16 Grundsätze des Städtebaus“, die stark von sowjetischen Vorbildern beeinflusst waren. Ab Mitte der 1950er Jahre konzentrierte man sich aufgrund ökonomischer Überlegungen auf großindustrielle Fertigungsmethoden im Wohnungsbau.
2.3 Stadtentwicklung 1955-1990: Die Entwicklung von verschiedenen Plattenbautypen wie dem Experimentalbau „P2“ und der Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) wird detailliert dargestellt. Diese Entwicklungen zeigen den Wandel von starren zu flexibleren Bauweisen.
Schlüsselwörter
Stadtentwicklung Ostdeutschland, DDR, Wiederaufbau, Plattenbau, sozialistische Stadtplanung, Wohnungsbau, P2, WBS 70, Karl-Marx-Allee, Planwirtschaft.
- Quote paper
- Norman Riedel (Author), 2007, Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124784