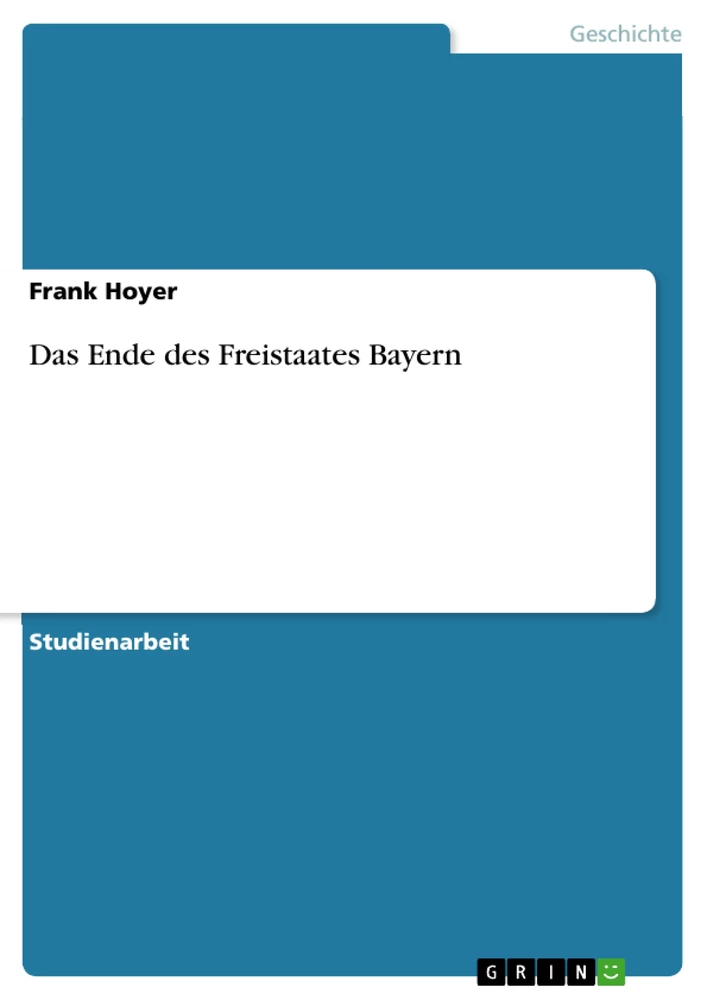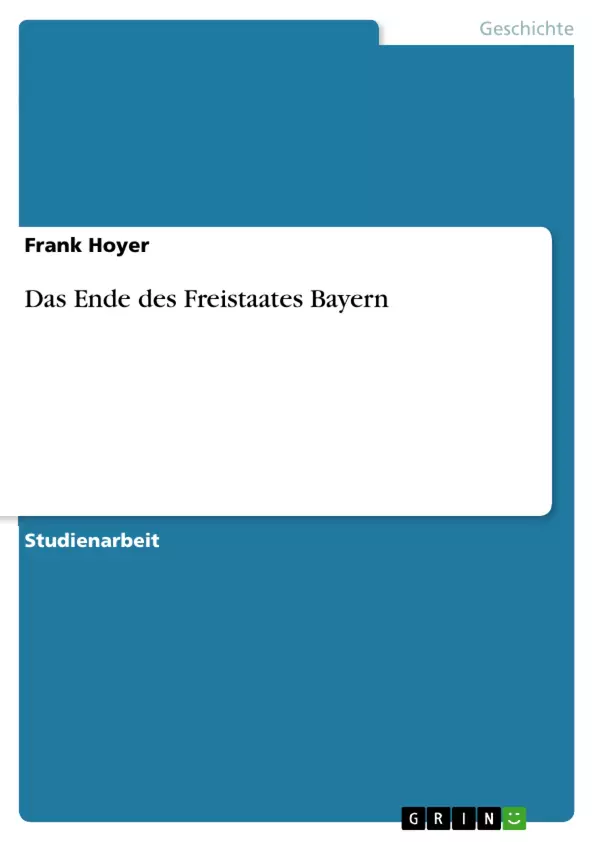Die Frage nach den Gründen und Ursachen für das schnelle Ende des Freistaates Bayern nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten sind zuletzt in der Forschung kontrovers diskutiert worden. Während Karl Schwend vor allem externe Gründe und den illegalen Prozess der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten ins Zentrum seiner Betrachtung rückt, weist Falk Wiesemann auch auf interne Versäumnisse der BVP und die heimlichen Sympathien mit der NSDAP hin, welche man für eine Koalitionsregierung auf parlamentarischer Grundlage gewinnen wollte. Weitere Fragestellungen ergeben sich zudem in der Beurteilung des Versuchs von Kreisen der BVP, den Bestand Bayerns durch Garantien seitens des Reichspräsidenten zu sichern sowie in der Einschätzung, ob ein adäquater Widerstand der bayerischen Regierung gegen das Reich überhaupt möglich gewesen wäre.
Diese Arbeit soll sich mit dem Ende des Freistaates Bayern beschäftigen. Hierzu wird im ersten Punkt zunächst die Ausschaltung der preußischen Regierung Braun von 1932 näher betrachtet, da dies als erster schwerer Schlag gegen den Föderalismus zu werten ist und auch von Bayern bereits mit Sorge aufgenommen wurde. Der zweite Punkt rückt dann die innen- und reichspolitischen Bemühungen der bayerischen Regierung um Selbstbehauptung in den Jahren 1932/1933 in den Mittelpunkt. Der dritte und letzte Punkt befasst sich schließlich mit den letzten freien Wahlen in Bayern und schildert die Ereignisse am „Tag der Machtergreifung“ (9.März 1933).
Ein abschließendes Fazit rundet die Arbeit ab und fasst nochmals unterschiedliche Standpunkte und Kontroversen zum Ende der parlamentarischen Demokratie im Freistaat Bayern zusammen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Preußenschlag am 20. Juli 1933 aus der Sicht Bayerns
- Letzte Versuche der Selbstbehauptung Bayerns zwischen dem 30. Januar 1933 und der Verkündung der Reichstagsbrandverordnung
- Verhandlungen auf Reichsebene
- Innenpolitische Reformversuche
- Veränderungen durch die Reichstagsbrandverordnung
- Das Ende der Regierung Held
- Die Reichstagwahlen vom 5. März 1933
- Machtergreifung in Bayern – Der 9. März 1933
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Ende des Freistaates Bayern im Jahr 1933. Sie analysiert die Gründe und Ursachen für den Zusammenbruch der bayerischen Selbstverwaltung unter dem Druck des aufsteigenden Nationalsozialismus.
- Der Preußenschlag von 1932 als Vorbote des Untergangs des Föderalismus
- Die innen- und außenpolitischen Strategien der Bayerischen Volkspartei (BVP) zur Abwehr des Nationalsozialismus
- Die Rolle der Reichstagswahlen von März 1933 im Prozess der Machtergreifung in Bayern
- Die Ereignisse vom 9. März 1933 und die Ernennung von Franz Ritter von Epp zum Reichskommissar
- Kontroversen in der Forschung zum Ende des Freistaates Bayern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Kontext des Untergangs des Freistaates Bayern und stellt zentrale Forschungsfragen vor. Kapitel 2 analysiert den „Preußenschlag“ von 1932 und dessen Bedeutung für Bayern. Kapitel 3 beleuchtet die innen- und außenpolitischen Bemühungen Bayerns um seine Selbstbehauptung in den Jahren vor der Machtergreifung. Es werden Verhandlungen auf Reichsebene, innenpolitische Reformversuche und die Auswirkungen der Reichstagsbrandverordnung behandelt. Kapitel 4 fokussiert auf die Reichstagswahlen und die Ereignisse des 9. März 1933, die zum Ende der Regierung Held führten.
Schlüsselwörter
Freistaat Bayern, Nationalsozialismus, Machtergreifung, BVP, Preußenschlag, Weimarer Republik, Föderalismus, Reichstagswahlen, Reichskommissar, Innenpolitik, Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wann endete der Freistaat Bayern im Jahr 1933?
Als entscheidendes Datum gilt der 9. März 1933, der „Tag der Machtergreifung“ in Bayern, an dem die Regierung Held faktisch entmachtet wurde.
Was war der „Preußenschlag“ und warum war er für Bayern wichtig?
Der Preußenschlag von 1932 war die Ausschaltung der preußischen Regierung durch das Reich. Er galt als schwerer Schlag gegen den Föderalismus und wurde in Bayern als Vorbote der eigenen Entmachtung wahrgenommen.
Welche Rolle spielte die Bayerische Volkspartei (BVP)?
Die BVP war die dominierende Partei in Bayern. Ihr wird in der Forschung teils Versäumnis bei der Abwehr der NSDAP, teils aber auch ein vergeblicher Kampf um die bayerische Selbstbehauptung zugeschrieben.
Wer war Franz Ritter von Epp?
Er wurde von den Nationalsozialisten am 9. März 1933 zum Reichskommissar für Bayern ernannt und besiegelte damit das Ende der bayerischen Eigenstaatlichkeit.
Welchen Einfluss hatte die Reichstagsbrandverordnung?
Sie schuf die rechtliche Grundlage für die Unterdrückung politischer Gegner und schwächte die Position der bayerischen Regierung gegenüber dem Reich massiv ab.
- Quote paper
- Frank Hoyer (Author), 2007, Das Ende des Freistaates Bayern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125165