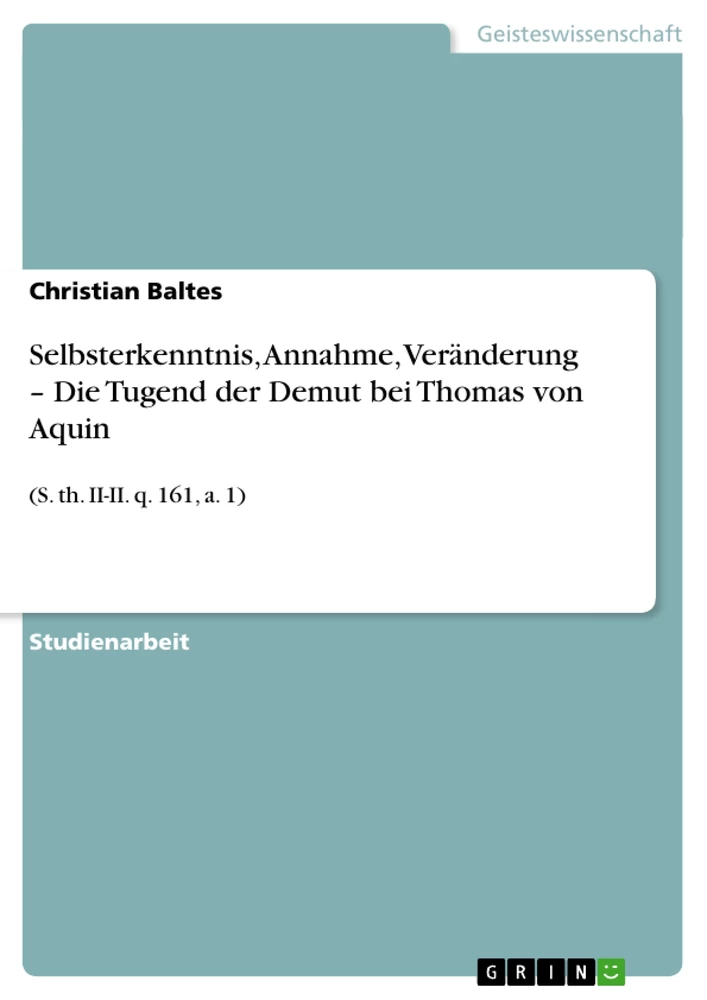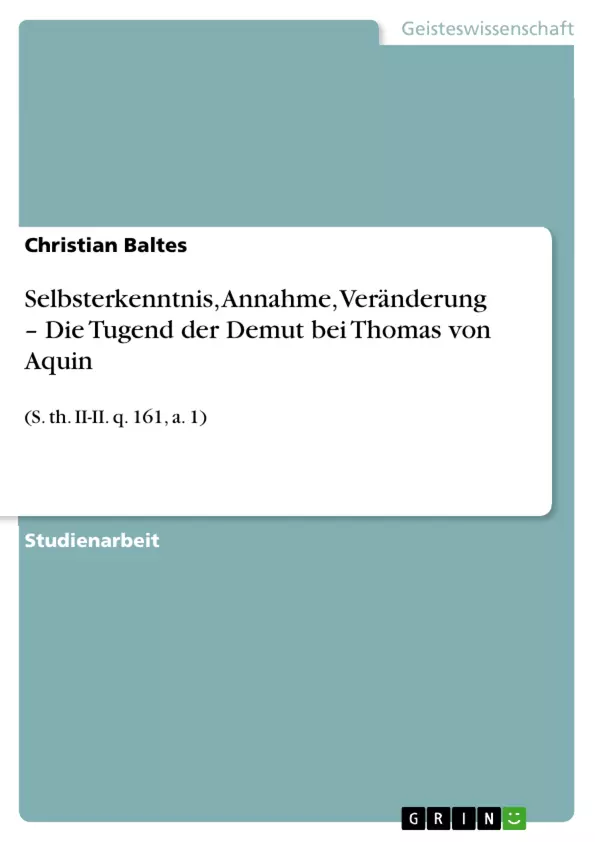Die vorliegende Arbeit soll die Ausführungen des heiligen Thomas zur Demut behandeln, wie er sie in der 161. Frage des zweiten Teils im zweiten Buch der summa theologiae darlegt. Im Besonderen habe ich diese Arbeit auf den ersten Artikel („Ist die Demut eine Tugend“) beschränkt und möchte zeigen, mit welchen Problemstellungen sich Thomas von Aquin beschäftigen muss, um seine Auffassung der Demut darzulegen.
Ich möchte mit dieser Arbeit den ersten Artikel keinesfalls lückenlos behandeln, sondern auf vier Grundprobleme hinweisen, die sich Thomas von Aquin gestellt haben und zeigen, wie er diese gelöst hat.
Alle vier Grundprobleme entspringen dabei dem aristotelischen Gedankengut, dessen sich Thomas in seiner summa theologiae immer wieder bedient, um die Vereinbarkeit von antikem und christlichem Weltverständnis zu zeigen.
In Bezug auf die Frage, ob Demut eine Tugend ist, steht so vor allem der Bedeutungsunterschied der Demut im Mittelpunkt der Überlegungen. Ist Demut im christlichen Kontext eine der wichtigsten sittlichen Tugenden, wird sie in der Antike als Schwäche ausgelegt. Hier steht also der Demutsbegriff an sich in Frage. Auch der Tugendbegriff, wie Aristoteles ihn sieht, scheint sich nicht mit der Demut zu decken, wenn man diese als Schwäche beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Sed Contra, Respondeo
- 1.1 Problem: Demut - für den antiken Menschen so nicht vorstellbar
- 1.2 Lösung: Demut als Maßhaltung
- 2. Arg. 1/Arg. 2, Ad 1/Ad 2
- 2.1 Problem: Demut als Unterdrückung
- 2.2 Lösung: Differenzierung der Begrenzung
- 2.2.1 Zwei Arten der Begrenzung
- 2.2.2 Gott als Obergrenze – Universalität der Demut
- 2.2.3 Natur als Untergrenze – Möglichkeit zur Veränderung
- 2.3 Demut von Herzen
- 3. Arg. 4, Ad 4
- 3.1 Problem: Demut als Ende aller Strebsamkeit
- 3.2 Lösung: Demut als Zurückhaltung
- 4. Arg. 5, Ad 5
- 4.1 Problem: Unterordnung als Gesetzesgerechtigkeit
- 4.2 Lösung: Demut nicht dem Staat, sondern Gott gegenüber
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Thomas von Aquins Verständnis von Demut (humilitas) im ersten Artikel der 161. Frage des zweiten Teils im zweiten Buch der Summa Theologiae. Sie fokussiert auf vier zentrale Probleme, die Thomas aus dem aristotelischen Gedankengut heraus bearbeitet, um die Vereinbarkeit antiker und christlicher Perspektiven auf Demut aufzuzeigen. Die Arbeit zeigt, wie Thomas durch die Zuweisung spezifischer Aufgaben an die Demut diese Probleme löst.
- Der Bedeutungsunterschied von Demut in der Antike und im Christentum
- Die Vereinbarkeit von Demut und dem aristotelischen Tugendbegriff
- Demut als Maßhaltung zwischen Hoffnung und Verzweiflung
- Die Rolle der Demut in Bezug auf Selbsterkenntnis, Annahme und Veränderung
- Die Abgrenzung der Demut von Unterdrückung und Unterordnung
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Arbeit behandelt Thomas von Aquins Ausführungen zur Demut in der Summa Theologiae, beschränkt sich aber auf den ersten Artikel der 161. Frage und analysiert vier zentrale Probleme, die Thomas im Kontext des aristotelischen Denkens bearbeitet. Der Fokus liegt auf dem Bedeutungsunterschied von Demut in der Antike und im Christentum und darauf, wie Thomas die Demut als Tugend im Einklang mit dem aristotelischen Tugendbegriff darstellt. Die Arbeit skizziert Thomas' Lösungsansatz, der in der Zuweisung spezifischer Aufgaben an die Demut besteht.
1. Sed Contra, Respondeo: Dieser Abschnitt beginnt mit dem "sed contra," in dem Thomas Origenes' Zitat aus Matthäus 11,29 ("Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen") zitiert, um die Frage nach der Spezifität christlicher Tugenden wie Demut und Sanftmut aufzuwerfen. Im Gegensatz zur antiken Auffassung von Demut als Schwäche oder Unterwürfigkeit, präsentiert Thomas seine Lösung: Demut als Maßhaltung zwischen Hoffnung und Verzweiflung, eine Tugend die ein realistischeres Selbstverständnis ermöglicht und somit keine Schwäche darstellt.
2. Arg. 1/Arg. 2, Ad 1/Ad 2: Dieses Kapitel beleuchtet das Problem der Demut als mögliche Unterdrückung. Thomas differenziert hier verschiedene Arten von Begrenzung, wobei Gott als Obergrenze und die Natur als Untergrenze fungieren. Diese Differenzierung erlaubt eine Verständnis von Demut, das weder Unterdrückung noch Selbstaufgabe bedeutet, sondern vielmehr eine selbstbestimmte Einschränkung im Sinne einer realistischen Selbsteinschätzung und einer Orientierung an Gott.
3. Arg. 4, Ad 4: Hier wird das Problem der Demut als Ende jeglicher Strebsamkeit behandelt. Thomas widerlegt diese Auffassung, indem er die Demut als Zurückhaltung darstellt. Es geht nicht um ein Aufgeben von Zielen, sondern um eine Besonnenheit und Mäßigung im Streben nach Zielen, um nicht in Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung zu verfallen.
4. Arg. 5, Ad 5: Dieses Kapitel thematisiert die potenzielle Verwechslung von Demut mit Unterordnung unter staatliche Gesetze. Thomas klärt, dass wahre Demut nicht einem irdischen Herrscher, sondern allein Gott gilt. Diese Unterscheidung betont die spirituelle und ethische Dimension der Demut, die über rein gesellschaftliche Konventionen hinausgeht.
Schlüsselwörter
Demut (Humilitas), Thomas von Aquin, Summa Theologiae, Aristoteles, Tugend, Maßhaltung, Selbsterkenntnis, Annahme, Veränderung, Antike, Christentum, Hoffnung, Verzweiflung, Gott, Selbsteinschätzung, Zurückhaltung, Unterordnung.
Häufig gestellte Fragen zu: Thomas von Aquins Verständnis von Demut in der Summa Theologiae
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Thomas von Aquins Verständnis von Demut (Humilitas) im ersten Artikel der 161. Frage des zweiten Teils im zweiten Buch der Summa Theologiae. Der Fokus liegt auf der Klärung von vier zentralen Problemen, die Thomas im Kontext des aristotelischen Denkens bearbeitet, um die Vereinbarkeit antiker und christlicher Perspektiven auf Demut aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht, wie Thomas durch die Zuweisung spezifischer Aufgaben an die Demut diese Probleme löst und die Demut als Tugend im Einklang mit dem aristotelischen Tugendbegriff darstellt.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Der Bedeutungsunterschied von Demut in der Antike und im Christentum; die Vereinbarkeit von Demut und dem aristotelischen Tugendbegriff; Demut als Maßhaltung zwischen Hoffnung und Verzweiflung; die Rolle der Demut in Bezug auf Selbsterkenntnis, Annahme und Veränderung; und die Abgrenzung der Demut von Unterdrückung und Unterordnung.
Welche Probleme im Zusammenhang mit Demut werden von Thomas von Aquin behandelt?
Die Arbeit identifiziert vier zentrale Probleme: Demut als für den antiken Menschen unvorstellbar; Demut als Unterdrückung; Demut als Ende aller Strebsamkeit; und Unterordnung als Gesetzesgerechtigkeit. Thomas bearbeitet diese Probleme aus dem aristotelischen Gedankengut heraus, um die Vereinbarkeit antiker und christlicher Perspektiven auf Demut zu zeigen.
Wie löst Thomas von Aquin diese Probleme?
Thomas löst die Probleme durch die Zuweisung spezifischer Aufgaben an die Demut. Er präsentiert Demut als Maßhaltung (zwischen Hoffnung und Verzweiflung), differenziert verschiedene Arten von Begrenzung (Gott als Obergrenze, Natur als Untergrenze), versteht Demut als Zurückhaltung (nicht als Ende des Strebens) und betont, dass wahre Demut Gott, nicht dem Staat gilt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Sed Contra, Respondeo, Arg. 1/Arg. 2, Ad 1/Ad 2, Arg. 4, Ad 4, Arg. 5, Ad 5 und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt ein spezifisches Problem im Zusammenhang mit Thomas von Aquins Verständnis von Demut und seine jeweilige Lösungsstrategie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demut (Humilitas), Thomas von Aquin, Summa Theologiae, Aristoteles, Tugend, Maßhaltung, Selbsterkenntnis, Annahme, Veränderung, Antike, Christentum, Hoffnung, Verzweiflung, Gott, Selbsteinschätzung, Zurückhaltung, Unterordnung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist Thomas von Aquins Summa Theologiae, speziell der erste Artikel der 161. Frage des zweiten Teils im zweiten Buch. Die Arbeit bezieht sich zudem auf das aristotelische Gedankengut und zitiert Origenes (Matthäus 11,29).
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit Thomas von Aquin, mittelalterlicher Philosophie, Theologie, dem aristotelischen Tugendbegriff und dem Verständnis von Demut beschäftigen. Sie bietet eine strukturierte und detaillierte Analyse von Thomas von Aquins Ausführungen zur Demut.
- Quote paper
- Christian Baltes (Author), 2008, Selbsterkenntnis, Annahme, Veränderung – Die Tugend der Demut bei Thomas von Aquin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125220