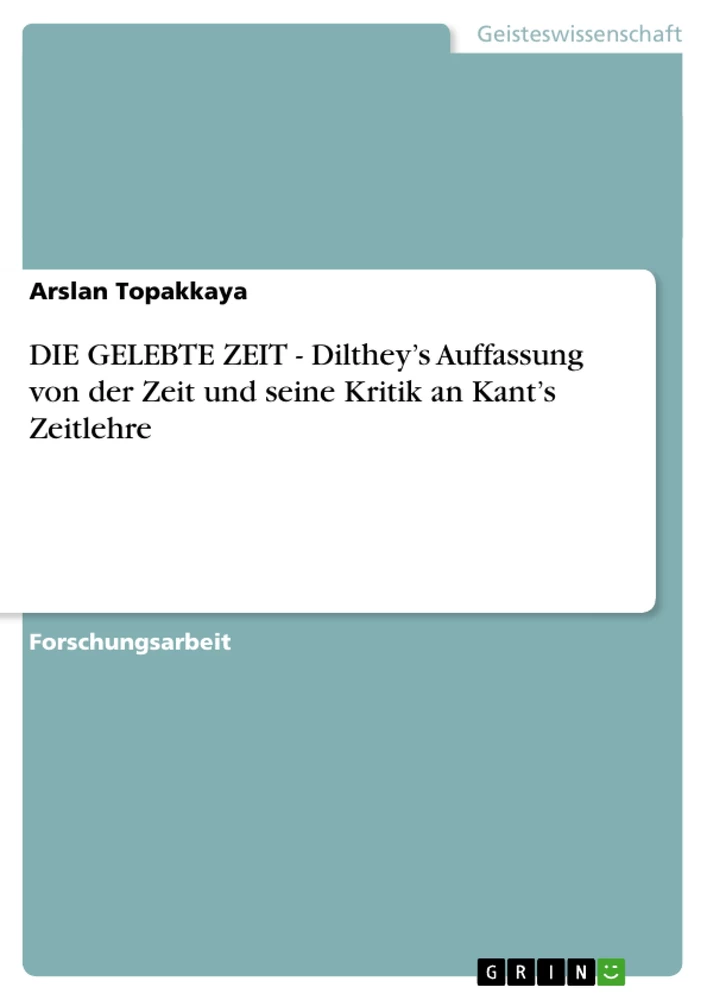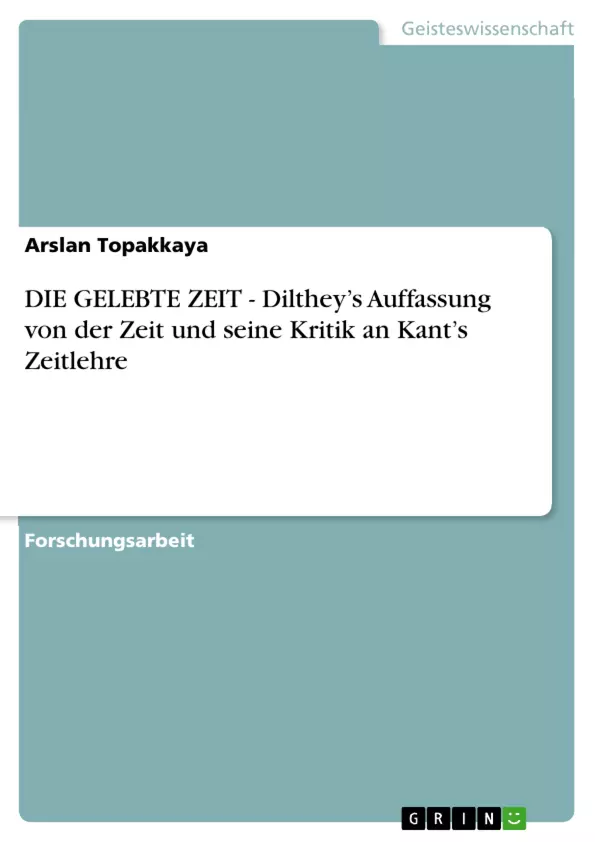Dilthey’s Zeitlehre bildet einen Widerspruch gegen die Kantische Zeitanalyse im Namen der traditionellen Zeitauffassungen. Bei der Entwicklung der Zeitlehre von Dilthey spielt auch die Kritik an der wissenschaftlichen Zeitanalyse eine wichtige Rolle. Dilthey setzt die Zeit mit der inneren Erfahrung und damit mit dem Leben in Beziehung. Er hebt den Erlebnischarakter der Zeit statt deren sukzessiven Charakter hervor. In diesem Sinne unterscheidet er die wirkliche Zeit, welche dem Leben zukommt, von der objektiven Zeit. Er ist der Meinung, dass die qualitative Zeit nicht auf die quantitative Zeit zurückzuführen ist. Er lehnt die Transzendentalität der Zeit ab. Die Zeitlichkeit macht für Dilthey die Grundlage der menschlichen Existenz aus. Dilthey will das Reich des geistigen Lebens durch die innere Erfahrung der Zeit begründen. Für Dilthey ist die Zeit am Werden der Natur nicht beteiligt, d.h. sie ist nicht das Prinzip des Werdens und Vergehens. Dilthey unternimmt im Gegensatz zu Kant keine ausführliche Analyse der Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Kapitel: Diltheys Zeitlehre
- Die Bedeutung des Zeitbegriffs in Diltheys Philosophie
- Zeitdimensionen bei Dilthey
- Gegenwart
- Vergangenheit
- Zukunft
- Die Unterschiede zwischen den Zeitdimensionen
- Die Kategorien des Denkens in Bezug auf die Zeit
- Die Zeitlichkeit des Lebens
- Der Lebensverlauf im Zusammenhang der Zeitlichkeit
- Die Unterscheidung von konkreter Zeit und phänomenaler Zeit (die Zeit des Naturgeschehens)
- Die Unermesslichkeit der Zeit in Bezug auf die Unterscheidung von realer und objektiver Zeit
- II. Kapitel: Die Zeitlehre von Kant
- Eine kurze Geschichte der Zeitauffassung vor I. Kant
- Die Zeitlehre in Kants Dissertation
- Die Bestimmung der Zeit in der transzendentalen Ästhetik der Kritik der reinen Vernunft
- Das Zeitproblem in der transzendentalen Analytik
- III. Kapitel: Diltheys Kritik an Kants Zeitlehre
- Die Bedeutung der Kantischen Philosophie für Dilthey
- Diltheys Kritik in den Berliner Logik-Vorlesungen der achtziger Jahre
- Diltheys Kritik an Kants Zeitlehre in Ausarbeitungen und Entwürfen zum zweiten Band der „Einleitung in die Geisteswissenschaften“
- Dauer und Veränderung in der Zeit im Zusammenhang der Kritik an der Kantischen Zeitlehre
- Weitere Kritik Diltheys in Bezug auf die psychischen Akte
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Diltheys Auffassung von Zeit und seine Kritik an Kants Zeitlehre. Ziel ist es, Diltheys Zeitanalyse darzustellen und zu verstehen, wie sich seine Konzeption von derjenigen Kants unterscheidet. Die Arbeit konzentriert sich auf die "gelebte Zeit" und ihre Abgrenzung von der physikalischen Zeitauffassung.
- Diltheys Zeitlehre und ihre zentralen Konzepte
- Kants Zeitlehre und ihre Schwächen aus Diltheys Perspektive
- Der Unterschied zwischen "gelebter Zeit" und "physikalischer Zeit"
- Die Bedeutung der Zeitlichkeit für das menschliche Leben
- Die Kritik an einer rein naturwissenschaftlichen Betrachtung der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung nach dem Wesen der Zeit und den unterschiedlichen philosophischen Ansätzen vor. Kapitel I analysiert Diltheys Zeitlehre, indem es die Zeitdimensionen (Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft) und deren Interrelation untersucht. Der Fokus liegt auf der Zeitlichkeit des Lebens und der Unterscheidung zwischen konkreter und phänomenaler Zeit. Kapitel II skizziert Kants Zeitlehre, beleuchtet deren historische Einbettung und analysiert die zentralen Aspekte in seiner Dissertation und der Kritik der reinen Vernunft. Kapitel III widmet sich Diltheys Kritik an Kant, indem es seine Einwände gegen Kants Auffassung darlegt und die Bedeutung dieser Kritik im Kontext von Diltheys Gesamtwerk betrachtet.
Schlüsselwörter
Dilthey, Kant, Zeitlehre, Zeitphilosophie, gelebte Zeit, physikalische Zeit, Zeitdimensionen, Lebenswelt, Kritik der reinen Vernunft, Geisteswissenschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Diltheys Zeitlehre von der Kants?
Dilthey widerspricht Kants transzendentaler Zeitanalyse und setzt die Zeit stattdessen mit der inneren Erfahrung und dem Leben in Beziehung. Während Kant die Zeit abstrakt analysiert, betont Dilthey den Erlebnischarakter der Zeit.
Was versteht Dilthey unter "gelebter Zeit"?
Unter "gelebter Zeit" versteht Dilthey die wirkliche, qualitative Zeit, die dem menschlichen Leben und der inneren Erfahrung zukommt, im Gegensatz zur objektiven, messbaren Zeit der Naturwissenschaften.
Welche Rolle spielen die Zeitdimensionen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft?
Dilthey untersucht diese Dimensionen in ihrer Interrelation, um die Zeitlichkeit des Lebens zu begründen. Die Zeitlichkeit bildet für ihn die Grundlage der menschlichen Existenz und des geistigen Lebens.
Warum lehnt Dilthey die Transzendentalität der Zeit ab?
Dilthey ist der Ansicht, dass Zeit nicht nur eine reine Form der Anschauung ist, sondern tief im Werden des Lebens und der Geschichte verwurzelt ist, weshalb er die rein mathematisch-quantitative Betrachtung ablehnt.
Wie grenzt Dilthey die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften ab?
Er will das Reich des geistigen Lebens durch die innere Erfahrung der Zeit begründen und kritisiert eine rein naturwissenschaftliche Analyse, die den qualitativen Lebensaspekt der Zeit vernachlässigt.
- Citation du texte
- PD.Dr. Arslan Topakkaya (Auteur), 2009, DIE GELEBTE ZEIT - Dilthey’s Auffassung von der Zeit und seine Kritik an Kant’s Zeitlehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125692