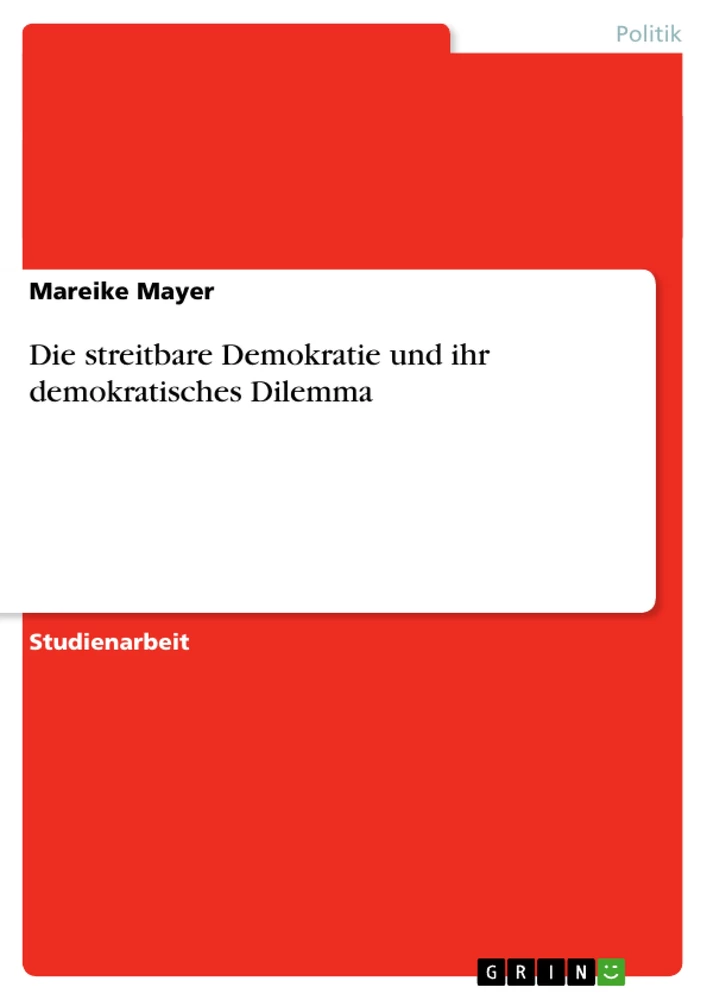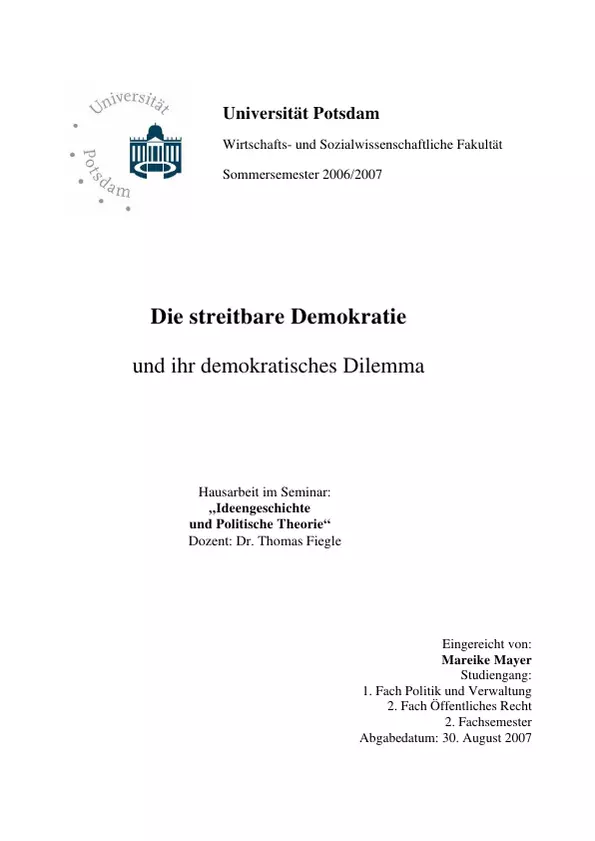„Wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen“ (Popper 1992: 333). Dieses Zitat Karl Poppers von 1945 macht das grundlegende Spannungsverhältnis zwischen dem Freiheits- und Gleichheitsprinzip demokratischer Staaten und der Notwendigkeit des Schutzes derselben deutlich. Noch unter den Eindrücken und schrecklichen Erfahrungen des Nationalsozialismus, stellten sich Wissenschaftler die Frage ob bzw. wie sich demokratische Staaten gegen die Systemunterwanderung durch totalitäre Bestrebungen schützen können, ohne damit ihre eigenen Prinzipien zu verletzen. Auch das deutsche Konzept der streitbaren Demokratie wird immer wieder als „Lehre aus Weimar“ bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst auf das „demokratische Dilemma“ eingegangen werden und anschließend das von Loewenstein vorgeschlagene Lösungskonzept, der militant democracy, als theoretische Grundlage skizziert werden. Darauf aufbauend soll die deutsche Umsetzung erläutert werden, um anschließend sowohl Kritiker als auch Befürworter der streitbaren Demokratie des Grundgesetzes zu Wort kommen zu lassen. Abschließend soll die Frage beantwortet werden können, ob das deutsche Prinzip der Verbindung von Werthaftigkeit mit Wehrhaftigkeit ein haltbares Konzept für einen freiheitlichen Staat ist.
Diese Konzepte zum Schutz von demokratischen Staaten richten sich dabei nicht in erster Linie gegen gewalttätige Angriffe auf den demokratischen Verfassungsstaat, sondern gegen Bestrebungen, die sich der Mittel der Demokratie selbst bedienen, um so den Umsturz eines demokratischen Systems zu betreiben. Unter dem Eindruck totalitärer Regime in Europa zu dieser Zeit, bezieht Loewenstein dies vor allem auf den Faschismus, den er nicht als Ideologie sieht, sondern als die „effektivste politische Technik der modernen Geschichte“ (Loewenstein 2004: 341). Er beschreibt diese 1937: [...]
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Das „demokratische Dilemma“
3. Loewensteins Konzept der militant democracy
4. Die Konzeption der streitbaren Demokratie im Grundgesetz
5. Kritiker und Befürworter der streitbaren Demokratie in Deutschland
6. Zusammenfassung und Fazit
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung:
„Wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen“ (Popper 1992: 333). Dieses Zitat Karl Poppers von 1945 macht das grundlegende Spannungsverhältnis zwischen dem Freiheits- und Gleichheitsprinzip demokratischer Staaten und der Notwendigkeit des Schutzes derselben deutlich. Noch unter den Eindrücken und schrecklichen Erfahrungen des Nationalsozialismus, stellten sich Wissenschaftler die Frage ob bzw. wie sich demokratische Staaten gegen die Systemunterwanderung durch totalitäre Bestrebungen schützen können, ohne damit ihre eigenen Prinzipien zu verletzen. Auch das deutsche Konzept der streitbaren Demokratie wird immer wieder als „Lehre aus Weimar“ bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst auf das „demokratische Dilemma“ eingegangen werden und anschließend das von Loewenstein vorgeschlagene Lösungskonzept, der militant democracy, als theoretische Grundlage skizziert werden. Darauf aufbauend soll die deutsche Umsetzung erläutert werden, um anschließend sowohl Kritiker als auch Befürworter der streitbaren Demokratie des Grundgesetzes zu Wort kommen zu lassen. Abschließend soll die Frage beantwortet werden können, ob das deutsche Prinzip der Verbindung von Werthaftigkeit mit Wehrhaftigkeit ein haltbares Konzept für einen freiheitlichen Staat ist.
Diese Konzepte zum Schutz von demokratischen Staaten richten sich dabei nicht in erster Linie gegen gewalttätige Angriffe auf den demokratischen Verfassungsstaat, sondern gegen Bestrebungen, die sich der Mittel der Demokratie selbst bedienen, um so den Umsturz eines demokratischen Systems zu betreiben. Unter dem Eindruck totalitärer Regime in Europa zu dieser Zeit, bezieht Loewenstein dies vor allem auf den Faschismus, den er nicht als Ideologie sieht, sondern als die „effektivste politische Technik der modernen Geschichte“ (Loewenstein 2004: 341). Er beschreibt diese 1937:
„Ihr Erfolg basiert auf einer perfekten Anpassung an die Demokratie. Die Demokratie und demokratische Toleranz wurden für ihre eigene Zerstörung benutzt. Unter dem Deckmantel von Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit konnte die antidemokratische Maschine aufgebaut und legal in Gang gesetzt werden. Mit dem geschickten Kalkül, dass die Demokratie nicht, ohne sich selbst zu verleugnen, irgendeinem Teil der öffentlichen Meinung den vollen Gebrauch der freien Rede, Presse, Versammlung sowie parlamentarischer Partizipation verweigern könne, diskreditieren die Exponenten des Faschismus systematisch die demokratische Ordnung und machen sie funktionsunfähig, bis das Chaos herrscht (ebd.: 341)
Allerdings ist Loewensteins Konzept, auch wenn es vor 70 Jahren geschrieben wurde und sich vorwiegend auf den Faschismus bezog, bis heute hochaktuell geblieben. Nicht nur weil die meisten westlichen Demokratien Formen von Staatsschutz als Bestandteil ihrer Verfassung aufgenommen haben, sondern weil auch heute noch Politiker wie der amerikanische Präsident George W. Bush oder auch der deutsche Innenminister Wolfgang Schäuble Maßnahmen zum Staatsschutz mit dem Konzept der militant democracy rechtfertigen, wenn auch der globale Terrorismus sicherlich eine ganz andere Form der Bedrohung ist. Die Frage nach Grenzen der Legitimität von Grundrechtseinschränkungen bleibt somit sowohl im demokratietheoretischen Diskurs, als auch in den Medien wichtig und kontrovers diskutiert.
2. Das demokratische Dilemma
Darf sich ein demokratischer Staat vor seinen Feinden schützen, und dabei gegen die Grundsätze seiner selbst handeln? Verletzt er nicht, indem er Grundrechte zum Schutz vor Feinden einschränkt, seine grundlegendsten Prinzipien und stellt somit seine eigene Existenzberechtigung in Frage? Gefährdet er nicht, wenn er dies nicht tut, seine eigene Existenz und somit wiederum die Freiheit seiner Bürger1?
Karl Loewenstein, Begründer des Konzepts der militant democracy, sieht den „konstitutionell-demokratische(n) Staat vor das größte Dilemma seit seiner Entstehung gestellt. Entschließt er sich, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und den totalitären Angreifern den Gebrauch der demokratischen Freiheiten zur letztlichen Zerstörung aller Freiheiten zu verwehren, handelt er gerade den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit zuwider, auf denen er selbst beruht. Hält er aber an den demokratischen Grundwahrheiten auch zugunsten ihrer geschworenen Feinde fest, setzt er seine eigene Existenz aufs Spiel“ (Loewenstein 1969: 348/349). Karl Popper beschreibt dieses Dilemma als ‚Paradoxon der Toleranz’ welches, wie eingangs zitiert, besagt, dass „Uneingeschränkte Toleranz […] mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz“ (Popper 1992: 333) führt. Toleranz dürfe somit nicht unbeschränkt für die Intoleranten gelten, sondern nur „solange wir ihnen durch rationale Argumente beikommen können und solange wir sie durch die öffentliche Meinung in Schranken halten können“ (ebd.: 333). Somit wird auch bei Popper die schwere Gratwanderung zwischen nötiger Freiheitsbeschränkung zum Schutz der Demokratie und Unterdrückung politischer Freiheiten deutlich.
[...]
1 s. ausführlich dazu Boventer: 17f., 44ff.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „streitbare Demokratie“?
Es beschreibt die Fähigkeit eines demokratischen Staates, sich aktiv gegen Bestrebungen zu wehren, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen.
Was ist das „demokratische Dilemma“?
Das Dilemma besteht darin, dass eine Demokratie ihre eigenen Freiheitsrechte einschränken muss, um sich vor Feinden zu schützen, die eben diese Rechte zu ihrer Zerstörung nutzen wollen.
Was besagt Poppers „Paradoxon der Toleranz“?
Es besagt, dass uneingeschränkte Toleranz zum Verschwinden der Toleranz führt, wenn man Intoleranz nicht entgegentritt.
Wer war Karl Loewenstein?
Loewenstein war der Begründer des Konzepts der „militant democracy“, das als theoretische Grundlage für die wehrhafte Demokratie in Deutschland diente.
Wie setzt das Grundgesetz Wehrhaftigkeit um?
Durch Instrumente wie das Parteiverbot, die Verwirkung von Grundrechten oder die Ewigkeitsklausel für zentrale Verfassungsprinzipien.
- Citar trabajo
- Mareike Mayer (Autor), 2007, Die streitbare Demokratie und ihr demokratisches Dilemma, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125773