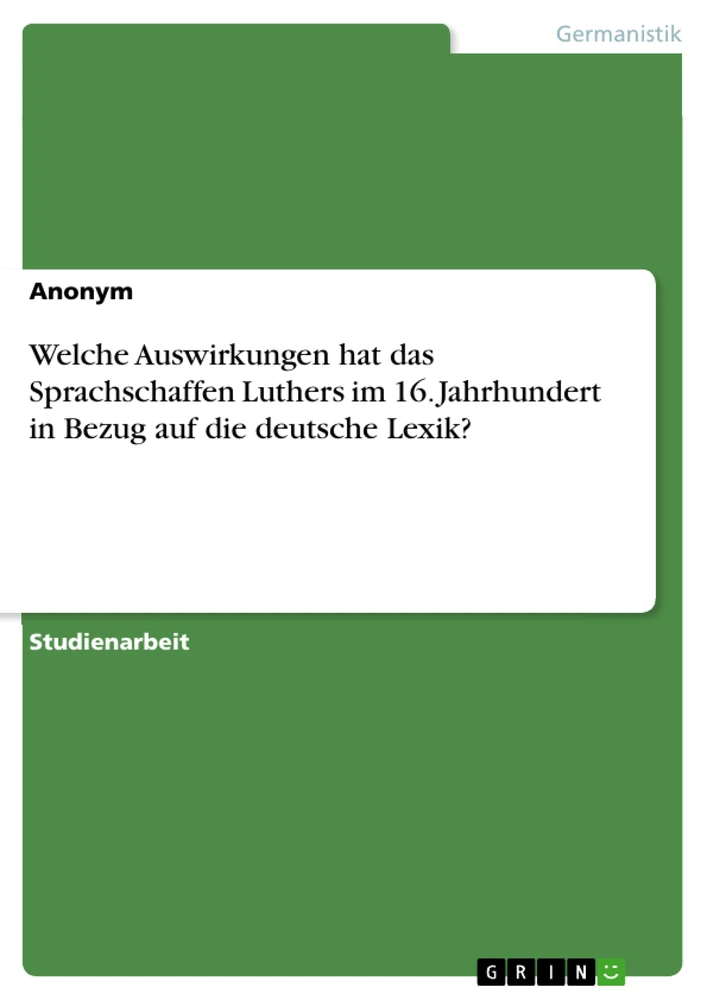Unter der Fragestellung: „Welche Auswirkungen hat das Sprachschaffen Luthers im 16. Jahrhundert in Bezug auf die deutsche Lexik?“, soll Luthers Rolle in der von Gerhard Ising angesprochenen Vereinheitlichung im Wortschatz diskutiert werden. Da verschiedene Ansichten in der Forschung bereits erwiesen sind, stellt sich dieses Thema als besonders relevant heraus. Gerade der Teilaspekt des lutherischen Wortschatzes, auch die „Luthersprache“ genannt, weist in der Literatur verschiedene Standpunkte auf.
Luthers Sprachschaffen in Bezug auf die deutsche Lexik im Laufe des 16. Jahrhunderts eröffnet einen Blickwinkel auf das Wirken Luthers im deutschsprachigen Raum seiner Zeit bis hin zu den heutigen Auswirkungen. Ausgehend von dem durch Erwin Arndt geprägten Begriff des: „Sprachschaffens“ sollen in der Arbeit zum einen der Einfluss Luthers im 16. Und 17. Jahrhundert auf der regionalen und überregionalen Ebene der Lexik behandelt und zum anderen der Einfluss des lutherischen Wortschatzes bis heute thematisiert werden. Das Sprachschaffen nach Arndt ist die Hinwendung Luthers zu einem Sprachgebrauch, der bis heute eine lebendige Sprache hervorgerufen und den Wortschatz geprägt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Luther und sein Sprachschaffen
- Die Entwicklung einer überregionalen Sprache
- Der Ausgleichprozess
- Luther und sein Sprachschaffen bis heute – die Luthersprache
- Luthersprache- Beispiele zur Verdeutlichung des Sprachschaffens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Luthers Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Sprache im 16. und 17. Jahrhundert. Der Fokus liegt dabei auf dem Sprachschaffen Luthers in Bezug auf die deutsche Lexik. Es soll untersucht werden, wie Luthers Werk die deutsche Sprache beeinflusste und welche Auswirkungen dies bis heute hat.
- Die Entwicklung einer überregionalen Sprache im 16. und 17. Jahrhundert
- Der Einfluss Luthers auf die Vereinheitlichung der deutschen Lexik
- Die „Luthersprache“ und ihre Bedeutung für die heutige deutsche Sprache
- Die Herausbildung des schriftsprachlichen deutschen Wortschatzes
- Die Rolle Luthers im Ausgleichprozess zwischen regionalen Sprachformen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachschaffens Luthers ein und stellt die Forschungsfrage nach den Auswirkungen seines Werkes auf die deutsche Lexik dar. Es werden verschiedene Standpunkte zur „Luthersprache“ und der Bedeutung Luthers für die Entwicklung der deutschen Sprache beleuchtet.
Luther und sein Sprachschaffen – Die Entwicklung einer überregionalen Sprache
Dieses Kapitel analysiert Luthers Einfluss auf die Entwicklung einer überregionalen Sprache im 16. und 17. Jahrhundert. Es wird die Bedeutung seines Wirkungsradius, seiner Herkunft und seiner Reisen für die Entwicklung des deutschen Wortschatzes hervorgehoben. Auch die Rolle seiner Bibelübersetzung als Motor für Sprachentwicklung wird erläutert.
Der Ausgleichprozess, die Wortbildungskraft und die Wortgebundenheit
In diesem Kapitel wird der „Ausgleichprozess“ zwischen regionalen Sprachformen im 15. und 16. Jahrhundert im Detail betrachtet. Es werden verschiedene Aspekte des Ausgleichsprozesses, wie die Übernahme von Wörtern aus regionalen Dialekten und die Bedeutung von Luthers geografischer Lage, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Sprachschaffen, Lexik, Luthersprache, Ausgleichprozess, regionale Sprachformen, Bibelübersetzung, Wortbildung, Wortgeographie und deutsche Nationalsprache.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Martin Luther den deutschen Wortschatz?
Luther trug maßgeblich zur Vereinheitlichung der deutschen Lexik bei, indem er durch seine Bibelübersetzung eine überregionale Sprache schuf, die regionale Dialekte überwand.
Was versteht man unter dem Begriff 'Luthersprache'?
Es bezeichnet den spezifischen Wortschatz und die Sprachgewalt Luthers, die viele Begriffe hervorbrachte, die bis heute fest im deutschen Sprachgebrauch verankert sind.
Was war der 'Ausgleichsprozess' im 16. Jahrhundert?
Ein sprachlicher Prozess, bei dem verschiedene regionale Sprachformen (z.B. Oberdeutsch und Niederdeutsch) zu einer gemeinsamen schriftsprachlichen Norm verschmolzen.
Warum war Luthers Bibelübersetzung so erfolgreich?
Luther nutzte eine volksnahe Sprache ('dem Volk aufs Maul schauen'), die durch den Buchdruck schnell verbreitet wurde und so zur Grundlage der neuhochdeutschen Schriftsprache wurde.
Hat Luther neue Wörter erfunden?
Ja, Luther besaß eine enorme Wortbildungskraft und schuf bekannte Begriffe wie 'Gewissensbisse', 'Lästermaul' oder 'Lockvogel'.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Welche Auswirkungen hat das Sprachschaffen Luthers im 16. Jahrhundert in Bezug auf die deutsche Lexik?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1262653