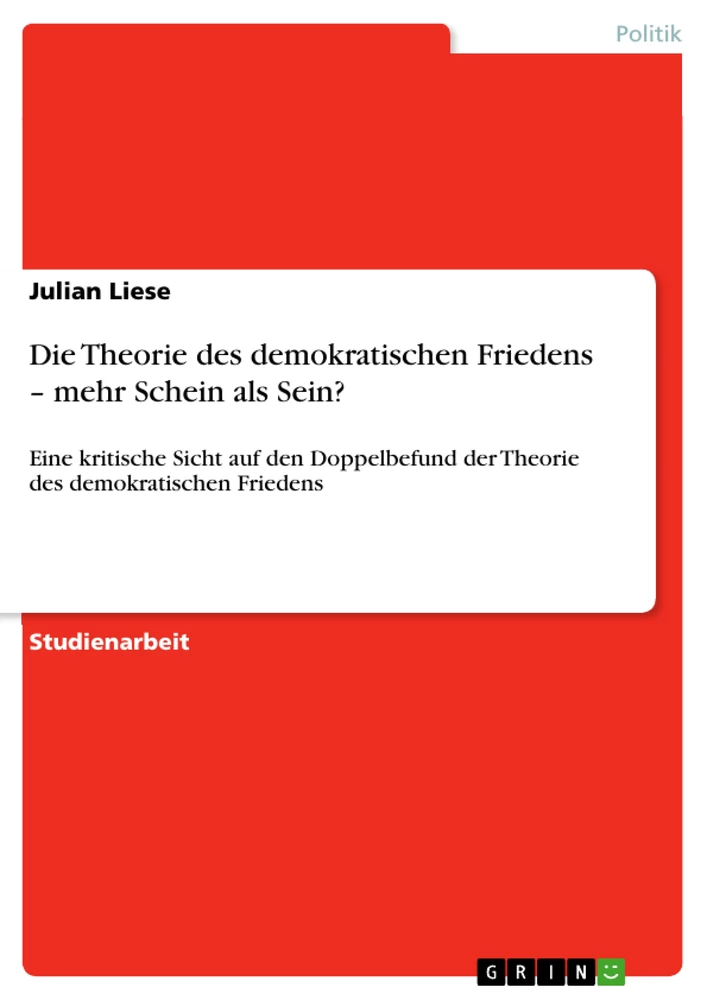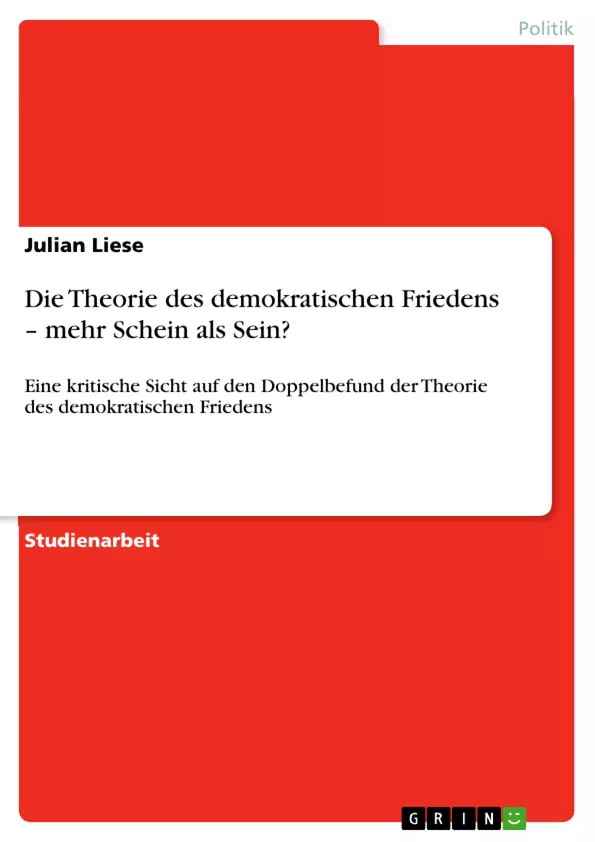„Mitte der 1980er Jahre bemerkten die Statistiker, dass sie etwas übersehen hatten. Herrschende Meinung war bis dahin gewesen, dass Demokratien in ihrer Außenpolitik genauso gewaltbereit agieren würden wie andere Staaten auch. Offenkundig schreckten sie weder vor militärischen Konflikten noch vor der bewaffneten Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Länder zurück. Die USA kämpften in Vietnam, England kämpfte um die Falklandinseln, Frankreich kämpfte in Schwarzafrika und Indien kämpfte gegen Pakistan, um nur vier Beispiele zu nennen.[...] Es ist das Verdienst von Michael Doyle (1983), die Forschung auf [die] bemerkenswert geringe Gewaltanfälligkeit zwischendemokratischer Beziehungen aufmerksam gemacht zu haben. Seither fahndet eine Unzahl von SozialwissenschaftlerInnen nach einer liberalen Erklärung für dieses Phänomen“.
Der aktuelle Forschungsstand und die zugrunde liegenden Informationen auf dem zu untersuchenden Gebiet sind aufgrund der Streitbarkeit und dem hohen Diskussionspotenzial sehr weitläufig und schwer zu überschauen.
Da die wissenschaftliche Forschungslandschaft seit dem Ende der 1970er Jahre hier stark angewachsen ist, werde ich mich zur Klärung der Kernbegriffe der Theorie auf die einführende und grundlegende Literatur beschränken. Unter anderem liegen hier die Arbeiten zu den Autoren Czempiel, Doyle, Moravcsik und Russett vor. Im Hauptteil der Arbeit soll der Doppelbefund der demokratischen Friedenstheorie kritisch beleuchtet werden. Zentrale Begriffe für die kommende Betrachtung sind: Die Theorie des Liberalismus, Demokratie und Frieden, sowie ihre jeweiligen Gegenspieler (also nichtdemokratischen Staaten und Krieg).
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- 1. Einleitende Worte und Fragestellung
- 2. Forschungsstand, zentrale Begriffe und Argumentationsgang
- B) Hauptteil
- 3. Der Liberalismus
- 4. Die Bedeutung des Staatentypus im Liberalismus - Partizipation in der Demokratie
- 5. Unabhängige Variable: Demokratie - Abhängige Variable: Frieden
- 6. Kernelemente des Doppelbefundes der Theorie des demokratischen Friedens
- 6.1 Die Wirtschaftlichkeit des Krieges
- 6.2 Die Gesellschaftsform - ein Wahrnehmungsproblem
- 6.2.1 Das Problem der leichten Kriegsführung
- 6.2.2 Konfliktive Wertesysteme
- 6.2.3 Sozial-konstruktivistische Erklärungsversuche
- C) Schluss
- 7. Fazit
- 8. Weiterführende Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Theorie des demokratischen Friedens und untersucht kritisch den Doppelbefund, der besagt, dass Demokratien untereinander (fast) keine Kriege führen, aber gleichzeitig genauso häufig wie andere Herrschaftstypen in Kriege verwickelt sind. Die Arbeit analysiert die Theorie des demokratischen Friedens aus liberaler Perspektive, wobei der Fokus auf die Bedeutung der Gesellschaft und ihrer individuellen Einflussnahme auf die Außenpolitik eines Staates liegt. Die Arbeit beleuchtet die Kernelemente des Doppelbefundes, insbesondere die Rolle der Wirtschaftlichkeit des Krieges und die Bedeutung der Gesellschaftsform für die Wahrnehmung von Konflikten.
- Die Theorie des demokratischen Friedens und ihr Doppelbefund
- Der Liberalismus als theoretisches Fundament
- Die Bedeutung der Gesellschaft und individueller Interessen für die Außenpolitik
- Die Rolle der Wirtschaftlichkeit des Krieges
- Die Bedeutung der Gesellschaftsform für die Wahrnehmung von Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Theorie des demokratischen Friedens ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den Forschungsstand und die zentralen Begriffe der Theorie. Der Hauptteil der Arbeit widmet sich dem Liberalismus als theoretisches Fundament der Theorie des demokratischen Friedens. Er untersucht die Bedeutung des Staatentypus für die Außenpolitik und die Rolle der Demokratie im Kontext von Frieden und Krieg. Der Hauptteil analysiert auch die Kernelemente des Doppelbefundes der Theorie des demokratischen Friedens, insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Krieges und die Bedeutung der Gesellschaftsform für die Wahrnehmung von Konflikten. Der Schluss der Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und stellt weiterführende Fragestellungen in den Raum.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Theorie des demokratischen Friedens, den Liberalismus, Demokratie, Frieden, Krieg, Wirtschaftlichkeit des Krieges, Gesellschaftsform, Wahrnehmung, sozial-konstruktivistische Erklärungsversuche, Doppelbefund.
- Quote paper
- Julian Liese (Author), 2009, Die Theorie des demokratischen Friedens – mehr Schein als Sein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126296