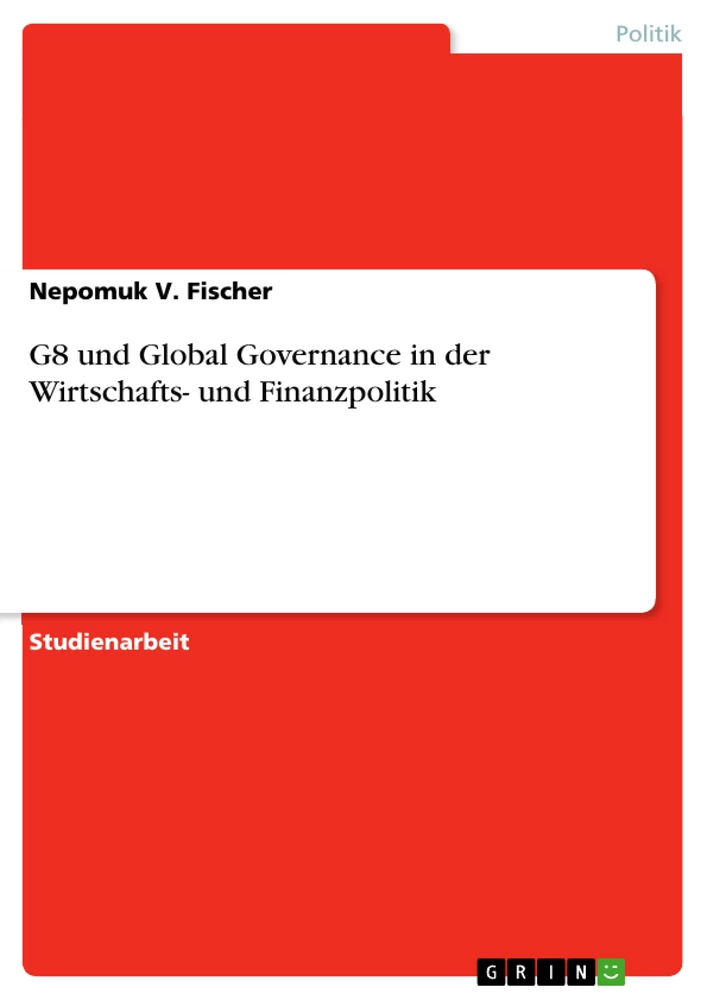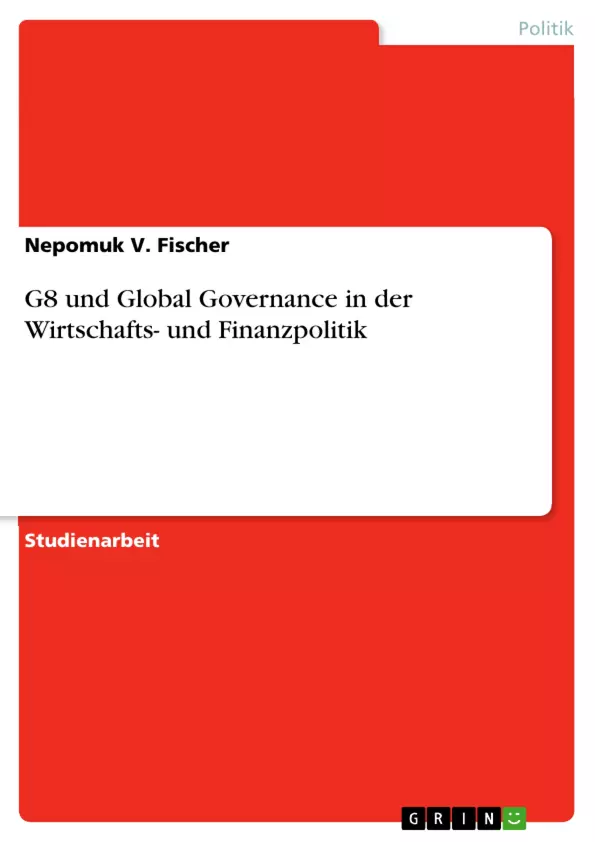In der vorliegenden Arbeit soll erörtert werden, ob zum einen die Gruppe der 8 strukturell dazu in der Lage ist eine grundsätzliche Reform der Weltwirtschafts- und Finanzarchitektur durchzusetzen und so eine Art „Weltwirtschafts-Finanzdirektorium“ darzustellen. Und zum anderen ob eine echte wirtschafts- und finanzpolitische Global Governance durch die G8 Chancen auf dauerhaften Bestand hat.
Global Governance kann in Deutschland mit dem Begriff der „Weltordnungspolitik“ wiedergegeben werden und wurde einerseits durch eine Initiative von Willy Brandt 1990 populär (Comission on Global Governance), sowie von dem Politikwissenschaftler Rosenau geprägt: „governance without government“. Jedoch lehnen die Vordenker und Verfechter des Konzeptes Global Governance einen „Weltstaat“ oder eine „Weltregierung“ als „bürokratische Superbehörde“ ohne demokratische Legitimation kategorisch ab.
„Global Governance ist somit nicht nur ein deskriptiver Begriff, sondern ein breiter analytischer Ansatz, der Politik unter den Bedingungen der Globalisierung anspricht:“
Dieser analytische Ansatz beschäftigt sich damit, welche Grundlagen, durch welche Mechanismen, nach wessen Interessen, durch wen entschieden werden.
Unter diesem Gesichtspunkt handelt es sich bei Global Governance um Netzwerkverbindungen auf lokaler bis globaler Ebene, die auf der Vorstellung einer sozial gerechteren, finanziell stabileren und ökologisch verträglicheren Welt beruhen.
Deshalb ist das elementare Thema des Global Governance Ansatzes aufgrund der zunehmenden Verflechtung und Vernetzung von Unternehmen auf der gesamten Welt: die Wirtschaft.
Im Folgenden soll ein Blick auf die Struktur der G7/G8 Weltwirtschafts- und Finanzpolitik geworfen werden, die erheblichen Einfluss auf die internationale Ökonomie ausübt. „Die G8 Staaten erwirtschaften mehr als zwei Drittel des Weltsozialprodukts, sind für knapp die Hälfte des Welthandels verantwortlich, stellen dreiviertel der weltweiten Entwicklungshilfe und sind die größten Beitragszahler in den internationalen Organisationen.“
Die Gründung der Gruppe der 8 geht auf die siebziger Jahre zurück.
Der Niedergang der hegemonialen Stellung der USA, der wirtschaftliche Aufschwung Japans und Europas, die internationalen Ölkrisen und der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse, führte den Staatschefs der westlichen Industrienationen damals die Interdependenz und damit die Verwundbarkeit ihrer Volkswirtschaften vor Augen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Idee der institutionalisierten Gruppenhegemonie
- Das Machtpotential der G7/G8 als Weltwirtschaftsdirektorium
- Zur relationalen Macht der G7/G8
- Zur strukturellen Macht der G7/G8
- Die G7/G8 in den internationalen Finanzinstitutionen (IFIs)
- Die Kohärenz und Compliance der G8
- Die G7 mit Russland zur G8
- Die Politikfelderweiterung der G8
- Die Problembehandlung innerhalb der G7
- Hegemonialposition
- Die Finanzarchitektur
- Innenpolitische Stabilität und die Frage nach der Compliance
- Das Problem der Legitimität
- Die Rechtsgültigkeit der G8
- Innerwestlicher Widerstand von Globalisierungsgegnern
- Fazit
- Ausblick auf die Zukunft der G8
- Literaturverzeichnis
- Literatur aus dem Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die G8 in der Lage ist, eine grundlegende Reform der Weltwirtschafts- und Finanzarchitektur durchzusetzen und somit als „Weltwirtschafts-Finanzdirektorium“ zu fungieren. Darüber hinaus wird untersucht, ob eine echte wirtschafts- und finanzpolitische Global Governance durch die G8 dauerhaft Bestand haben kann.
- Die Rolle der G8 in der Gestaltung der Weltwirtschafts- und Finanzarchitektur
- Die Machtstrukturen und das Einflussvermögen der G8
- Die Legitimität und die Herausforderungen der G8 im Kontext der Global Governance
- Die Chancen und Risiken einer dauerhaften Global Governance durch die G8
- Die Bedeutung der G8 für die internationale Zusammenarbeit und die Bewältigung globaler Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Global Governance und die Rolle der G8 ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Gruppe und ihre Bedeutung für die internationale Wirtschaftspolitik.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Idee der institutionalisierten Gruppenhegemonie und analysiert, ob die G8 in der Lage ist, eine solche Hegemonie zu bilden.
Das dritte Kapitel untersucht das Machtpotential der G8 als Weltwirtschaftsdirektorium. Es analysiert die relationale und strukturelle Macht der Gruppe sowie ihren Einfluss auf die internationalen Finanzinstitutionen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Kohärenz und Compliance der G8. Es beleuchtet die Herausforderungen der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, die Frage der Hegemonialposition und die Bedeutung der Finanzarchitektur.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Problem der Legitimität der G8. Es analysiert die Rechtsgültigkeit der Gruppe und den Widerstand von Globalisierungsgegnern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Global Governance, G8, Weltwirtschafts- und Finanzpolitik, Gruppenhegemonie, Machtpotential, Legitimität, Compliance, Finanzarchitektur, Globalisierung, Widerstand, internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Kann die G8 als „Weltwirtschafts-Finanzdirektorium“ bezeichnet werden?
Die Arbeit untersucht, ob die G8 aufgrund ihres hohen Anteils am Weltsozialprodukt und Welthandel strukturell in der Lage ist, die globale Finanzarchitektur maßgeblich zu steuern.
Was bedeutet „Global Governance“ in diesem Kontext?
Global Governance wird hier als analytischer Ansatz für Politik unter Globalisierungsbedingungen verstanden („governance without government“), der auf internationale Netzwerke statt auf einen Weltstaat setzt.
Warum wurde die Gruppe der G7/G8 ursprünglich gegründet?
Die Gründung in den 1970er Jahren war eine Reaktion auf die Ölkrisen und den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems, um die wirtschaftliche Interdependenz der Industrienationen zu koordinieren.
Welche Rolle spielt die Legitimität der G8?
Die Arbeit diskutiert die mangelnde demokratische Legitimation der G8 und den Widerstand von Globalisierungsgegnern gegen die informelle Macht der Gruppe.
Wie beeinflusst die G8 internationale Finanzinstitutionen (IFIs)?
Durch ihre strukturelle Macht üben die G8-Staaten erheblichen Einfluss auf Organisationen wie den IWF und die Weltbank aus.
- Citar trabajo
- Dipl.sc.pol.Univ. Nepomuk V. Fischer (Autor), 2005, G8 und Global Governance in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126392