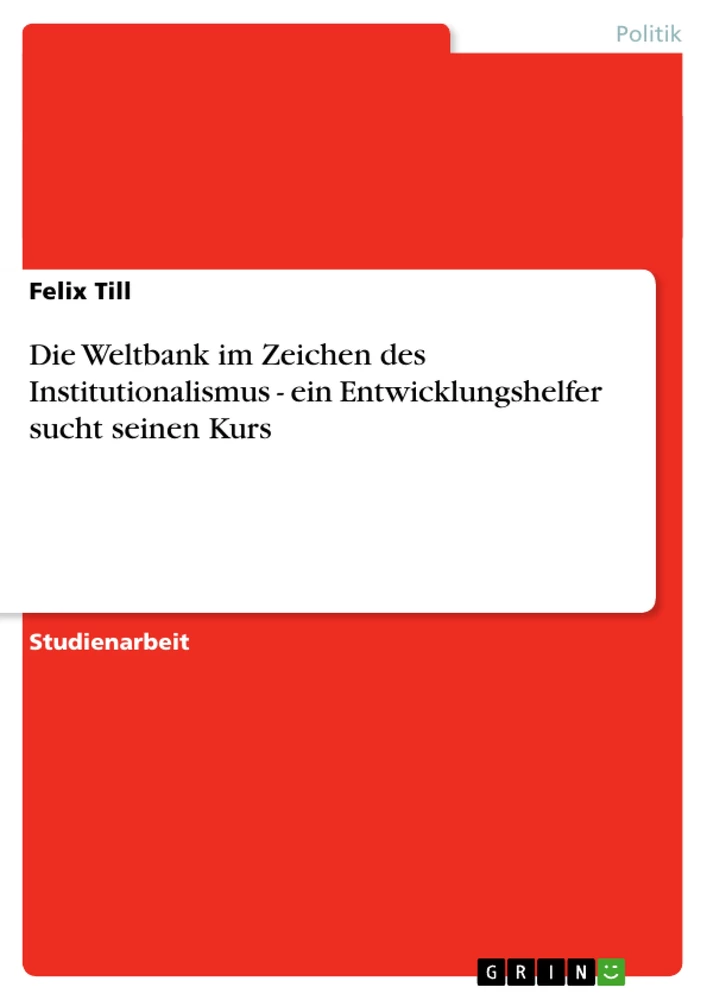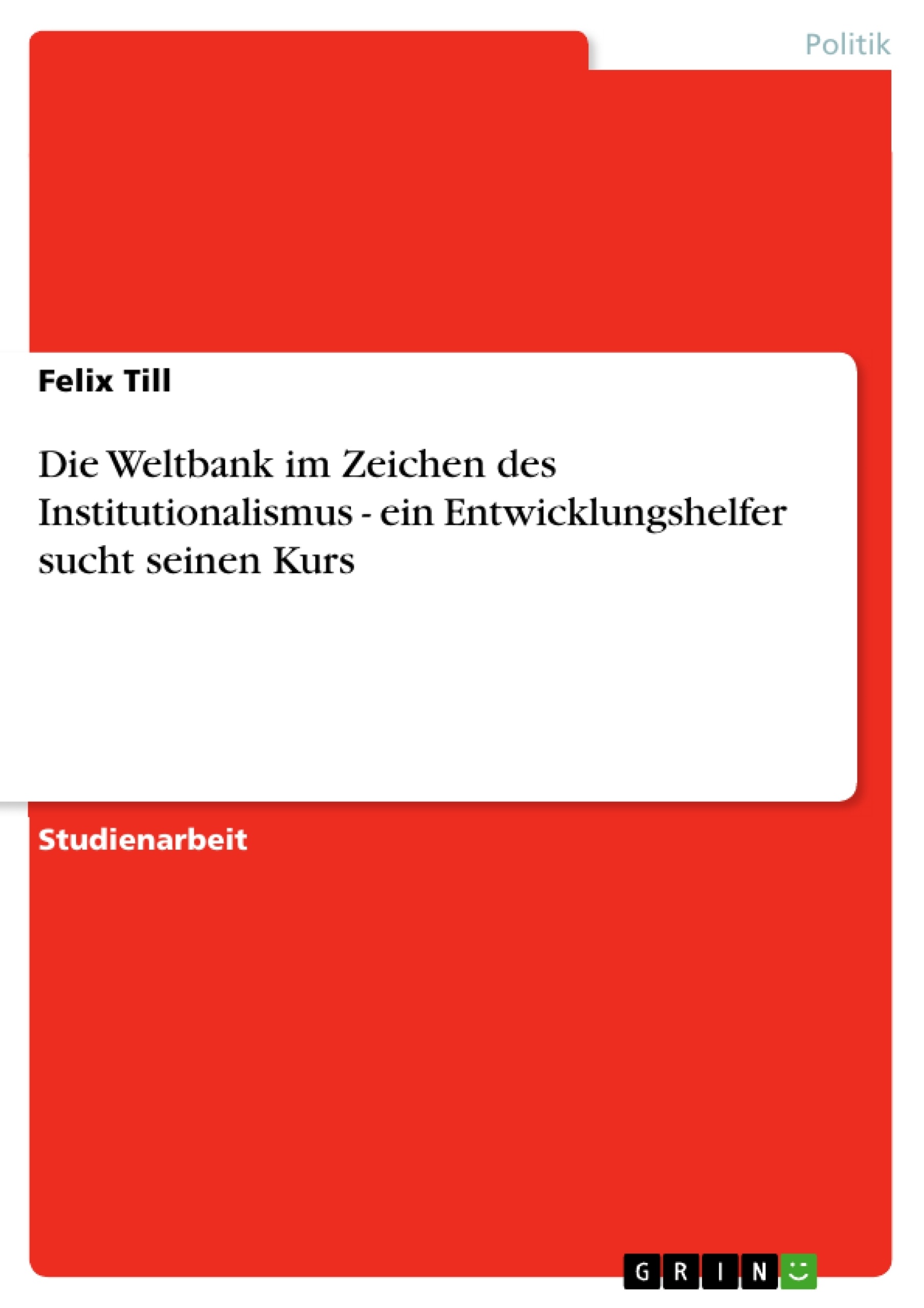Beschäftigt man sich mit dem politikwissenschaftlichen Teilbereich der internationalen Beziehungen, wird schnell deutlich, dass es sich um eine recht junge Disziplin der Forschung handelt. Auch wenn in mancher allgemeinen Fachliteratur die Anfänge der internationalen
Beziehungen in vorchristlichen Jahrhunderten gesucht werden (vgl. Patzelt 2003: S. 405), so kann man doch argumentieren, dass die wirkliche Relevanz der Thematik erst im Zuge des 20. Jahrhunderts aufkeimte. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um Beziehungen. Selbige bieten erst dann eine wissenschaftlich relevante Problematik, wenn sie überhaupt bestehen. Die globalen Ereignisse zweier bedauerlicher Weltkriege haben deutlich gezeigt, dass die
internationalen Beziehungen im letzten Jahrhundert eine völlig neue Tragweite erlangten.
Zweifellos sind zunehmende Globalisierungsprozesse und das enger werdende Netz der internationalen Staatenwelt hauptverantwortlich für die zunehmenden Interdependenzen im weltweiten Gefüge. Eine besondere Blütezeit erreichte die Disziplin der internationalen Beziehungen nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Dieser Wendepunkt der Geschichte mischte die Karten der handelnden Akteure völlig neu. Der zunehmende Bedeutungsverlust der westeuropäischen Staaten verlief parallel zur Herausbildung zweier Großmächte, den USA und der UDSSR (vgl. Mols/Lauth/Wagner 2006: S. 147). Das starke bipolare System beider Mächte, welches bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion am Ende des Jahres 1991 anhielt, war in der logischen Folge die Basis und Hauptbezugspunkt der Forschung im Rahmen der internationalen Beziehungen. Auch in diesem Teilbereich der Politikwissenschaft versuchte man verschiedene Phänomene und Verhaltensweisen auf supranationaler Ebene zu erklären und im besten Falle prognostizieren zu können. Dabei waren die Ansätze durchaus verschieden. Wie in anderen Disziplinen versuchten auch hier die verschiedenen Schulen das Zustandekommen des Status-quo, sowie die aktuellen Entwicklungen von ihrem Standpunkt zu erklären. Sicher kann es nicht Ziel der vorliegenden Arbeit sein, sich dezidiert all der Denkrichtungen der internationalen Beziehungen seit dem zweiten Weltkrieg zu widmen, zumal viele der Ansätze durch realpolitische Ereignisse, die sie nicht erklären konnten weitgehend obsolet geworden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie des Institutionalismus
- Institutionalismus
- Institutionen
- Weltbank
- Geschichte der Weltbank
- Struktur der Weltbank
- Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)
- Internationale Entwicklungsorganisation (IDA)
- Internationale Finanz-Corporation (IFC)
- Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA)
- Internationales Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID)
- Die Weltbank im Kontext des Institutionalismus
- Die Weltbank - eine Institution
- Der,,Selbsterhaltungstrieb“ von Institutionen
- Gründe für die Selbsterhaltung der Weltbank
- Die Perspektive der Weltbank
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Weltbank im Kontext des Institutionalismus und analysiert deren Anpassungsleistungen im Laufe der Zeit. Ziel ist es, die Standfestigkeit der Weltbank als Institution im Zuge von Veränderungen im Weltgefüge zu untersuchen und deren zukünftige Chancen und Gefahren zu bewerten.
- Die Theorie des Institutionalismus und ihre Relevanz für die Analyse internationaler Organisationen
- Die Geschichte und Struktur der Weltbank
- Die Rolle der Weltbank als Institution im internationalen System
- Der Selbsterhaltungstrieb von Institutionen und dessen Auswirkungen auf die Weltbank
- Die Anpassungsleistungen der Weltbank im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der internationalen Beziehungen und die Bedeutung von Institutionen in diesem Kontext ein. Sie stellt die Weltbank als Beispiel für eine global agierende Institution vor und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Theorie des Institutionalismus. Es werden verschiedene Ansätze und Definitionen des Institutionalismus vorgestellt und die Abgrenzung zu anderen Denkschulen wie dem Realismus und dem Liberalismus diskutiert.
Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte und Struktur der Weltbank. Es werden die verschiedenen Institutionen der Weltbankgruppe vorgestellt und deren Aufgaben und Ziele erläutert.
Das vierte Kapitel analysiert die Weltbank im Kontext des Institutionalismus. Es wird untersucht, inwiefern die Weltbank als Institution betrachtet werden kann und welche Faktoren zu ihrem Selbsterhaltungstrieb beitragen. Die Perspektive der Weltbank auf ihre eigene Rolle im internationalen System wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Institutionalismus, die Weltbank, internationale Beziehungen, Entwicklungshilfe, Institutionen, Selbsterhaltung, Anpassungsleistungen, Chancen und Gefahren.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des Institutionalismus?
Der Institutionalismus untersucht die Rolle von Institutionen in den internationalen Beziehungen und erklärt, wie diese durch Regeln und Normen das Verhalten von Staaten beeinflussen.
Aus welchen Teilorganisationen besteht die Weltbankgruppe?
Zur Weltbank gehören unter anderem die IBRD (Wiederaufbau), die IDA (Entwicklungshilfe für arme Länder), die IFC (Privatsektorförderung), die MIGA (Investitionsgarantien) und das ICSID (Schiedsgerichtsbarkeit).
Was versteht man unter dem "Selbsterhaltungstrieb" der Weltbank?
Damit ist die Fähigkeit der Institution gemeint, sich an veränderte globale Machtgefüge anzupassen, um ihre eigene Existenzberechtigung und Relevanz im internationalen System zu sichern.
Wie hat sich die Rolle der Weltbank nach dem Kalten Krieg verändert?
Nach dem Ende der Bipolarität (USA/UdSSR) musste die Weltbank ihre Strategien an die zunehmende Globalisierung und neue wirtschaftliche Herausforderungen anpassen.
Welche Gefahren bestehen für die Weltbank als Institution?
Gefahren liegen in mangelnder Effektivität der Entwicklungshilfe, Kritik an ihrer Struktur und dem Aufkommen konkurrierender regionaler Finanzinstitutionen.
- Citation du texte
- Felix Till (Auteur), 2009, Die Weltbank im Zeichen des Institutionalismus - ein Entwicklungshelfer sucht seinen Kurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127373