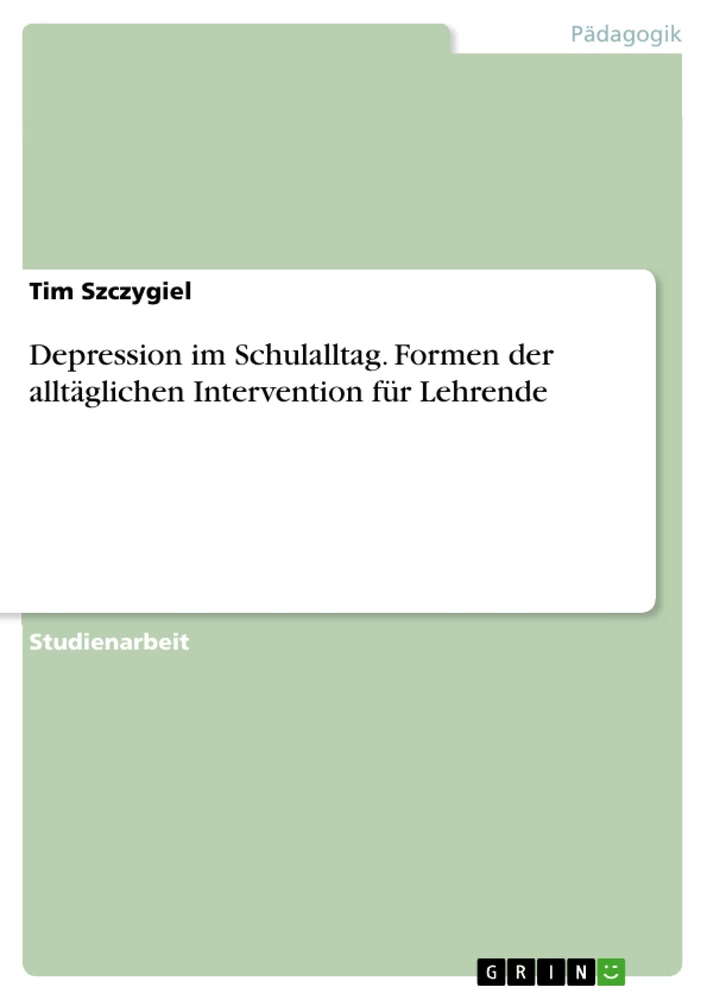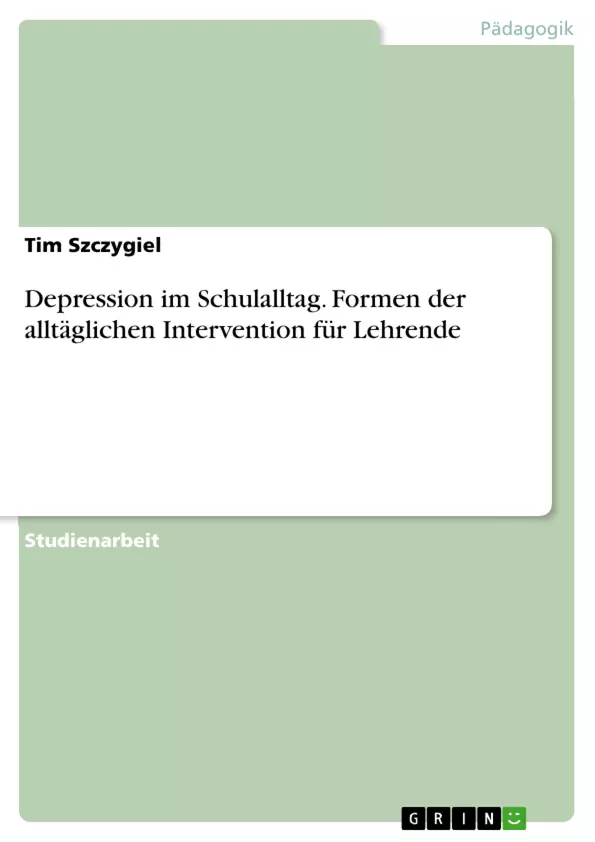In ihrem beruflichen Leben haben Lehrerinnen und Lehrer täglich Kontakt zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Vor allem die SchülerInnenschaft variiert zuweilen, bedingt durch die verschiedenen sozialen Hintergründe sowie die Altersheterogenität, stark. Über die Jahre sammeln Lehrpersonen somit viele einzigartige Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die sie befähigen, mit den diversen SchülerInnen-Typen pädagogisch umzugehen. Allerdings treten immer wieder Fälle von SchülerInnen auf, die in der unterrichtlichen Praxis durch besondere Auffälligkeiten in Erscheinung treten: sie haben Schwierigkeiten sich zu konzentrieren, sie wirken apathisch und desinteressiert, zeigen keine Freude oder Begeisterung. Zudem beklagen sie sich häufig über Bauchweh oder Kopfschmerzen oder bleiben dem Unterricht völlig fern. Auch ziehen sie sich womöglich aus dem sozialen Leben ihrer Schulklasse zurück. Weiterhin können sie Gereiztheit an den Tag legen, wenn man sich nach ihrem Empfinden erkundigt.
All diese Erscheinungen können auf eine geistig-emotionale Beeinträchtigung hinweisen. Eine relativ häufige, jedoch zumeist unerkannte psychische Störung bei Kindern und Jugendlichen ist die Depressive Störung (F32.x (ICD-10)) beziehungsweise die Major Depression (296.xx (DSM-V)). Die geschilderten Auffälligkeiten passen hierbei zu dieser, meist als „Erwachsenenstörung“ bekannten, psychischen Erkrankung. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass auch Kinder und Jugendliche unter depressiven Episoden leiden, weshalb die Psychoedukation für LehrerInnen in Bezug auf dieses Störungsbild erweitert werden sollte.
Die vorliegende Arbeit bietet hierfür zunächst einen Überblick über die schülerspezifische Symptomatik des Störungsbildes, zudem sollen kurz die Epidemiologie sowie die Ätiologie der Erkrankung geschildert werden. Anschließend wird der Frage nachgegangen, welche Interventionsmaßnahmen sich für LehrerInnen ergeben, wie diese im schulischen Alltag umsetzbar sind und welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung auftreten können. Ziel dieser Projektarbeit war die Erstellung eines Handlungsleitfadens für den Umgang mit depressiven Kindern und Jugendlichen im Schulalltag. Die wesentlichen Inhalte des Leitfadens sollten präventive Maßnahmen und Verhaltensweisen sowie Interventionsformen umfassen, die sich im täglichen Unterricht einsetzen lassen und den Betroffenen bei der Überwindung der depressiven Episode behilflich sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Depressive Störung bei Kindern und Jugendlichen
- Symptomatik
- Epidemiologie
- Ätiologie
- Depression im Kontext Schule
- Interventionsformen im Kontext Schule
- Allgemeine Aspekte der pädagogischen Intervention
- Sicherheit
- Geduld
- Somatische Beschwerden
- Kontakt
- Elternkontakt
- Spezifische Ansätze zum Umgang mit Betroffenen
- Aktivierung
- Soziale Integration
- Denkmuster hinterfragen
- Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Depression bei Kindern und Jugendlichen im Kontext Schule und zielt darauf ab, Lehrerinnen ein besseres Verständnis für die Symptomatik, Epidemiologie und Ätiologie dieser Erkrankung zu vermitteln. Außerdem werden Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt, die im Schulalltag eingesetzt werden können, um betroffenen Schülern zu helfen.
- Symptome und Erscheinungsformen der depressiven Störung bei Kindern und Jugendlichen
- Epidemiologie und Prävalenz der depressiven Störung im Kindes- und Jugendalter
- Mögliche Ursachen und Risikofaktoren für die Entwicklung einer Depression bei Kindern und Jugendlichen
- Interventionen im schulischen Kontext: Pädagogische Ansätze und praktische Umsetzung
- Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Interventionsmaßnahmen im Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext, die oftmals unerkannt bleiben. Dabei werden typische Verhaltensauffälligkeiten beschrieben, die auf eine Depression hindeuten können.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der depressiven Störung bei Kindern und Jugendlichen und geht auf die Symptomatik, die Epidemiologie und die Ätiologie der Erkrankung ein. Es wird deutlich, dass depressive Symptome im Kindes- und Jugendalter häufig anders ausgeprägt sind als bei Erwachsenen und daher oft missverstanden werden.
Kapitel 3 widmet sich dem Thema "Depression im Kontext Schule" und erläutert verschiedene Interventionsformen, die Lehrerinnen im Schulalltag anwenden können. Dabei werden allgemeine Aspekte der pädagogischen Intervention, wie Sicherheit, Geduld und Kontakt zum Kind, sowie spezifische Ansätze, wie Aktivierung, soziale Integration und das Hinterfragen von Denkmustern, behandelt.
Schlüsselwörter
Depressive Störung, Kinder und Jugendliche, Schule, Intervention, Pädagogik, Symptomatik, Epidemiologie, Ätiologie, Aktivierung, Soziale Integration, Denkmuster, Umgang mit Betroffenen.
Häufig gestellte Fragen
Wie äußert sich eine Depression bei Schülern im Alltag?
Symptome können Konzentrationsschwierigkeiten, Apathie, sozialer Rückzug, Gereiztheit sowie körperliche Beschwerden wie Bauch- oder Kopfschmerzen sein.
Was können Lehrer tun, wenn sie eine Depression vermuten?
Lehrer sollten das Gespräch mit dem Schüler suchen, Geduld zeigen, Sicherheit vermitteln und bei Bedarf den Kontakt zu den Eltern und Schulpsychologen herstellen.
Warum wird Depression bei Kindern oft als "Erwachsenenstörung" missverstanden?
Lange Zeit glaubte man, Kinder könnten keine Depressionen haben. Zudem äußern sich die Symptome bei Jüngeren oft eher durch Aggression oder körperliche Leiden statt durch klassische Traurigkeit.
Welche Rolle spielt die soziale Integration im Klassenzimmer?
Eine gute soziale Integration kann helfen, den Rückzug des betroffenen Schülers zu verhindern und ihm ein stützendes Umfeld zur Bewältigung der Episode zu bieten.
Was ist Psychoedukation für Lehrkräfte?
Es handelt sich um die Vermittlung von fundiertem Wissen über psychische Krankheiten, um Lehrkräfte zu befähigen, Anzeichen frühzeitig zu erkennen und pädagogisch richtig zu reagieren.
- Arbeit zitieren
- Tim Szczygiel (Autor:in), 2018, Depression im Schulalltag. Formen der alltäglichen Intervention für Lehrende, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1274458