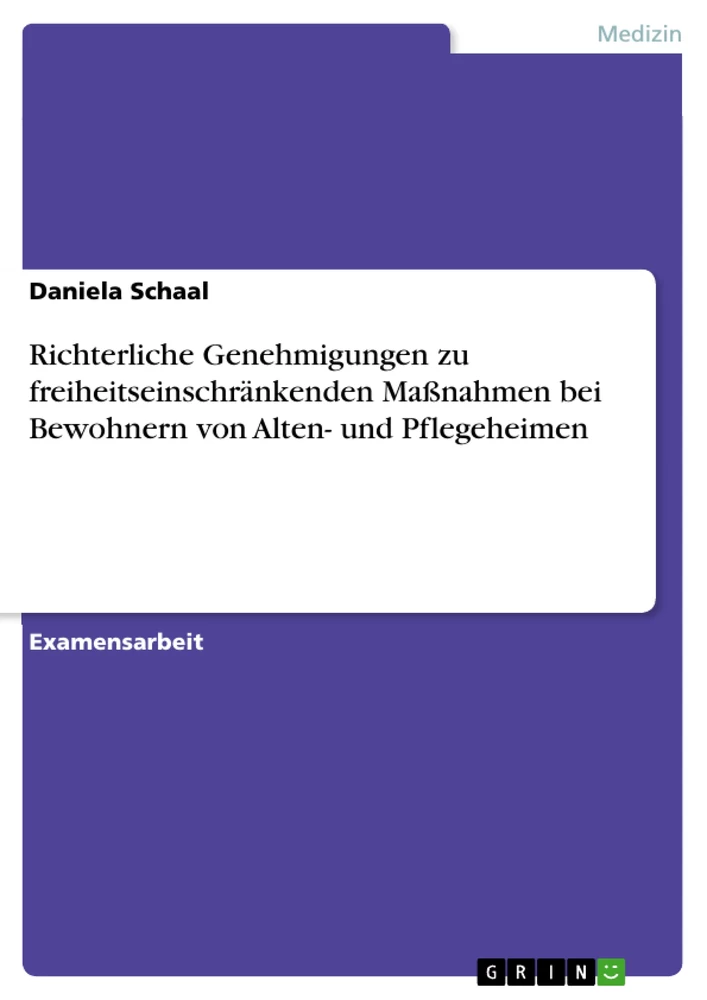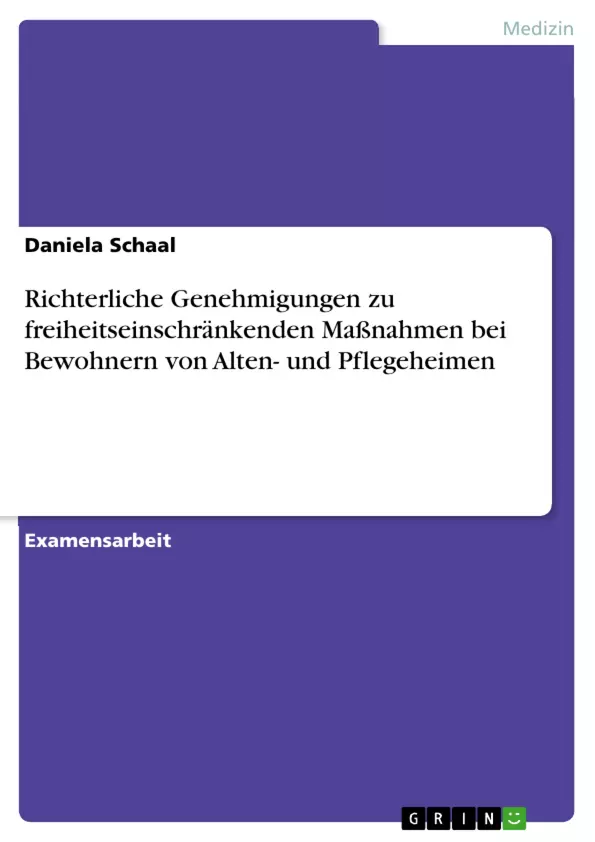In den einschlägigen Pflegefachzeitschriften konnte in den letzten Jahren zunehmend die Diskussion über die Anwendung von freiheitseinschränkenden Maßnahmen in Alten- und Pflegeheimen verfolgt werden. Ebenso wurde in den Medien diese Thematik aufgegriffen und über die Schicksale alter, pflegebedürftiger Menschen, die an das Bett gefesselt oder anhand von ruhig stellenden Medikamenten in ihrer Bewegung eingeschränkt wurden [vgl. 20], informiert. Zugleich erschien im Jahr 2005 ein aufrüttelndes Buch „Abgezockt und tot gepflegt“ [6] von dem Journalisten Markus Breitscheidel, das über die Missstände in deutschen Alten- und Pflegeheimen berichtete. Aufgrund der Brisanz dieses Themas wurde an der Universität Hamburg in der Fachrichtung Gesundheitswissenschaften ein Seminar angeboten, welches sich mit der Problematik bei der Anwendung von freiheitseinschränkenden Maßnahmen auseinandergesetzt hat. Aufgrund der aktuellen Diskussion über freiheitseinschränkende Maßnahmen wird dieses Thema als Schwerpunkt in der vorliegenden Examensarbeit gewählt. Oberstes Gebot für das medizinische Personal ist die Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen. Das Selbstbestimmungsrecht untersagt, bis auf einige wenige gesetzlich geregelte Ausnahmefälle, jede Behandlung gegen den Willen des Bewohners. An dieser Stelle wird der Gegensatz zwischen Gesetz und Pflegealltag sichtbar. Im pflegerischen Alltag kann es bei Verhaltensauffälligkeiten der Bewohner aufgrund psychischer Erkrankungen zu verbalen oder körperlichen Übergriffen auf sich selbst oder Dritte kommen. Aufgrund dessen kann es dazu kommen, dass in letzter Konsequenz freiheitseinschränkende Maßnahmen angewandt werden müssen.
Noch immer werden freiheitseinschränkende Maßnahmen mit der Sturzprävention begründet. In Alten- und Pflegeeinrichtungen kommt es immer wieder zu Stürzen von Bewohnern und stellt damit im deutschen Pflegealltag Haftungsthema Nummer eins dar. Dabei muss die Frage geklärt werden, ob ein Verschulden seitens des Heimträgers vorliegt oder aber ob der Sturz dem allgemeinen Lebensrisiko zuzuordnen ist. Diese Vorfälle sollten genau geklärt und analysiert werden. Bei Auftreten eines Sturzes fühlen sich die Pflegekräfte in ihrem Handeln verunsichert. Im Jahr 2005 wurden vom Bundesverfassungsgericht zwei maßgebliche Urteile zum Sturz erlassen.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Hintergrund
- 1.1 Begrifflichkeiten und rechtliche Aspekte
- 1.1.1 Rechtfertigungsgründe
- 1.1.2 Ärztliche Anordnung
- 1.1.3 Richterliche Genehmigungen
- 1.1.4 Unterbringungen
- 1.1.5 Psychischkrankengesetz
- 1.1 Begrifflichkeiten und rechtliche Aspekte
- 2. Fragestellung und Hypothese
- 2.1 Forschungsfrage
- 2.2 Hypothese
- 3. Methode
- 3.1 Forschungsstand
- 3.1.1 Prävalenz
- 3.1.2 Gründe und Einstellungen der Pflegenden für den Einsatz von FeM
- 3.1.3 Ethisches Dilemma
- 3.1.4 Maßnahmen zur Vermeidung von FeM
- 3.2 Interviewstudie
- 3.2.1 Entwicklung eines Interviewleitfadens
- 3.2.2 Durchführung der Pretests
- 3.2.3 Stichprobe und Rekrutierung für die Interviews
- 3.2.4 Durchführung der Interviews
- 3.2.5 Datenauswertung
- 3.3 Fragebogenstudie
- 3.3.1 Entwicklung und Kontrolle des Fragebogens
- 3.3.2 Stichprobe und Rekrutierung
- 3.3.3 Durchführung der Erhebung
- 3.3.4 Erfahrungen während der Erhebung
- 3.1 Forschungsstand
- 4. Ergebnisse der Datenerhebung
- 4.1 Demographische Daten
- 4.2 Auswertung der Fragen
- 4.3 Diskussion und Zusammenfassung
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
- 7. Anhang
- 7.1 Interviewleitfaden
- 7.2 Einverständniserklärung zur Befragung über richterliche Genehmigungen zu FeM in Altenpflegeheimen
- 7.3 Fragebogen zu FeM in der Altenpflege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der richterlichen Genehmigungen zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FeM) bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Praxis der Anwendung von FeM in der Altenpflege zu untersuchen. Dabei werden die rechtlichen Grundlagen, die Prävalenz von FeM, die Gründe und Einstellungen der Pflegenden sowie ethische Aspekte beleuchtet.
- Rechtliche Rahmenbedingungen von FeM in der Altenpflege
- Prävalenz von FeM in Alten- und Pflegeheimen
- Gründe und Einstellungen der Pflegenden zum Einsatz von FeM
- Ethische Aspekte der Anwendung von FeM
- Maßnahmen zur Vermeidung von FeM
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der richterlichen Genehmigungen zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FeM) in Alten- und Pflegeheimen ein. Sie erläutert die Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das erste Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen von FeM, wobei die Begrifflichkeiten und rechtlichen Aspekte im Fokus stehen. Es werden die verschiedenen Rechtfertigungsgründe, die ärztliche Anordnung, die richterliche Genehmigung sowie die Unterbringungsmöglichkeiten und das Psychischkrankengesetz erläutert. Das zweite Kapitel formuliert die Forschungsfrage und die Hypothese der Arbeit. Die Forschungsfrage zielt darauf ab, die Praxis der Anwendung von FeM in der Altenpflege zu untersuchen. Die Hypothese geht davon aus, dass die Anwendung von FeM in der Altenpflege häufig vorkommt und von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Das dritte Kapitel beschreibt die Methode der Arbeit. Es werden die Forschungsliteratur, die Interviewstudie und die Fragebogenstudie vorgestellt. Die Forschungsliteratur beleuchtet die Prävalenz von FeM, die Gründe und Einstellungen der Pflegenden sowie ethische Aspekte. Die Interviewstudie dient dazu, die Erfahrungen und Perspektiven von Pflegekräften zu FeM zu erforschen. Die Fragebogenstudie soll die Häufigkeit und die Gründe für den Einsatz von FeM in Alten- und Pflegeheimen untersuchen. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Datenerhebung. Es werden die demographischen Daten der teilnehmenden Einrichtungen und die Auswertung der Fragen aus der Interviewstudie und der Fragebogenstudie dargestellt. Das fünfte Kapitel diskutiert die Ergebnisse und fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen. Es werden die Implikationen der Ergebnisse für die Praxis der Altenpflege und für die zukünftige Forschung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FeM), die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Prävalenz von FeM in der Altenpflege, die Gründe und Einstellungen der Pflegenden, das ethische Dilemma, die Vermeidung von FeM, die Interviewstudie, die Fragebogenstudie, die Ergebnisse der Datenerhebung und die Implikationen für die Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Wann sind freiheitseinschränkende Maßnahmen (FeM) zulässig?
Nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zur Abwehr von Eigen- oder Fremdgefährdung und meist nur mit richterlicher Genehmigung.
Wer muss eine FeM anordnen?
In der Regel ist eine ärztliche Anordnung sowie eine Genehmigung durch ein Betreuungsgericht erforderlich.
Ist Sturzprävention ein legitimer Grund für Fixierungen?
Dies ist umstritten; oft wird das allgemeine Lebensrisiko gegen das Selbstbestimmungsrecht abgewogen, wie Urteile des Bundesverfassungsgerichts zeigen.
Was sind Alternativen zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen?
Dazu gehören Sensormatten, Niedrigflurbetten, Hüftprotektoren und eine verstärkte personelle Zuwendung.
Welches ethische Dilemma ergibt sich in der Pflege?
Der Konflikt zwischen der Fürsorgepflicht (Schutz vor Sturz) und dem Recht des Bewohners auf Freiheit und Selbstbestimmung.
- Arbeit zitieren
- Daniela Schaal (Autor:in), 2008, Richterliche Genehmigungen zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128120