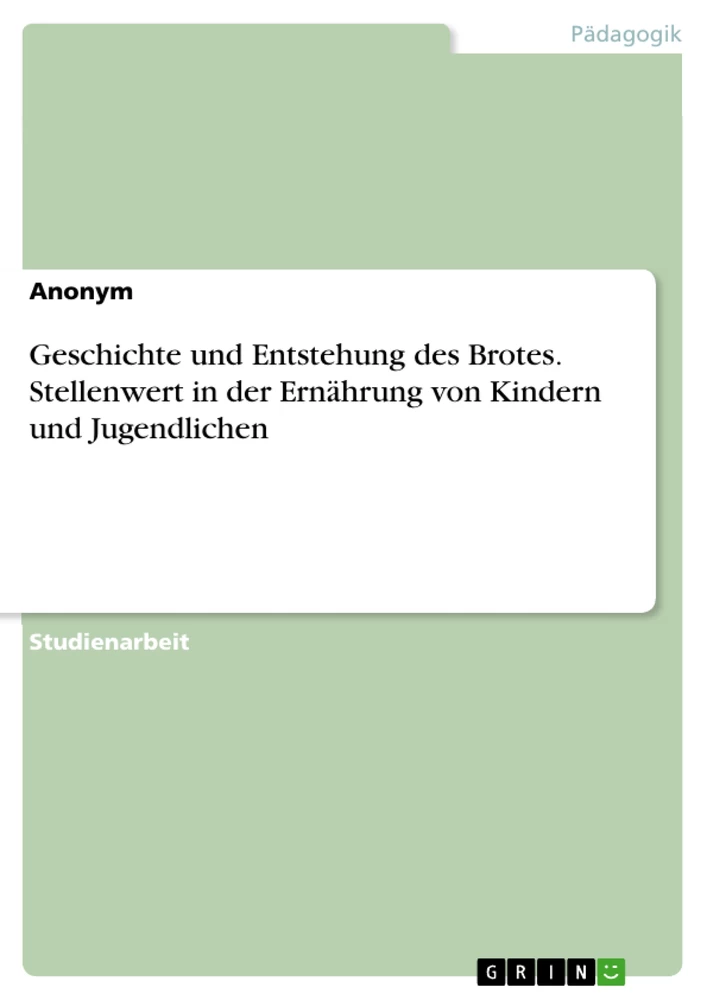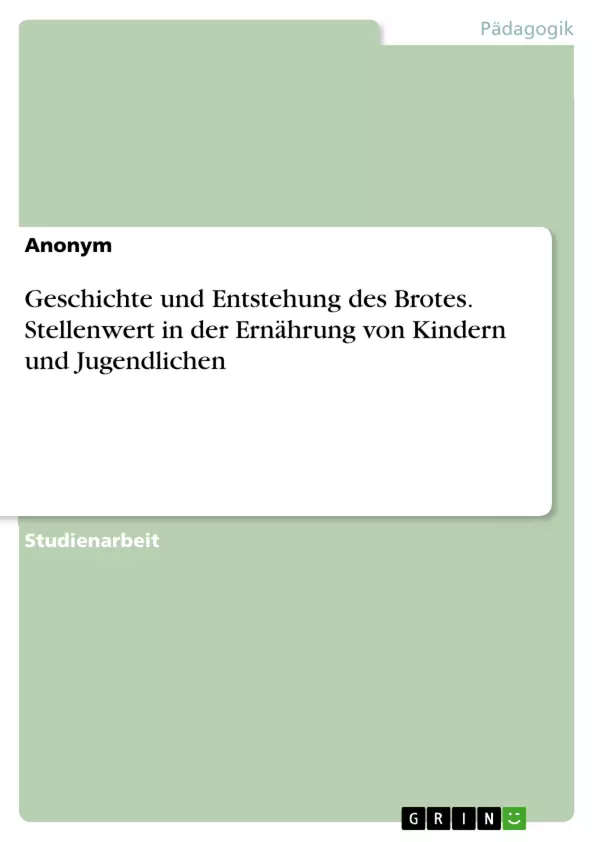In dieser wissenschaftlichen Arbeit geht es sowohl um die Geschichte und Entstehung des Brotes, als auch primär um den Stellenwert in der Ernährung und der Lebenswelt von Kindern. Im zweiten Kapitel wird zunächst auf Getreide eingegangen. Dabei wird der Aufbau eines Getreidekorns beschrieben. Anschließend geht es um die drei wichtigsten Getreidesorten für Brot: Weizen, Roggen und Gerste.
Im dritten Kapitel wird der Prozess "vom Korn zum Brot", mit all seinen Etappen, thematisiert. Das nächste Kapitel handelt von dem Stellenwert des Brotes in der Ernährung von Kinder und Jugendlichen. In Zuge dessen werden die Ergebnisse der EsKiMo- Studie dargestellt, welche das Essverhalten der Kinder analysiert. Im Anschluss daran wird eine Ernährungsempfehlung nach der OMK für Kinder und Jugendliche herauskristallisiert und dargelegt.
Dann geht es um die Umsetzungsmöglichkeiten im Sachunterricht und die Bildungswirksamkeit des Themas. Zum Schluss wird eine Unterrichtseinheit für den Sachunterricht dargestellt. Es geht um ein Rezept, welches einer der vielen praktischen Umsetzungsmöglichkeiten für das Thema "vom Korn zum Brot" ist. Der Fokus liegt dabei auf der Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Daraufhin folgt ein persönliches Fazit mit einer kleinen Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Rückblick
- Getreide
- Aufbau eines Getreidekorns
- Weizen (Triticum L.)
- Roggen (Secale cereale)
- Gerste (Hordeum vulgare)
- Der Prozess „vom Korn zum Mehl“
- Der Anbau
- Die Reinigung
- Das Mahlen
- Die Relevanz von Brot in der Ernährung von Kindern
- Lebensmittelverzehr und Essverhalten von Kinder- und Jugendlichen in Deutschland mit dem Schwerpunkt Brot/Getreide
- Ernährungsempfehlung
- Umsetzung im Sachunterricht
- Ernährungsbildung
- Bildungswirksamkeit des Themas
- Vollkornbrot selbst backen
- Rezept: „Schnelles Vollkornbrot backen!“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit beleuchtet die Geschichte und Entstehung von Brot, wobei der Schwerpunkt auf dem Stellenwert von Brot in der Ernährung und Lebenswelt von Kindern liegt. Neben der Erläuterung des Aufbaus eines Getreidekorns und der drei wichtigsten Getreidesorten für Brot (Weizen, Roggen, Gerste) wird der Prozess „vom Korn zum Brot“ in seinen einzelnen Schritten dargestellt. Die Arbeit analysiert den Stellenwert von Brot in der Ernährung von Kindern und Jugendlichen, wobei die Ergebnisse der EsKiMo-Studie zur Analyse des Essverhaltens von Kindern herangezogen werden. Des Weiteren wird eine Ernährungsempfehlung nach der OMK für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Abschließend werden Möglichkeiten zur Umsetzung im Sachunterricht und die Bildungswirksamkeit des Themas beleuchtet, inklusive eines Rezepts für selbstgebackenes Vollkornbrot.
- Die Geschichte und Entstehung von Brot
- Der Stellenwert von Brot in der Ernährung von Kindern
- Der Prozess der Brotherstellung „vom Korn zum Brot“
- Ernährungsempfehlungen für Kinder und Jugendliche
- Die Umsetzung des Themas „vom Korn zum Brot“ im Sachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Vom Korn zum Brot“ ein und betont die Bedeutung von Brot als Lebensmittel und die Veränderungen in der Ernährungslandschaft. Kapitel 2 widmet sich dem Getreide, erläutert den Aufbau eines Getreidekorns und stellt die wichtigsten Getreidesorten für Brot (Weizen, Roggen und Gerste) vor. Kapitel 3 beschreibt den Prozess „vom Korn zum Mehl“, einschließlich Anbau, Reinigung und Mahlen des Getreides. Kapitel 4 befasst sich mit der Relevanz von Brot in der Ernährung von Kindern und Jugendlichen und analysiert die Ergebnisse der EsKiMo-Studie zum Essverhalten von Kindern. Kapitel 5 zeigt Möglichkeiten zur Umsetzung im Sachunterricht und beleuchtet die Bildungswirksamkeit des Themas, inklusive eines Rezepts für selbstgebackenes Vollkornbrot.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Brot, Getreide, Ernährung, Kinder, Jugendliche, Sachunterricht, Bildungswirksamkeit, Ernährungsbildung, Vollkornbrot, Rezept, EsKiMo-Studie, OMK-Empfehlung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Getreidesorten sind am wichtigsten für die Brotherstellung?
Die drei zentralen Getreidesorten für Brot sind Weizen, Roggen und Gerste, die jeweils unterschiedliche Backeigenschaften besitzen.
Wie sieht der Prozess "vom Korn zum Brot" aus?
Der Weg umfasst mehrere Etappen: den Anbau, die Reinigung des Getreides, das Mahlen zu Mehl und schließlich den Backvorgang.
Welchen Stellenwert hat Brot in der Ernährung von Kindern?
Brot ist ein Grundnahrungsmittel und wichtiger Energielieferant. Die EsKiMo-Studie zeigt jedoch, dass das Essverhalten von Kindern oft von den Ernährungsempfehlungen abweicht.
Warum ist Vollkornbrot besonders gesund?
Vollkornbrot enthält alle Bestandteile des Getreidekorns (Schale, Keimling, Mehlkörper) und liefert dadurch mehr Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe.
Wie kann das Thema Brot im Sachunterricht behandelt werden?
Durch praktische Projekte wie das eigene Backen von Vollkornbrot können Schüler eigenständig den Prozess der Lebensmittelherstellung und Grundlagen der Ernährungsbildung lernen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Geschichte und Entstehung des Brotes. Stellenwert in der Ernährung von Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283020