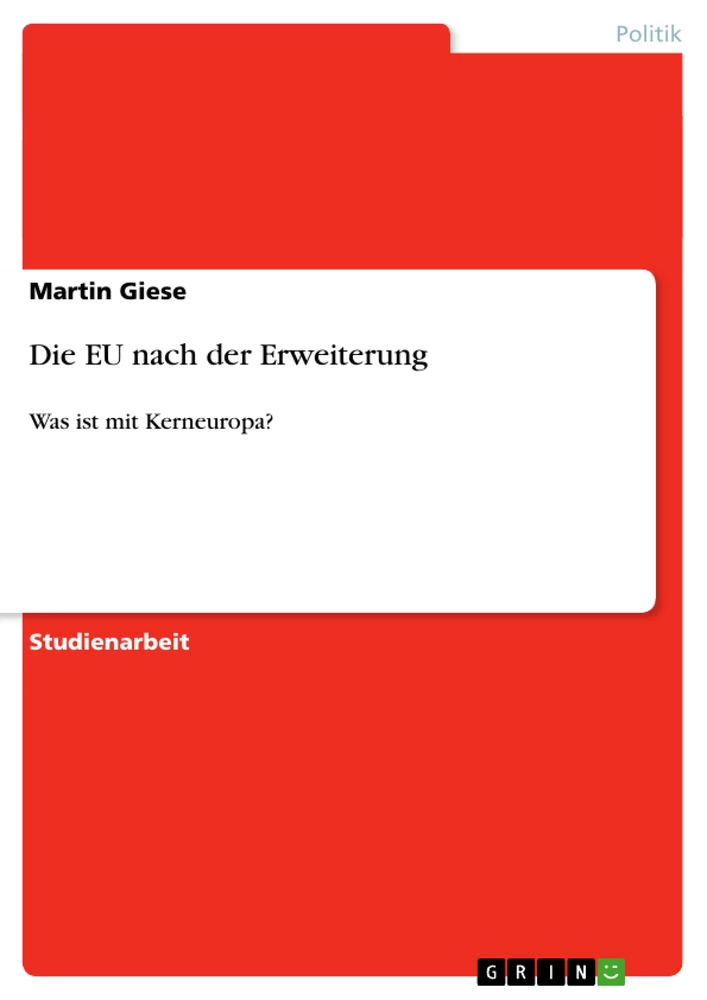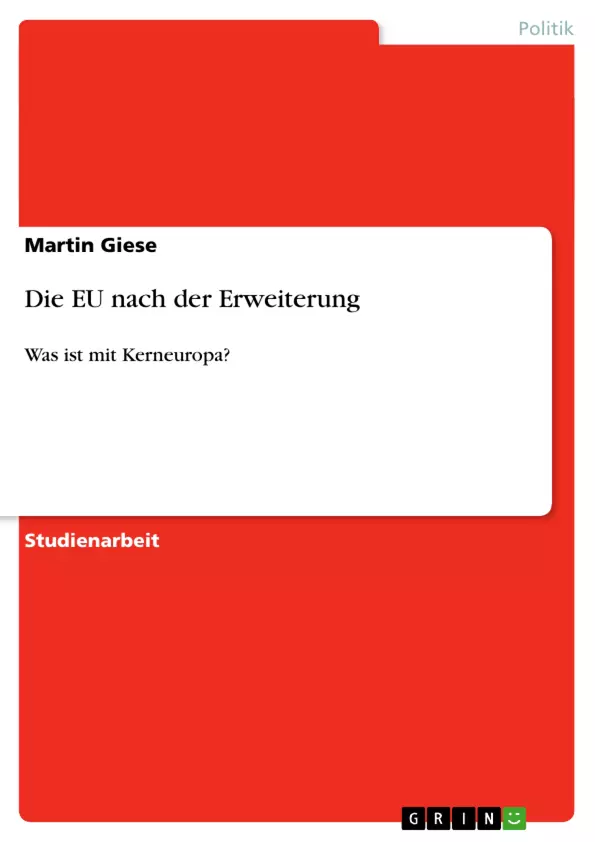Mit der Aufnahme von Rumänien und Bulgarien im Januar 2007 ist die nun schon sechste Erweiterung der Europäischen Union (EU) abgeschlossen. Nach den Erweiterungen nach Norden (Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich 1973), nach Süden (Griechenland 1981 und Spanien und Portugal 1986), sowie der Aufnahme Österreichs, Schwedens und Finnlands 1995 ist die EU durch die Aufnahme Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, Tschechiens, Sloweniens, der Slowakei und Ungarns sowie Maltas und Zyperns 2004 und zuletzt Rumäniens und Bulgariens auf nunmehr 27 Mitglieder angewachsen. Doch damit scheint die Erweiterung der EU noch kein Ende gefunden zu haben. Mit Kroatien laufen seit März 2005 Beitrittsverhandlungen, mit einem Beitritt wird 2009 oder 2010 gerechnet. Begleitet von heftigen öffentlichen Diskussionen laufen seit Oktober 2005 Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
Zahlreiche weitere Staaten haben ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bereits angemeldet. Hier seien vor allem die aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen Staaten wie etwa Mazedonien und Albanien erwähnt. Zudem gibt es Überlegungen, die auf eine Mitgliedschaft der Maghreb-Staaten Tunesien und Marokko hinzielen, auch die Ukraine und Weißrussland könnten langfristig gesehen Mitglieder der EU werden. Zahlreiche weitere Staaten haben ein Interesse an einer EU-Mitgliedschaft bekundet.
Wie soll nun aber eine solchermaßen vergrößerte EU handlungsfähig bleiben? Wie soll die Integration mit so vielen Mitgliedern geschehen? Die Ratifizierung des unter anderem als Antwort darauf gedachte EU-Verfassungsvertrags ist nach den negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden 2005 wenn nicht gescheitert, so doch zumindest ins Stocken geraten.
Vor diesem Hintergrund sollen in dieser Arbeit einige Szenarien, wie die EU in der Zukunft aussehen könnte, vorgestellt werden. Besonderes Augenmerk soll dabei auf dem Konzept des „Kerneuropa“ und verwandten Modellen liegen.
Dazu wird zunächst auf das jüngste Kapitel der EU-Erweiterung eingegangen. Weiterhin wird der bisherige institutionelle Reformprozess beschrieben, wobei hier der Fokus auf den Reformen des Ministerrates, der Kommission und des Europäischen Parlamentes, sowie den Möglichkeiten der verstärkten Zusammenarbeit liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die EU-Osterweiterung
- Reformprozess
- Der Vertrag von Amsterdam
- Der Vertrag von Nizza
- Kerneuropa?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Erweiterung der Europäischen Union (EU) und die damit verbundenen Herausforderungen für die Integration und Handlungsfähigkeit der EU. Im Fokus steht das Konzept des „Kerneuropa“ und verwandte Modelle, die als mögliche Lösungen für die Herausforderungen der EU-Erweiterung diskutiert werden.
- Die EU-Osterweiterung und ihre Auswirkungen auf die EU
- Der institutionelle Reformprozess der EU
- Das Konzept des „Kerneuropa“ und seine Relevanz für die Zukunft der EU
- Mögliche Szenarien für die zukünftige Entwicklung der EU
- Die Herausforderungen der Integration und Handlungsfähigkeit der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation der EU-Erweiterung dar und skizziert die Problematik der Integration und Handlungsfähigkeit der EU im Kontext der Erweiterung. Das zweite Kapitel befasst sich mit der EU-Osterweiterung, die im Januar 2007 mit der Aufnahme von Rumänien und Bulgarien abgeschlossen wurde. Es werden die wichtigsten Meilensteine des Erweiterungsprozesses, die Kriterien für den Beitritt und die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Erweiterung auf die EU beleuchtet. Das dritte Kapitel behandelt den institutionellen Reformprozess der EU, der als Reaktion auf die Erweiterung und die damit verbundenen Herausforderungen initiiert wurde. Es werden die wichtigsten Reformen des Ministerrates, der Kommission und des Europäischen Parlamentes sowie die Möglichkeiten der verstärkten Zusammenarbeit vorgestellt. Das vierte Kapitel widmet sich dem Konzept des „Kerneuropa“ und verwandten Modellen, die als mögliche Lösungen für die Herausforderungen der EU-Erweiterung diskutiert werden. Es werden die verschiedenen Konzepte des „Kerneuropa“ vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile analysiert. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob und wie ein „Kerneuropa“ die Handlungsfähigkeit der EU in Zukunft gewährleisten kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die EU-Erweiterung, die Integration und Handlungsfähigkeit der EU, das Konzept des „Kerneuropa“, die institutionellen Reformen der EU, die Herausforderungen der EU-Erweiterung und die Zukunft der EU.
Häufig gestellte Fragen
Welche Staaten traten der EU bei der sechsten Erweiterungsrunde bei?
Nach der großen Erweiterung 2004 traten im Januar 2007 Rumänien und Bulgarien als 26. und 27. Mitglied der Europäischen Union bei.
Was versteht man unter dem Konzept eines „Kerneuropas“?
Es beschreibt ein Modell, bei dem eine Gruppe von Mitgliedstaaten die Integration in bestimmten Politikfeldern schneller vorantreibt als der Rest der EU.
Warum geriet der EU-Verfassungsvertrag ins Stocken?
Der Ratifizierungsprozess wurde durch negative Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Jahr 2005 massiv behindert.
Welche institutionellen Reformen waren für die Erweiterung nötig?
Reformen betrafen vor allem die Zusammensetzung der Kommission, die Stimmverteilung im Ministerrat und die Sitzverteilung im Europäischen Parlament (Verträge von Amsterdam und Nizza).
Welche Länder gelten als potenzielle zukünftige Beitrittskandidaten?
Der Text nennt Kroatien, die Türkei sowie Staaten des ehemaligen Jugoslawien (Mazedonien, Albanien) und langfristig die Ukraine oder Weißrussland.
- Citar trabajo
- Martin Giese (Autor), 2007, Die EU nach der Erweiterung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128687