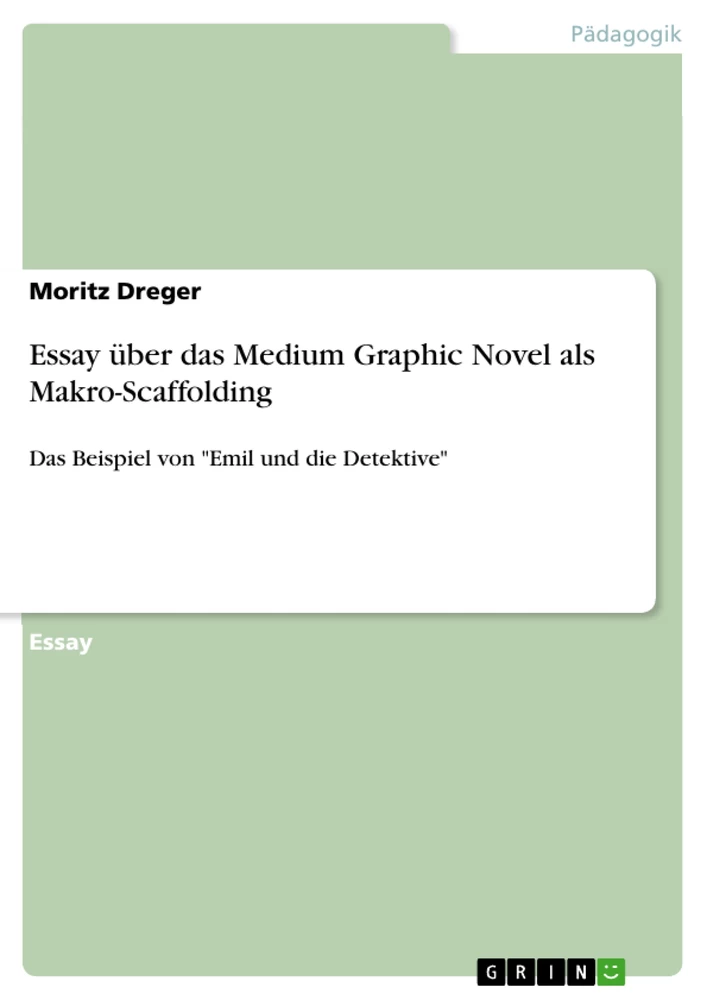In diesem Essay wird auf Grundlage des Makro-Scaffoldings ein Differenzierungskonzept zu Kästners Werk "Emil und die Detektive" entwickelt, wobei die Förderung durch das Makro-Scaffolding mit einem Medienwechsel im Kontext des intermedialen Literaturunterrichts nach Kruse (2014) verknüpft wird.
Folgende Fragestellung wird dabei untersucht: Wie kann ein mediales Makro-Scaffolding innerhalb einer Unterrichtsstunde eingesetzt werden und inwieweit werden die SchülerInnen durch einen Medienwechsel im Sinne eines Lerngerüsts gefördert?
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Problemstellung
- Möglichkeiten des Makro-Scaffoldings
- Was ist (Makro-)Scaffolding?
- Integration des Makro-Scaffoldings in den intermedialen Literaturunterricht
- Förderung durch Makro-Scaffolding
- Kontext
- Differenzierungskonzept zu Emil und die Detektive
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Anwendung eines medialen Makro-Scaffoldings im Kontext des Kinderbuchs "Emil und die Detektive" von Erich Kästner. Dabei wird zunächst der Begriff des Scaffoldings erläutert und das Potenzial des Makro-Scaffoldings im Literaturunterricht untersucht. Auf dieser Grundlage wird anschließend ein Differenzierungskonzept für "Emil und die Detektive" entwickelt, das die Förderung durch Makro-Scaffolding mit einem Medienwechsel im Rahmen des intermedialen Literaturunterrichts nach Kruse (2014) verbindet. Der Essay endet mit einem Fazit und einem Ausblick.
- Definition und Möglichkeiten des Makro-Scaffoldings
- Integration des Makro-Scaffoldings in den intermedialen Literaturunterricht
- Differenzierungskonzept für "Emil und die Detektive" im Kontext des Makro-Scaffoldings
- Förderung von Lernprozessen durch einen medialen Wechsel
- Zusammenhang zwischen Makro-Scaffolding und intermedialem Literaturunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung
Die Einleitung stellt die Problemstellung des Essays vor: Wie kann ein mediales Makro-Scaffolding in einer Unterrichtsstunde eingesetzt werden und inwieweit werden Schüler durch einen Medienwechsel im Sinne eines Lerngerüsts gefördert? Außerdem wird die Relevanz eines Medienwechsels im Literaturunterricht, insbesondere für Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, herausgestellt.
Möglichkeiten des Makro-Scaffoldings
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Scaffolding" und unterscheidet zwischen Mikro- und Makro-Scaffolding. Das Makro-Scaffolding umfasst alle Bereiche, die außerhalb der Unterrichtsstunde stattfinden, wie die Unterrichtsplanung, die Lernstandserfassung und die Bedarfsanalyse. Der Fokus liegt dabei auf der Integration des Makro-Scaffoldings in den intermedialen Literaturunterricht.
Förderung durch Makro-Scaffolding
Das Kapitel erläutert die Entwicklung eines Differenzierungskonzeptes für "Emil und die Detektive" im Kontext des Makro-Scaffoldings. Dabei wird ein situativer Kontext, eine fünfte Klasse eines Gymnasiums, vorgestellt und die Heterogenität der Schüler hinsichtlich ihrer Leistungsstärke und ihres privaten Lesekonsums betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Essays sind: Makro-Scaffolding, intermedialer Literaturunterricht, Medienwechsel, Differenzierungskonzept, "Emil und die Detektive", Erich Kästner, Lerngerüst, Schülerförderung, heterogene Lerngruppen, Medienkompetenz, Lernstandserfassung, Bedarfsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Makro-Scaffolding im Unterricht?
Es umfasst die langfristige Planung von Lernhilfen (Lerngerüsten), wie Bedarfsanalysen und Unterrichtsgestaltung, um Schüler bei komplexen Aufgaben zu unterstützen.
Wie hilft ein Medienwechsel beim Literaturverständnis?
Der Wechsel (z.B. vom Buch zur Graphic Novel) ermöglicht Schülern mit unterschiedlichen Lesevoraussetzungen einen leichteren Zugang zu Handlung und Charakteren.
Warum eignet sich „Emil und die Detektive“ für Scaffolding?
Das Werk von Kästner bietet klare Strukturen, die durch visuelle Medien (Graphic Novels) ergänzt werden können, um heterogene Lerngruppen gezielt zu fördern.
Was ist intermedialer Literaturunterricht?
Ein Unterrichtsansatz, bei dem verschiedene Medien (Text, Bild, Film) miteinander verknüpft werden, um literarische Kompetenz und Medienkompetenz gleichzeitig zu schulen.
Was ist der Unterschied zwischen Mikro- und Makro-Scaffolding?
Mikro-Scaffolding findet direkt in der Interaktion im Unterricht statt, während Makro-Scaffolding die vorbereitende Planung des gesamten Lernrahmens beschreibt.
- Quote paper
- Moritz Dreger (Author), 2021, Essay über das Medium Graphic Novel als Makro-Scaffolding, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1287932