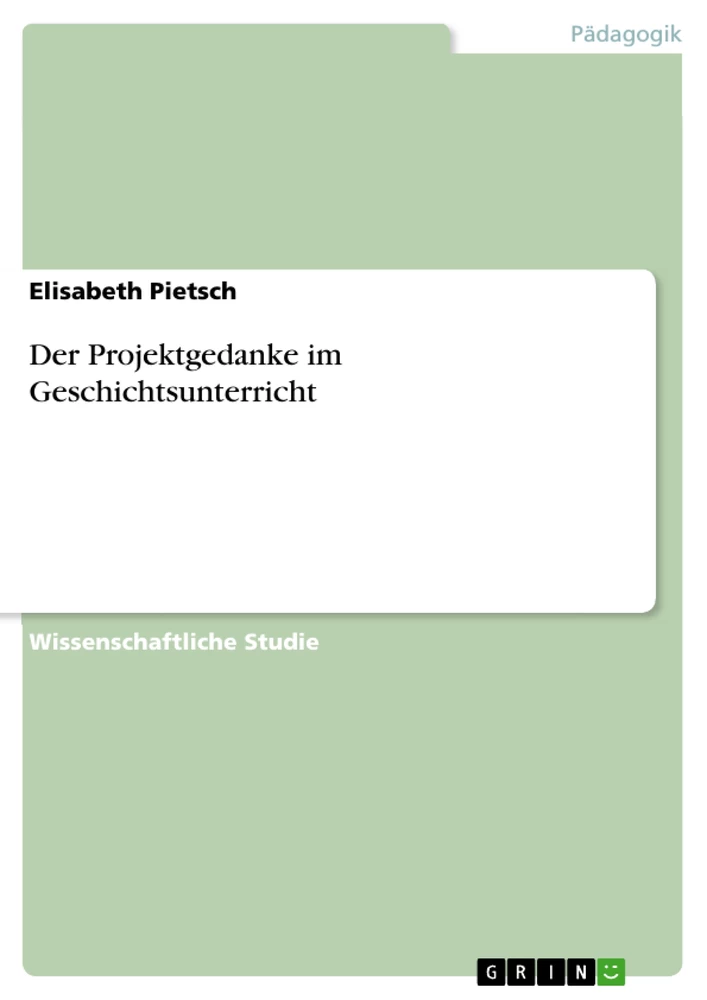[...] Deutschland befand sich in einem Schock über das katastrophale Ergebnis der PISA-Studie und man begann
einen Ausweg aus der Krise zu suchen. Es wurden Forderungen nach einer Öffnung von
Schule und Unterricht laut. Schule sollte nicht mehr ein fremdbestimmtes Lernen und Leben
fördern, sondern sich den Bedürfnissen, welche die Veränderungen in der Gesellschaft und
der Arbeitswelt mit sich brachten und noch bringen, anpassen und jene befriedigen.
Neben verschiedenen Maßnahmen, erinnerte man sich auch wieder an den Projektunterricht,
den in den 70ger und 80ger Jahren die Hauptschulen für sich entdeckt hatten. Man entsann
sich seiner Vorteile und begann ihn zu nutzen, um die Kluft zwischen Schule und Lebenswelt
zu mindern und jene für die SchülerInnen wieder interessant zu machen.
Dieser Arbeit, die mit dem Thema „Der Projektgedanke im Geschichtsunterricht“
überschrieben ist, liegen jene Gedanken über das Potenzial, welches dem Projektunterricht zur
Veränderung von Schule und Unterricht innewohnt, zugrunde.
Aus der Fülle von Konzepten die zum Projektunterricht entwickelt worden sind, möchte ich
zwei Ansätze näher vorstellen und anschließend die Besonderheiten, welche den
Projektunterricht von traditionellen Lehrformen unterscheidet, in einer Definition
zusammenstellen, die für mich in Bezug auf diese Arbeit, aber auch für meine spätere
Tätigkeit als Lehrerin handlungsleitend sein soll.
Oft wird beklagt, dass mit dem Projektunterricht ein zu großer Zeitaufwand verbunden sei,
welcher das Erfüllen des Lehrplanes unmöglich macht. Aus diesen Gründen findet der
Projektunterricht in den Schulen, trotz der bekannten positiven Effekte, noch immer selten
Anwendung.
Im zweiten Teil dieser Arbeit möchte ich daher mit der Konzeption des Projektes „Ein Ort mit
doppelter Geschichte“ versuchen darzustellen, dass es Möglichkeiten gibt das Projektlernen
für den eigenen Unterricht fruchtbar zu machen. In Bezug auf das Fach Geschichte bietet sich
im Projektunterricht eine Methode, um historisches Lernen zu ermöglichen, so dass sich bei
den SchülerInnen ein Bewusstsein für Geschichte ausprägen kann. Die für diese
Projekteinheit zu nutzenden Dokumente sowie Materialien können Sie dem dritten Abschnitt
dieser Arbeit entnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- A Geschichte und Umsetzung der Projektmethode
- I. Historische Entwicklung des Projektunterrichtes
- I.1 Die Anfänge des Projektunterrichtes
- I.2 Der amerikanische Pragmatismus
- I.2.1 John Dewey (1859 - 1952)
- I.2.2 Wiliam Heard Kilpatrick (1871 – 1965)
- I.3 Die deutsche Reformpädagogik
- I.3.1 Berthold Otto (1859 – 1933)
- I.3.2 Georg Kerschensteiner (1854 – 1932)
- I.3.3 Peter Gaudig (1860 – 1923)
- I.3.4 Peter Petersen (1884 – 1952)
- I.4 Die „Innovationszeit“ und die Gegenwart
- II. Begründungsebenen für Projektunterricht
- II.1 Sozialisationstheoretische Ebene
- II.2 Lernpsychologische Ebene
- II.3 Bildungstheoretische Ebene
- III. Phasen, Merkmale und Definition des Projektunterrichtes
- III.1 Die Projektmethode von Karl Frey
- III.1.1 Projektinitiative
- III.1.2 Projektskizze
- III.1.3 Projektplan
- III.4 Aktivitäten im Betätigungsgebiet/ Projektdurchführung
- III.5 Beendigung des Projektes
- III.6 Fixpunkte und Metainteraktion
- III.2 Der Projektunterricht nach Herbert Gudjons
- III.2.1 Situationsbezug
- III.2.2 Orientierung an den Interessen der Beteiligten
- III.2.3 Gesellschaftliche Praxisrelevanz
- III.2.4 Zielgerichtete Projektplanung
- III.2.5 Selbstorganisation und Selbstverantwortung
- III.2.6 Einbeziehen vieler Sinne
- III.2.7 Soziales Lernen
- III.2.8 Produktorientierung
- III.2.9 Interdisziplinarität
- III.2.10Grenzen des Projektunterrichts
- III.3 Ein Versuch einer Definition
- III.3.1 Die Rolle der SchülerInnen
- III.3.2 Die Rolle der LehrerInnen
- III.4 Leistungsbeobachtung und Leistungsbeurteilung im Projektunterricht
- III.4.1 Position FÜR die Benotung im Projektunterricht
- III.4.2 Position GEGEN die Benotung im Projektunterricht
- III.4.3 Konsequenz
- B Konzeption der Projekteinheit „Ein Ort mit doppelter Vergangenheit“
- I. Allgemeine Voraussetzungen
- I.1 Die Gedenkstätte Münchner Platz, Dresden
- I.2 Die Bedingungen durch den Lehrplan des Faches Geschichte
- I.3 Lernzielsetzungen für das Projekt „Ein Ort mit doppelter Vergangenheit“
- II. Das Projekt „Ein Ort mit doppelter Vergangenheit“ im Einzeln
- II.1 Meine Vorbereitung
- II.1.1 Das Zeitbudget
- II.1.2 Kontakt zur Schulleitung, zu Eltern sowie zur Gedenkstätte
- II.1.3 Der Einstieg
- II.2 Ein Verlauf des Projektes
- II.2.1 Projektplanung
- II.2.2 Durchführung
- II.2.2.1 Alojs Andricki
- II.2.2.2 Gottfried Klenke u.a.
- II.2.2.3 Hermann Flade
- II.2.2.4 Dr. Margarete Blank
- II.2.2.5 Wilhelm Grothaus
- II.2.2.6 Arno Eckelmann
- II.2.2.7 Karel Loewensohn
- II.2.3 Tagesprotokoll, Lerntagebuch und Runder Tisch
- II.2.4 Ein Produkt
- II.2.4.1 Haltepunkt Schwurgerichtssaal
- II.2.4.2 Haltepunkt Todeszellen
- II.2.4.3 Haltepunkt Richthof
- II.2.4.4 Haltepunkt Gedenkwand
- II.2.4.5 Haltepunkt Bronzeschrift
- II.2.4.6 Haltepunkt Gefängnishof/ Haftanstalt
- II.2.5 Auswertung, Reflexion und Bewertung
- III. Schlussbemerkung
- C Anhang
- I. Auswahlliste
- II. Dokumente zu Alojs Andricki
- III. Dokumente zu Gottfried Klenke
- IV. Dokumente zu Hermann Flade
- V. Dokumente zu Dr. Margarete Blank
- VI. Dokumente zu Wilhelm Grothaus
- VII. Dokumente zu Arno Eckelmann
- VIII. Dokumente zu Karel Loewensohn
- IX. Tagesprotokoll
- X. Lerntagebuch
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Projektunterricht im Fach Geschichte?
Ziel ist es, die Kluft zwischen Schule und Lebenswelt zu verringern und bei Schülern durch aktives Handeln ein Bewusstsein für Geschichte auszuprägen.
Was beinhaltet das Projekt „Ein Ort mit doppelter Geschichte“?
Das Projekt befasst sich mit der Gedenkstätte Münchner Platz in Dresden und untersucht historische Schicksale aus der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR.
Wer waren die Vordenker der Projektmethode?
Wichtige Impulse kamen vom amerikanischen Pragmatismus (John Dewey, William Kilpatrick) und der deutschen Reformpädagogik (z. B. Kerschensteiner, Petersen).
Welche Merkmale kennzeichnen guten Projektunterricht?
Dazu gehören Situationsbezug, Interessenorientierung, Selbstorganisation, Interdisziplinarität und die Erstellung eines konkreten Produktes.
Wie verändert sich die Rolle der Lehrkraft im Projekt?
Die Lehrkraft agiert weniger als Wissensvermittler, sondern eher als Berater und Begleiter des Lernprozesses.
- Citation du texte
- Elisabeth Pietsch (Auteur), 2009, Der Projektgedanke im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128827