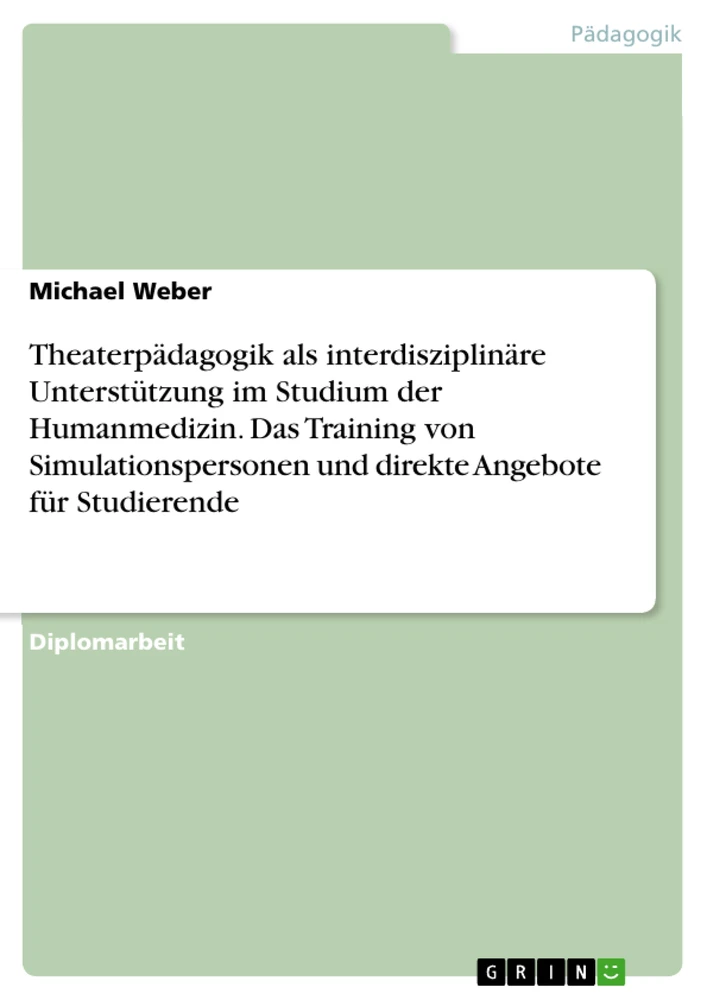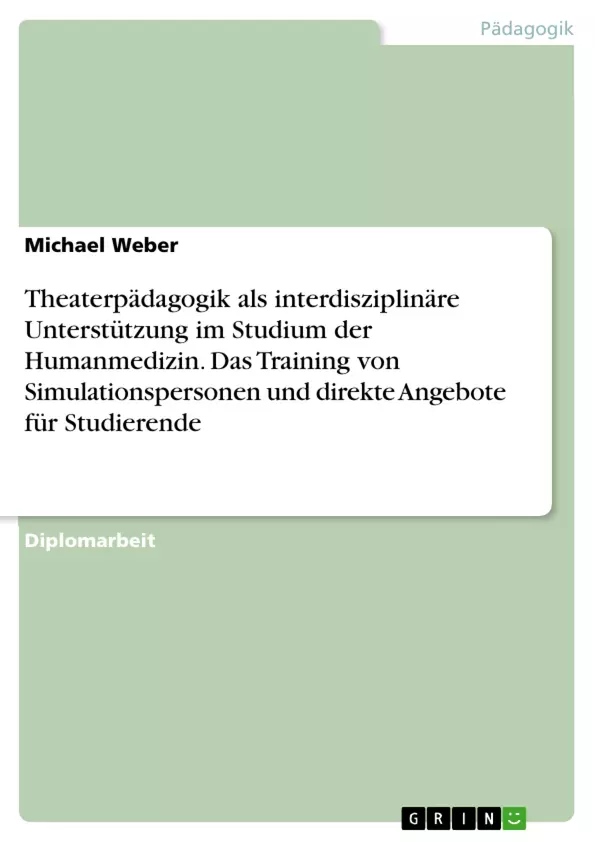Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Frage, inwiefern theaterpädagogische Methoden unterstützend im Studium der Humanmedizin eingesetzt werden können. Der Fokus liegt auf dem Training von Simulationspersonen, zeigt aber auch die Möglichkeiten für direkte Angebote an die Studierenden auf.
Das Thema Kommunikation nimmt einen immer größeren Stellenwert im Studium der Humanmedizin und in der Vermittlung an die Studierenden ein. Zukünftig sollen die Studierenden bereits frühzeitig und fortlaufend im Studium durch Simulationsgespräche ihre kommunikativen Kompetenzen erwerben und ausbauen.
Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden verschiedene Aspekte im Verlauf dieser Ausarbeitung untersucht. Zunächst erfolgt eine grundsätzliche Betrachtung des Themas Kommunikation und es werden ausgewählte Kommunikationstheorien und -modelle erläutert. Im Speziellen wird dann der Bereich der medizinischen Kommunikation beleuchtet. Hierbei wird der Wandel der Arzt-Patienten-Kommunikation im Verlauf der Zeit beschrieben und die aktuellen Modelle der Arzt-Patienten-Interaktion werden erklärt. Der nächste Abschnitt gibt einen Überblick über die Entwicklung des Studiums der Humanmedizin und betrachtet dabei insbesondere die Studieninhalte zur Arzt-Patienten-Kommunikation. Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Einsatz und der Ausbildung von Simulationspatienten. Hierbei handelt es sich um Darsteller, die in ihrer jeweiligen Rolle einen Patienten verkörpern. Es wird zudem die Verknüpfung zum Theater hergestellt und der mögliche Einsatz von theaterpädagogischen Methoden aufgezeigt. Um eine abschließende Folgerung aus den betrachteten Einzelaspekten ziehen zu können, werden die wesentlichen Erkenntnisse aus den einzelnen Abschnitten im letzten Kapitel nochmals zusammengefasst betrachtet und ein Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung in die Thematik
- 1.2. Forschungsfrage
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. Die Arzt-Patienten-Kommunikation - Worüber sprechen wir?
- 2.1. Kommunikation im Wandel der Zeit
- 2.2. Kommunikation - Begriffsbestimmung
- 2.3. Kommunikationstheorien und -modelle
- 2.3.1. Informationstheoretisches Modell nach Shannon und Weaver
- 2.3.2. Axiome nach Watzlawick
- 2.3.3. Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun
- 2.3.4. Konversationsmaxime nach Grice
- 2.3.5. Aktives Zuhören nach Rogers
- 2.3.6. Johari-Modell nach Luft und Ingham
- 2.4. Medizinische Kommunikation
- 2.4.1. Arzt-Patienten-Kommunikation im Wandel der Zeit
- 2.4.2. Modelle der Arzt-Patienten-Interaktion und deren Auswirkung
- 2.5. Kommunikation als Lehrinhalt im Studium der Humanmedizin
- 2.6. Resümee
- 3. Theaterpädagogik in der Simulationspatientenausbildung
- 4.1. Grundlagen des Simulationsgesprächs
- 4.2. Die Dramenstruktur der Arzt-Patienten-Kommunikation
- 4.3. Rollenbiografie im Vergleich zum Theater
- 4.4. Theaterpädagogische Methoden zur Rollenerarbeitung
- 4.5. Wirkweise der Simulationsgespräche auf die Studenten
- 5. Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Nutzen von Theaterpädagogik als interdisziplinäre Unterstützung im Studium der Humanmedizin zur Förderung kommunikativer Kompetenzen angehender Mediziner. Die zentrale Forschungsfrage beleuchtet, wie Theaterpädagogik Studierende dabei unterstützen kann, Kompetenzen für die Arzt-Patienten-Kommunikation zu erwerben.
- Arzt-Patienten-Kommunikation und deren Herausforderungen
- Kommunikationstheorien und -modelle im medizinischen Kontext
- Simulationspatientenausbildung und der Einsatz von Theatermethoden
- Rollenspiele und die Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Medizinstudium
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ärztlichen Kommunikationskompetenz ein und verweist auf Studien, die deren Defizite aufzeigen. Der Masterplan Medizinstudium 2020 wird als Grundlage für die Verbesserung der Kommunikationssituation im Arzt-Patienten-Verhältnis genannt. Die Arbeit formuliert die Forschungsfrage nach dem Nutzen von Theaterpädagogik zur Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
2. Die Arzt-Patienten-Kommunikation - Worüber sprechen wir?: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte der Arzt-Patienten-Kommunikation. Es beschreibt den Wandel der Kommunikation im Laufe der Zeit und erläutert verschiedene Kommunikationstheorien und -modelle (wie das informationstheoretische Modell, die Axiome von Watzlawick, das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun, die Konversationsmaximen von Grice, aktives Zuhören nach Rogers und das Johari-Modell). Es analysiert die medizinische Kommunikation, ihren Wandel und aktuelle Interaktionsmodelle. Abschließend wird die Kommunikation als Lehrinhalt im Medizinstudium betrachtet.
3. Theaterpädagogik in der Simulationspatientenausbildung: Dieses Kapitel fokussiert auf den Einsatz von Theaterpädagogik in der Simulationspatientenausbildung. Es erläutert die Grundlagen des Simulationsgesprächs, die Dramenstruktur der Arzt-Patienten-Kommunikation, den Vergleich von Rollenbiografie und Theater sowie den Einsatz theaterpädagogischer Methoden zur Rollenerarbeitung. Der Einfluss dieser Methoden auf die Studierenden wird ebenfalls analysiert.
Schlüsselwörter
Arzt-Patienten-Kommunikation, Kommunikationstheorien, Theaterpädagogik, Simulationspatienten, Medizinstudium, Kommunikationskompetenz, Rollenspiele, Interdisziplinarität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Theaterpädagogik in der Arzt-Patienten-Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Nutzen von Theaterpädagogik als interdisziplinäre Methode zur Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen von Medizinstudenten im Bereich der Arzt-Patienten-Kommunikation. Die zentrale Frage ist, wie Theaterpädagogik Studierende dabei unterstützen kann, die notwendigen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Arzt-Patienten-Interaktion zu erlernen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Auseinandersetzung mit der Arzt-Patienten-Kommunikation, verschiedenen Kommunikationstheorien und -modellen (z.B. Shannon & Weaver, Watzlawick, Schulz von Thun, Grice, Rogers, Johari-Modell), der Simulationspatientenausbildung, dem Einsatz theaterpädagogischer Methoden in der medizinischen Ausbildung, Rollenspielen und der Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit im Medizinstudium. Die Arbeit analysiert den Wandel der Arzt-Patienten-Kommunikation und beleuchtet deren Herausforderungen.
Welche Methoden werden in der Arbeit eingesetzt?
Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturrecherche und die Analyse bestehender Kommunikationstheorien und -modelle. Sie beschreibt den Einsatz von Theaterpädagogik in der Simulationspatientenausbildung und untersucht die Wirkung theaterpädagogischer Methoden auf die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen von Medizinstudenten. Die Arbeit basiert auf der Analyse der bestehenden Literatur und setzt keine eigenen empirischen Studien um.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgt ein Kapitel zur Arzt-Patienten-Kommunikation, das verschiedene Kommunikationstheorien und -modelle beleuchtet und den Wandel der Arzt-Patienten-Kommunikation analysiert. Ein weiteres Kapitel fokussiert sich auf den Einsatz von Theaterpädagogik in der Simulationspatientenausbildung und beschreibt relevante Methoden. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick gegeben. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arzt-Patienten-Kommunikation, Kommunikationstheorien, Theaterpädagogik, Simulationspatienten, Medizinstudium, Kommunikationskompetenz, Rollenspiele, Interdisziplinarität.
Welche konkreten Kommunikationstheorien und -modelle werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert unter anderem das informationstheoretische Modell nach Shannon und Weaver, die Axiome nach Watzlawick, das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun, die Konversationsmaximen nach Grice, aktives Zuhören nach Rogers und das Johari-Modell. Diese Modelle werden im Kontext der Arzt-Patienten-Kommunikation analysiert.
Welche Rolle spielt der Masterplan Medizinstudium 2020 in dieser Arbeit?
Der Masterplan Medizinstudium 2020 wird als Grundlage für die Verbesserung der Kommunikationssituation im Arzt-Patienten-Verhältnis genannt und dient als Kontext für die Bedeutung der Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen von Medizinstudenten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Medizinstudenten, Dozenten der Medizin, Schauspieler, Theaterpädagogen, und alle, die sich mit der Verbesserung der Arzt-Patienten-Kommunikation und dem Einsatz von Theaterpädagogik in der medizinischen Ausbildung beschäftigen.
- Quote paper
- Michael Weber (Author), 2019, Theaterpädagogik als interdisziplinäre Unterstützung im Studium der Humanmedizin. Das Training von Simulationspersonen und direkte Angebote für Studierende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1292719