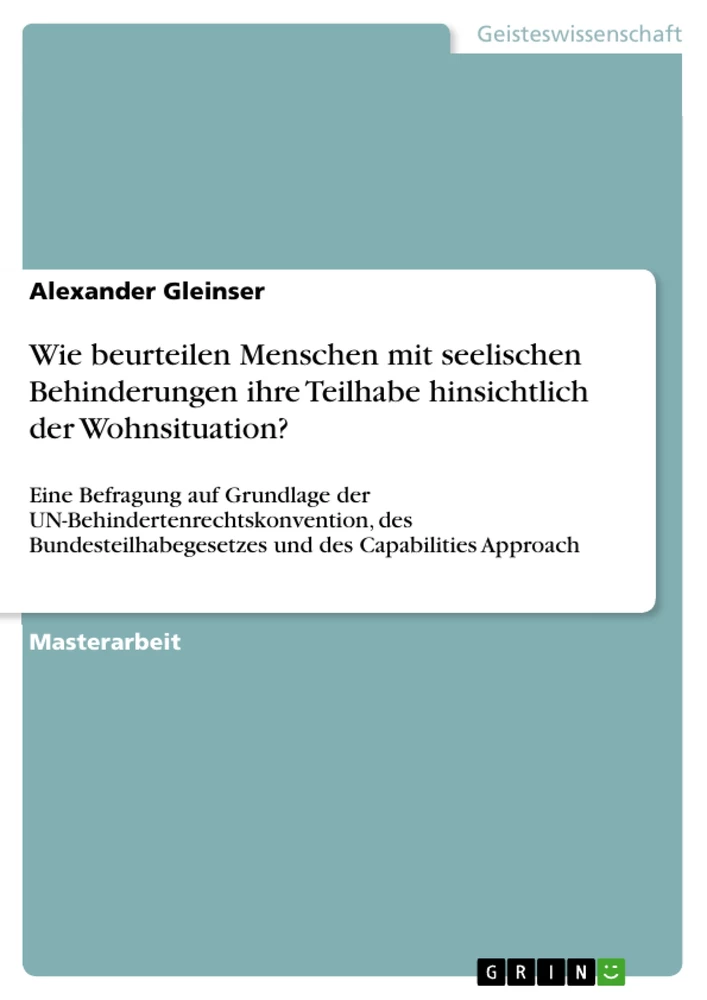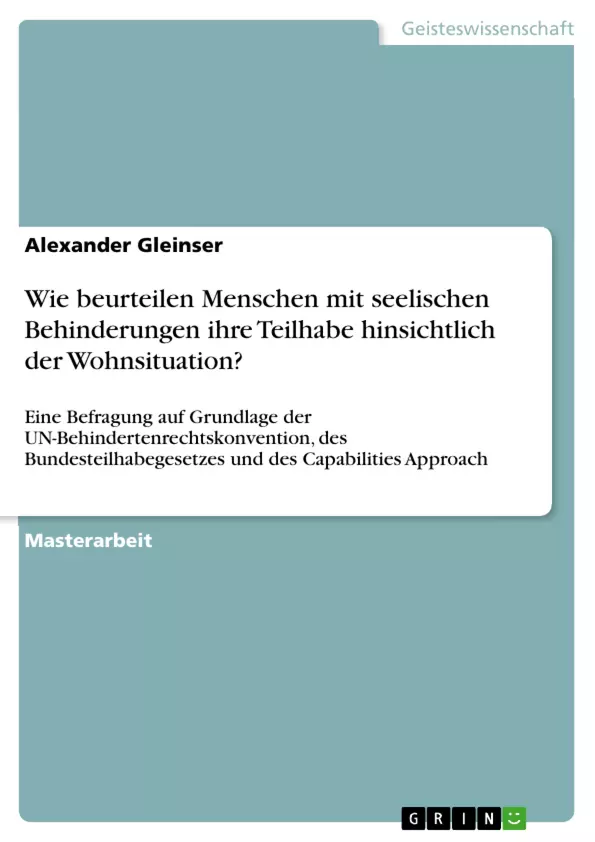Die vorliegende Arbeit versucht den aktuell sich ereignenden Umsetzungsprozess aus sozialarbeitswissenschaftlicher Sicht zu beleuchten und zugleich die Informationslücke bezüglich der Teilhabesituation von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen weiter zu schließen, damit folglich über sozialpolitische Konsequenzen diskutiert sowie ein "Instrument zur Planung und Strukturierung von sozialarbeiterischen Entscheidungen generiert werden könnte".
Dazu wird im Folgenden eine Lebenslagenanalyse mit dem Schwerpunkt auf den (Teilhabe-)Bereich Wohnen durchgeführt. Objekt der Forschung sind dabei Menschen mit wesentlichen seelischen Beeinträchtigungen in betreuten Wohnformen. Als theoretische Grundlage für die Untersuchung dienen dabei die UN-Behindertenrechtskonvention, das Bundesteilhabegesetz sowie der Capabilities Approach. Die sich anschließende Forschungsarbeit, die auf eine qualitativ-rekonstruierende Untersuchung mittels Experteninterviews für die Erhebung von Daten und qualitativer Inhaltsanalyse für deren Auswertung zurückgreift, verfolgt dabei das Ziel nachstehende Forschungsfrage zu beantworten: Wie beurteilen Menschen mit wesentlichen seelischen Beeinträchtigungen in betreuten Wohnformen ihre Teilhabe hinsichtlich der Wohnsituation?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Grundlegendes zur UN-Behindertenrechtskonvention
- Inhaltliches zur UN-Behindertenrechtskonvention
- Das menschenrechtliche Modell von Behinderung in der UN-Behindertenrechtskonvention
- Artikel 19 UN-BRK: Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft
- Grundlegendes zum Bundesteilhabegesetz
- Der Behinderungsbegriff im Bundesteilhabegesetz
- Das Wunsch- und Wahlrecht im Bundesteilhabegesetz
- Soziale Teilhabe und Assistenzleistungen im Bundesteilhabegesetz
- Definitionen von Wohnraum im Bundesteilhabegesetz
- Der Capabilities Approach und die Soziale Arbeit – die Handlungstheorie der daseinsmächtigen Lebensführung nach Dieter Röh
- Die Verbindung zwischen UN-BRK, BTHG und dem CA: Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse
- Lebenslagen von Menschen mit wesentlichen seelischen Beeinträchtigungen mit dem Fokus auf Wohnen
- Grundlegendes zur UN-Behindertenrechtskonvention
- Empirische Untersuchung
- Formulierung der Forschungsfrage
- Begründung der Fallauswahl und der Fallzahl
- Das Experteninterview als Erhebungsmethode
- Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode
- Konstruktion des Interviewleitfadens
- Auswertung der Experteninterviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse
- Einzelfallbezogene Analyse
- Fallvergleichende Analyse und Diskussion der Ergebnisse
- Beantwortung der Forschungsfrage und Schlussfolgerungen für Praxis, Politik und Wissenschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit setzt sich zum Ziel, die Wohnsituation von Menschen mit wesentlichen seelischen Beeinträchtigungen in betreuten Wohnformen im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention, des Bundesteilhabegesetzes und des Capabilities Approach zu untersuchen.
- Die Untersuchung beleuchtet die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Bezug auf die Teilhabe von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen im Bereich Wohnen.
- Sie analysiert die Lebenslagen und Erfahrungen dieser Personengruppe in betreuten Wohnformen.
- Die Arbeit fokussiert auf die subjektiven Wahrnehmungen und Einschätzungen der Teilhabemöglichkeiten im Hinblick auf die Wohnsituation.
- Sie untersucht, inwiefern die Prinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundesteilhabegesetzes in der Praxis umgesetzt werden.
- Sie setzt den Capabilities Approach als theoretisches Rahmenwerk ein, um die Teilhabeperspektive der Betroffenen zu verstehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundesteilhabegesetzes beleuchtet. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Untersuchung vorgestellt, darunter die UN-Behindertenrechtskonvention, das Bundesteilhabegesetz und der Capabilities Approach. Der Fokus liegt dabei auf den relevanten Artikeln der UN-Behindertenrechtskonvention und den zentralen Aspekten des Bundesteilhabegesetzes, die für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Bereich Wohnen relevant sind. Des Weiteren wird der Capabilities Approach als Handlungstheorie der daseinsmächtigen Lebensführung von Dieter Röh vorgestellt und seine Verbindung zur Sozialen Arbeit aufgezeigt. Der theoretische Teil schließt mit einer Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse zu den Lebenslagen von Menschen mit wesentlichen seelischen Beeinträchtigungen und deren Wohnsituation.
Im empirischen Teil der Arbeit wird die Forschungsfrage formuliert und anhand untergeordneter Leitfragen konkretisiert. Die Fallauswahl und die Fallzahl werden begründet und die qualitative Erhebungsmethode, das Experteninterview, wird erläutert. Anschließend wird die qualitative Auswertungsmethode, die qualitative Inhaltsanalyse, vorgestellt. Der Interviewleitfaden wird konstruiert und die Auswertung der Experteninterviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse erfolgt in Form einer Einzelfallbezogenen Analyse und einer Fallvergleichenden Analyse. Die Ergebnisse werden diskutiert und im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert.
Schlüsselwörter
UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesteilhabegesetz, Capabilities Approach, Teilhabe, Wohnen, Menschen mit wesentlichen seelischen Beeinträchtigungen, Betreutes Wohnen, Lebenslagenanalyse, Experteninterview, Qualitative Inhaltsanalyse, Subjektive Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Wie bewerten Menschen mit psychischen Erkrankungen ihre Wohnsituation?
Die Arbeit untersucht subjektive Einschätzungen mittels Experteninterviews. Viele Betroffene wünschen sich mehr Selbstbestimmung und eine Wohnform, die echte gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.
Was fordert Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention?
Artikel 19 fordert das Recht auf eine unabhängige Lebensführung und die Einbeziehung in die Gemeinschaft. Menschen mit Behinderungen sollen frei wählen können, wo und mit wem sie leben.
Welche Bedeutung hat das Bundesteilhabegesetz (BTHG) für das Wohnen?
Das BTHG zielt darauf ab, Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen (Wohnen) zu trennen, um mehr individuelle Wahlfreiheit und personenzentrierte Assistenz zu ermöglichen.
Was ist das Wunsch- und Wahlrecht im Kontext der Teilhabe?
Es bedeutet, dass die Wünsche der Leistungsberechtigten bezüglich der Gestaltung der Hilfe und des Wohnortes maßgeblich berücksichtigt werden müssen, sofern sie angemessen sind.
Wie hilft der Capabilities Approach in der Sozialen Arbeit?
Der Ansatz konzentriert sich darauf, welche tatsächlichen Möglichkeiten (Verwirklichungschancen) ein Mensch hat, um ein Leben zu führen, für das er sich mit guten Gründen entscheiden konnte.
Was versteht man unter betreuten Wohnformen?
Hierbei handelt es sich um Wohnangebote, bei denen Menschen mit Beeinträchtigungen Unterstützung durch Fachkräfte erhalten, um ihren Alltag zu bewältigen, sei es in Wohngruppen oder in der eigenen Wohnung.
- Citation du texte
- Alexander Gleinser (Auteur), 2022, Wie beurteilen Menschen mit seelischen Behinderungen ihre Teilhabe hinsichtlich der Wohnsituation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1292726