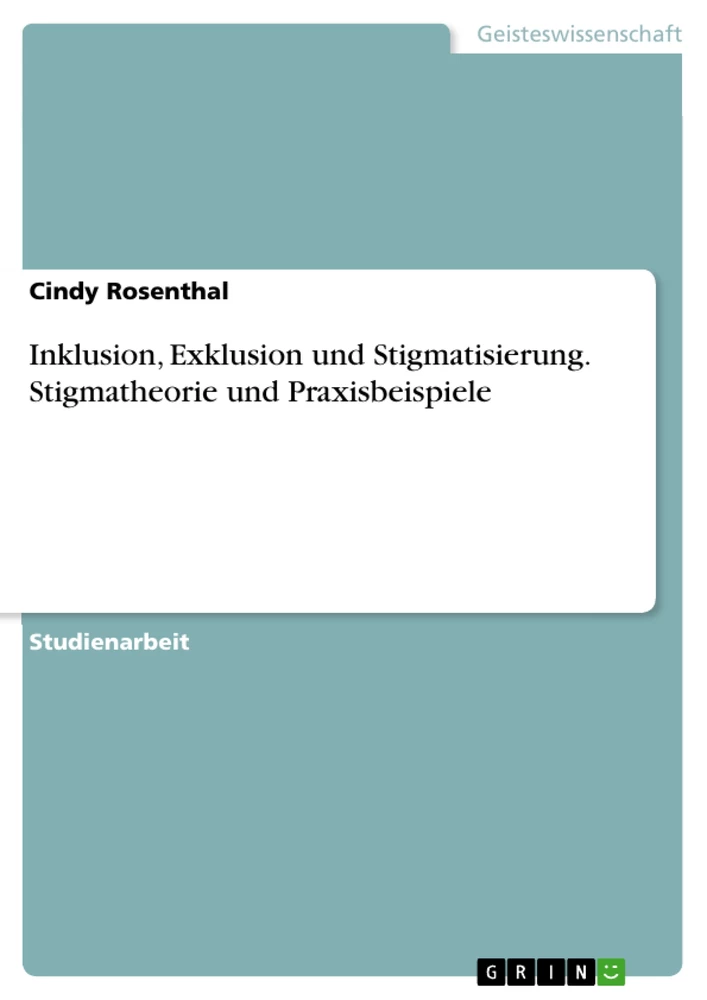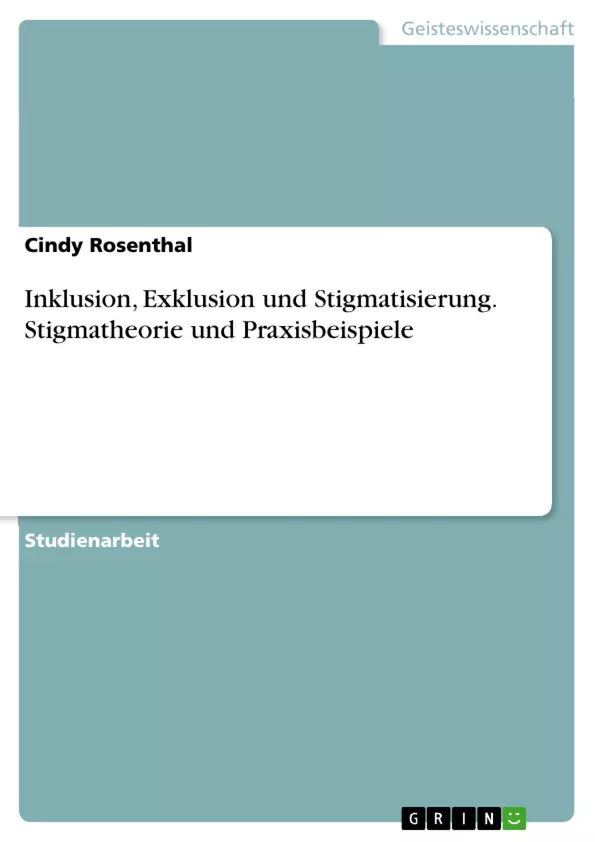Diese Hausarbeit zum Rahmenthema Inklusion/Exklusion legt ihren Schwerpunkt auf das Thema der Stigmatheorie und Stigma. Zu Beginn wird kurz erläutert, wie der Begriff Stigma theoretisch im wissenschaftlichen Kontext definiert wird. Dazu werden auch zusätzliche Phänomene, wie etwa In-Group/out-Group, Labeling oder „die Normalen“ kurz einbezogen und in den Zusammenhang gebracht. Als Primärquelle dieser Arbeit wird die Basisliteratur des Moduls 07 von Angela Quack und Andrea Schmidt genutzt. Nachdem eine theoretische Auseinanderersetzung den Definitionsrahmen setzt, wird anhand eines Fallbeispieles aus der Praxiseinrichtung einer Klientin und das Wirken ihrer Stigmata, im Gegensatz zu den Normalen, beschrieben. Besonderer Fokus wird hier nicht nur auf das markanteste Stigma der Klientin gelegt, sondern auch auf die Rolle der Schulsozialarbeit in diesem Zusammenhang. Hier wird kurz die Normalität der religiösen freien Jugendhilfe beschrieben und die Werte, welche im Zusammenhang mit der Klientin im Praxisbeispiel wirken. Um eine gesellschaftliche Einordnung der Stigmatisierungen zu erreichen, wird im letzten Teil der Arbeit das Phänomen der „Heteronormative“ dazu dienen, die Stigmatisierung aus dem Fallbeispiel im gesellschaftlichen Kontext zu betrachten. Anschließend werden aktuelle politische Geschehnisse den Kontext zur Aufrechterhaltung des bearbeiteten Kernstigmas geben. Ein Ausflug zum Kränkungsmodell soll zeigen, wie schwer es ist Normativen zum Wohle einer inklusiven Gesellschaft zu wandeln. Im Ausblick des Fazits wird es eine These zur Bearbeitung des Themas geben, welche in einer Forschung außerhalb dieser Arbeit weiterbearbeitet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Praxisbeispiel - Tafeln liebt man nicht
- Das signifikanteste Stigma von Marie
- SchulsozialarbeiterInnen, freie Träger und die Normen und Werte ihrer Arbeit
- Benachteiligung durch abweichendes Verhalten der sexuellen und geschlechtlichen Normative
- Die Normalen- oder das Konzept Heteronormativität
- Stigmatisierung von Objektsexualität als Wehr vor einer etwaigen großen Kränkung?
- Fazit mit Ausblick auf inklusive Innovative Veränderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Thema Stigmatisierung im Kontext von Inklusion und Exklusion. Sie definiert den Begriff Stigma, beleuchtet relevante Phänomene wie In-Group/Out-Group und Labeling, und analysiert ein Praxisbeispiel, um die Auswirkungen von Stigmatisierung aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Rolle von Schulsozialarbeit und der gesellschaftlichen Konstruktion von Normalität.
- Definition und theoretische Einordnung von Stigma
- Analyse eines Praxisbeispiels zur Stigmatisierung
- Die Rolle der Schulsozialarbeit im Umgang mit Stigmatisierung
- Der Einfluss von Heteronormativität auf Stigmatisierungen
- Möglichkeiten inklusiver Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Stigmatisierung im Rahmen von Inklusion/Exklusion. Sie skizziert den theoretischen Rahmen der Stigmatheorie und kündigt die Analyse eines Praxisbeispiels an, um die Auswirkungen von Stigma aufzuzeigen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Schulsozialarbeit und dem gesellschaftlichen Kontext von Heteronormativität gewidmet. Die Arbeit strebt nach einer Einordnung des Phänomens Stigmatisierung und gibt einen Ausblick auf mögliche inklusive Veränderungen.
Definitionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff Stigma im Kontext Sozialer Arbeit, basierend auf Goffmans Werk. Es erklärt den Mechanismus der Stigmatisierung als Ergebnis westlichen Schubladendenkens und zeigt, wie Zuschreibungen und Kategorisierungen Individuen diskreditieren und über Generationen hinweg wirken können. Der Begriff „Normalität“ wird kritisch hinterfragt als gesellschaftlich konstruiertes und veränderbares Konstrukt, welches im Kontrast zu Stigmata steht. Geschlechterstereotypen und Rollenstigma im Kontext von Sexismus werden ebenfalls beleuchtet, wobei die Definition von Sexismus nach Anne Wizorek einbezogen wird.
Praxisbeispiel - Tafeln liebt man nicht: Dieses Kapitel präsentiert ein Fallbeispiel (Klientin „Marie“) um zu veranschaulichen, wie Stigma innerhalb bereits stigmatisierter Systeme wirken kann. Es kontrastiert Maries Situation mit der konstruierten Figur einer „normalen“ Schülerin, um die Mechanismen der Ausgrenzung und die daraus resultierende „Sonderlingsrolle“ Maries aufzuzeigen. Dabei wird auch die Rolle der Schulsozialarbeit und die Einflüsse gesellschaftlicher Normen und Werte beleuchtet. Die differenzierte Betrachtung des Fallbeispiels soll die komplexen Auswirkungen von Stigmatisierung verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Exklusion, Stigmatisierung, Stigma, Heteronormativität, Schulsozialarbeit, Normalität, Praxisbeispiel, Benachteiligung, Geschlechterstereotypen, Sexismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Tafeln liebt man nicht" - Eine Hausarbeit zur Stigmatisierung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Thema Stigmatisierung im Kontext von Inklusion und Exklusion. Sie analysiert, wie Stigmatisierungen entstehen und wirken, insbesondere im schulischen Umfeld und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Normen, wie der Heteronormativität.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Stigma, relevante Phänomene wie In-Group/Out-Group und Labeling, die Rolle der Schulsozialarbeit im Umgang mit Stigmatisierung, den Einfluss von Heteronormativität und Möglichkeiten inklusiver Veränderungen. Ein Praxisbeispiel ("Marie") illustriert die Auswirkungen von Stigmatisierung in einem bereits stigmatisierten System.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Definitionen (Stigma, Normalität, Sexismus), die Analyse eines Praxisbeispiels ("Tafeln liebt man nicht"), eine Auseinandersetzung mit Benachteiligung durch abweichendes Verhalten von der sexuellen und geschlechtlichen Norm und Heteronormativität, sowie ein Fazit mit Ausblick auf inklusive Veränderungen.
Was ist das zentrale Praxisbeispiel?
Das zentrale Praxisbeispiel beschreibt die Situation von "Marie", um aufzuzeigen, wie Stigma innerhalb bereits stigmatisierter Systeme wirkt. Es veranschaulicht die Mechanismen der Ausgrenzung und die daraus resultierende "Sonderlingsrolle" von Marie und beleuchtet die Rolle der Schulsozialarbeit und gesellschaftlicher Normen.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit?
Die Rolle der Schulsozialarbeit im Umgang mit Stigmatisierung wird in der Hausarbeit untersucht. Das Praxisbeispiel beleuchtet den Einfluss der Schulsozialarbeit und die Herausforderungen im Umgang mit stigmatisierten Schülern.
Wie wird der Begriff "Normalität" betrachtet?
Der Begriff "Normalität" wird kritisch hinterfragt. Er wird als gesellschaftlich konstruiertes und veränderbares Konstrukt dargestellt, das im Kontrast zu Stigmata steht. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche Konstruktion von Normalität und deren Einfluss auf Stigmatisierungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, Exklusion, Stigmatisierung, Stigma, Heteronormativität, Schulsozialarbeit, Normalität, Praxisbeispiel, Benachteiligung, Geschlechterstereotypen, Sexismus.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Goffmans Werk zur Stigmatheorie und bezieht die Definition von Sexismus nach Anne Wizorek mit ein. Sie analysiert den Mechanismus der Stigmatisierung als Ergebnis westlichen Schubladendenkens und zeigt, wie Zuschreibungen und Kategorisierungen Individuen diskreditieren.
Welchen Ausblick bietet die Arbeit?
Die Arbeit gibt einen Ausblick auf mögliche inklusive Veränderungen, die dazu beitragen können, Stigmatisierung zu reduzieren und Inklusion zu fördern.
- Citar trabajo
- Cindy Rosenthal (Autor), 2017, Inklusion, Exklusion und Stigmatisierung. Stigmatheorie und Praxisbeispiele, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1297738