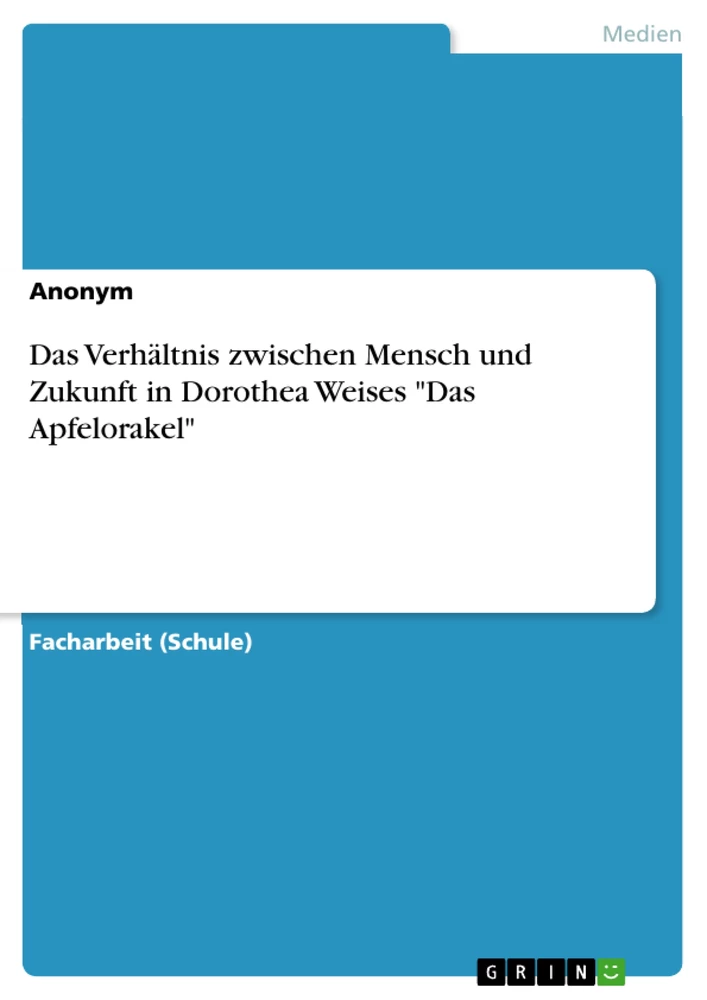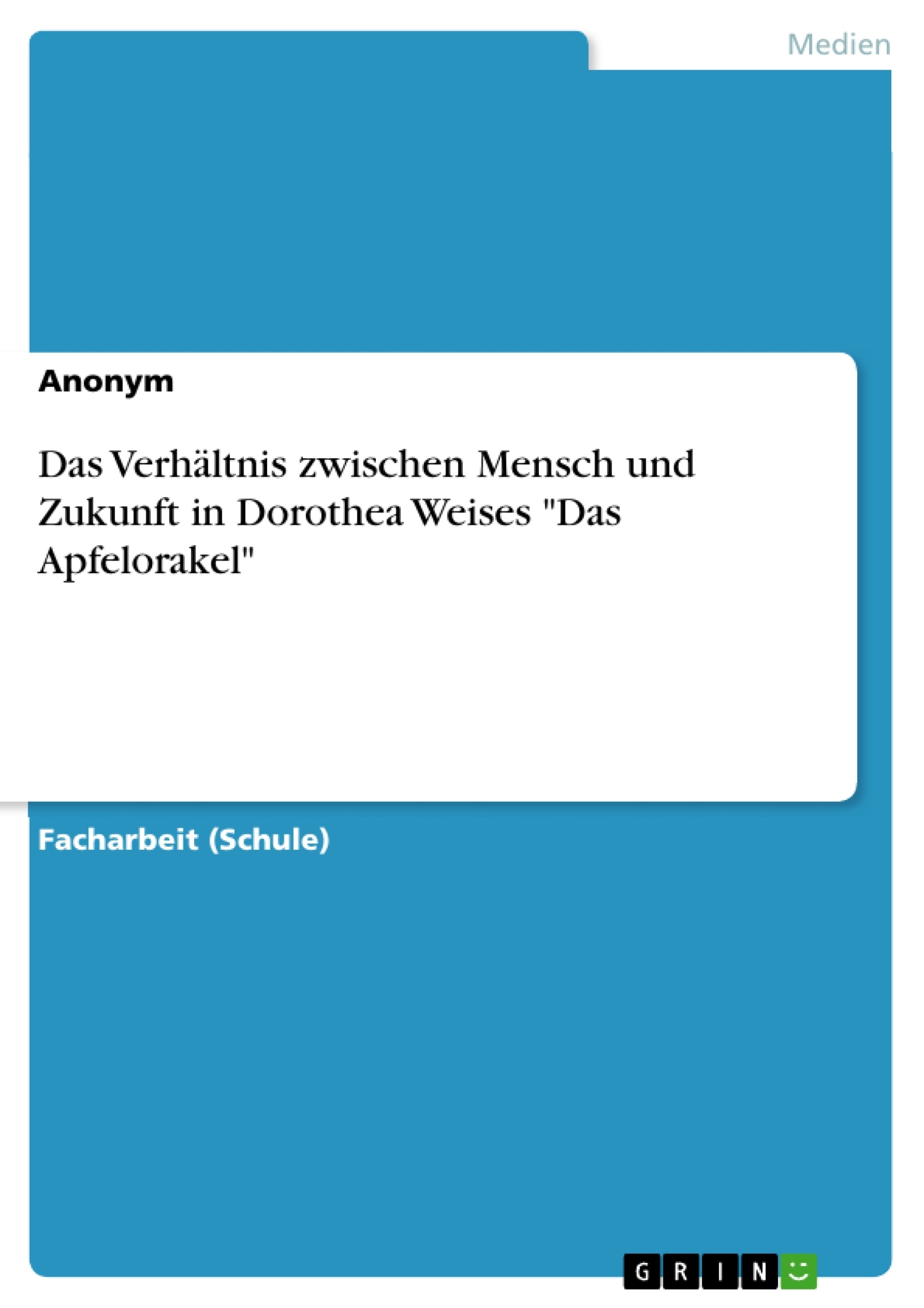Diese Arbeit setzt sich mit dem bis dato noch nicht rezensierten Werk "Das Apfelorakel" der Berliner Künstlerin Dorothea Weise auseinander. Ziel ist es eine fundierte werkimmanente Interpretation des Bildes zu erreichen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Bildbeschreibung
3. Formale Bildanalyse
4. Das Apfelorakel
5. Symboliken in Kunst und Gesellschaft
5.1. Der Apfel
5.2. Das Messer
5.3. Die Vögel
5.4. Das Mädchen
5.4.1. Das Mädchen als Allegorie
5.4.2. Das blutige Auge
5.4.3. Das Kinngrübchen
5.4.4. Das Aussehen
6. Interpretationsansätze
6.1. Der Apfel
6.2. Das Messer
6.3. Die Vögel
6.4. Das Mädchen
7. Fazit
8. Ausblick
9. Anhang
9.1. Bilder
10. Quellen
10.1. Stellungnahme des Autors
10.2. Literaturquellen
10.3. Bildquellen
1. Einleitung
Der Traum vom Fliegen. Die Suche nach dem Ursprung des Lebens. Seit jeher streben die Menschen nach dem Unbekannten, stellen sich immer neuen Herausforderungen und greifen nach den Sternen. Schon immer war die Erreichung des scheinbar Unmöglichen weniger eine Möglichkeit als vielmehr ein Muss. Dabei war kein Ziel zu groß und das Erlangen von Wissen stets das höchste Gut. Und die Geschichte gibt der Menschheit recht. Der Traum vom Fliegen ist längst Wirklichkeit geworden, mit Flugzeugen und Raketen erheben wir uns in den Himmel und darüber hinaus. Zwar ist der Ursprung des Lebens noch nicht geklärt, doch können wir mittlerweile Stoffe bis auf das kleinste Teil des kleinsten Teiles erforschen, und die Beantwortung all unserer Fragen ist weniger eine Unmöglichkeit als eine Frage des Zeitpunkts. Heute wissen wir. Und wenn wir nicht wissen, wissen wir, wie wir zu dem Wissen gelangen. Nichts scheint mehr unmöglich, nichts befindet sich mehr außerhalb unserer Reichweite. Nichts, außer der Sache, welche die Menschen schon seit Jahrhunderten beschäftigt. Sie ist unerreichbar, unveränderbar und niemand kann ihr entgehen. Die Zukunft. Sie ist weiterhin für uns Menschen unfassbar und so spinnen sich immer noch, wie seit dem Anfang der Zeit, zahlreiche Mythen und Bräuche um das unerreichbare Morgen. Denn was man mit der weltlichen Wissenschaft nicht ergründen kann, versucht man mit überweltlichen Strategien zu erreichen. Allerdings liegen in dem Wissen um die Zukunft nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Gefahren.
Mit all diesen Fragen und Thematiken setzt sich das Werk Das Apfelorakel von Dorothea Weise, einer zeitgenössischen Künstlerin aus Berlin, auseinander. Mithilfe von zahlreichen aussagekräftigen Symbolen verwebte sie das Thema der Zukunft zu einem beeindruckenden, vielleicht verstörenden, in jedem Falle aber fesselndem Gesamtbild. In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird versucht, diese Symbole durch eine systematische Herangehensweise wieder zu entschlüsseln, um so eine vielschichtige Antwort auf die philosophische Fragestellung dieser Arbeit, dem Verhältnis von Mensch und Zukunft, finden zu können. Zu diesem Zweck werden in 5. Symboliken in Kunst und Gesellschaft die scheinbar bedeutendsten Symbole im Hinblick auf die allgemein anerkannten Bedeutungen beleuchtet und in einem zweiten Schritt in 6. Interpretationsansätze mit der Leitfrage dieser Arbeit verknüpft. Davor bekommt der Leser in 2. Bildbeschreibung einen ausführlichen Überblick über das Werk von Dorothea Weise, welches sich ebenfalls unter 9.1.1. „Das Apfelorakel“ von Dorothea Weise in dieser Arbeit nachschlagen lässt. Daran angeschlossen wird das Werk in 3. Formale Analyse unter anderem unter den Gesichtspunkten Farbwahl, Proportionen und Interaktion des Bildes mit dem Betrachter untersucht und in 4. Das Apfelorakel wird das Motiv des Apfelorakels genauer erläutert. Den Interpretationsansätzen folgt das Kapitel 7. Fazit, in welchem noch einmal die Quintessenz aus den vorangegangenen Kapiteln herauskristallisiert wird. Danach folgt mit 8. Ausblick ein kurzer Ausblick über die mögliche Zukunft der Zukunft, oder besser gesagt, über die Zukunft des Verhältnisses der Menschen zu der Zukunft. Im Anhang befindet sich, wie oben schon angeführt, eine Abbildung des Werkes Das Apfelorakels und zudem noch unter 9.1.2. Bilder zur Vogelbestimmung Bilder, auf welche in dem Abschnitt 5.3. Die Vögel verwiesen wird. Abschließend folgen auf den Anhang mit 10. Quellen sowohl die Literatur- als auch die Bildquellen dieser Arbeit. Und im letzten Kapitel findet sich die Eigenständigkeitserklärung des Autors.
2. Bildbeschreibung
Das zentrale Motiv in dem Werk Das Apfelorakel von Dorothea Weise ist ein Mädchen jüngeren Alters, welches sich durch seine Erscheinungsform stark von der heute herrschenden Norm unterscheidet. Das Mädchen ist nicht vollständig, sondern nur zu einem großen Teil in dem Werk abgebildet. Zu sehen ist ihr Kopf, wobei der oberste Teil des Scheitels sozusagen durch den Bildrand abgeschnitten ist, ihr gesamter Oberkörper und ihre Arme, wobei bei Letzteren nur der rechte Ellenbogen fehlt. Außerdem enden ihre Beine kurz oberhalb der Knie, alles darunter befindet sich außerhalb des Blickfeldes. Gekleidet ist das Mädchen in ein weißes Kleid, welches unterhalb der Brust tailliert ist. Der Ausschnitt des Kleidungsstückes ist weiter, als man es vielleicht bei einem Mädchen ihres Alters erwarten würde, und die Träger desselben fallen durch ihre besondere Form, welche vor allem bei dem rechten an Engelsflügel erinnern, auf. Das Kleid endet kurz unterhalb des Schrittes des Mädchens, wobei erkennbar ist, dass es eigentlich länger ist, da es auf der linken Seite zu einem unnatürlich wirkenden Knäul verknotet ist. Des Weiteren trägt das Mädchen eine ebenfalls aus weißem Stoff bestehende Augenbinde, welche ihre Augen komplett, und den Großteil ihrer Stirn bedeckt. Die Binde ist an der Stelle über dem linken Auge des Mädchens blutdurchtränkt, was den Eindruck erzeugt, dass das darunterliegende Auge ebenfalls blutig ist. Die strohblonden Haare des Mädchens sind über der Binde zu einem zotteligen, leicht verwahrlost wirkenden Pony geschnitten, und zu zwei Zöpfen geflochten, welche ihr knapp bis auf die Schultern reichen. Der rechte Zopf, welcher ihr über die Schulter fällt, wird von einem hellblauen Zopfgummi gehalten. Die rein körperlichen Merkmale wirken noch einmal bizarrer als die Kleidung des Mädchens. Seine Proportionen erscheinen seltsam verzerrt, so wirkt beispielsweise der Oberkörper viel zu lang für den Rest und scheint, wenn überhaupt, eher zu einer ausgewachsenen Frau als zu einem jungen Mädchen zu gehören. Auch das Schlüsselbein erscheint seltsam hervorstechend, was dem sonst wohlgenährten Körper eine abgemagerte Note verleiht. Ebenfalls unnatürlich erwachsen wirkt das Gesicht des Mädchens, welches durch ein sehr stark ausgeprägtes, sogenanntes Kinngrübchen dominiert wird, wie man es in dieser Art bei so einem jungen Alter eigentlich nie vorfindet. Der Gesichtsausdruck des Mädchens, welcher lediglich durch den Mund ausgedrückt wird, lasst sich nur mit dem Adjektiv ernst beschreiben. Lediglich Trauer könnte man in diesem Zusammenhang als eine weitere mögliche Emotion nennen. In den Händen hält das Mädchen ein Messer mit einer stählernen Klinge und einem Griff aus Holz sowie einen roten Apfel. Mit dem Messer in der rechten Hand schält sie den Apfel so, dass eine lange Schlange entsteht. Allerdings fällt auf, dass das Mädchen das Messer in einem eigentlich falschen Winkel hält, um den Apfel in einer solchen Weise zu schälen. So zeigt die scharfe Schneide eher direkt zu dem Mädchen hin, als das sie, wie es eigentlich logisch wäre, parallel zu dem Apfel steht.
Die zwei anderen Objekte in dem Bild sind zwei Vögel, welche keine auf den ersten Blick offensichtliche Charakteristika haben, die sie einer bestimmten Vogelart zuordnen würden (siehe auch 5.3. Die Vögel). Sie sind braun gefärbt, wobei sie von einem hellbraunen, fast beigen Bauch bis hin zu bernsteinfarbenen Schwanzfedern verschiedene Schattierungen von Braun aufweisen. Besonders eindrücklich sind an dieser Stelle die dunkelbraunen, fast roten Augen der Vögel. Der obere Vogel sitzt auf dem linken Oberarm des Mädchens und schaut zu dem unteren, zweiten Vogel hinab. Hierbei auffällig ist, dass er sich mit seinen scheinbar überproportionierten Klauen regelrecht in den Arm des Mädchens krallt, und dieses diesen zweifellos schmerzhaften Umstand scheinbar nicht wahrnimmt, als wären die Vögel lediglich Geister und keine Lebewesen aus Fleisch und Blut. Der untere Vogel befindet sich im Flug und hat dem entsprechend seine Schwingen weit ausgebreitet. In seinem Schnabel hält er eine bereits abgeschälte „Apfelschalenschlange“, welche er zusätzlich mit seinen beiden Klauen sichert. Doch das eindrücklichste an diesem Vogel ist sein Blick, welcher den Betrachter genau ins Auge gefasst zu haben scheint. Somit ist dieser Vogel im Bild der einzige Gegenstand, der die Barriere zwischen Werk und Betrachter durchbricht und diesen in das Bild miteinbezieht. Die gesamte oben beschriebene Szene findet sich vor einem tristen, schwarz-grau mattiertem Hintergrund wieder, welcher in keiner Weise den Blick des Betrachters anzieht. Dieser Umstand erlaubt, dass der Fokus des Betrachters ganz und gar auf dem Hauptmotiv des Bildes, das Mädchen mit den Vögeln, liegt.
3. Formale Bildanalyse
Das Werk von Dorothea Weise scheint bestimmt zu sein von einer verzerrten, bizarren, aber auf den ersten Blick dennoch vertrauten Variante der Wirklichkeit. Nichts scheint zu passen, und dennoch ergibt alles zusammen ein großes Ganzes. So wirkt das Mädchen, das zentrale Motiv des Bildes, auf den ersten Blick normal und abgesehen von der absonderlichen Kleidung und der blutigen Augenbinde doch irgendwie natürlich. Doch je länger man es ansieht, desto mehr Unstimmigkeiten nimmt man wahr. Der Oberkörper erscheint zu lang im Verhältnis zu dem Rest, der linke Arm will nicht recht zu dem rechten passen, die hervorstechenden Schlüsselbeine widersprechen dem restlichen Körperbau und das stark ausgeprägte Kinngrübchen dem jungen Alter des Mädchens. Auch bei den Vögeln scheint nicht alles zu passen. Die beinahe schon monströsen Klauen des oberen Vogels wollen nicht zu dessen ansonsten zierlichen, athletischen Körperbau passen.
Auch die Interaktion, die Beziehung zwischen den einzelnen Motiven, scheint dem ersten Eindruck zu widersprechen. Die beiden Vögel scheinen gemeinsam mit dem Betrachter eine Art Interaktionsdreieck zu bilden. So schaut der obere Vogel auf den unteren herab, während dieser den Betrachter genau anzusehen scheint. Und löst der Betrachter sich von dem intensiven Blick des unteren Vogels, scheint ihn plötzlich auch der obere Vogel, zumindest aus den Augenwinkeln, zu beobachten. Im Kontrast zu dieser Interaktion steht die Beziehung zwischen den Vögeln und dem Mädchen, da sie einander quasi nicht wahrnehmen, als ob sich die beiden Parteien in unterschiedlichen Dimensionsschichten befinden würden. Zwar gibt es Kontaktpunkte zwischen einander, wie beispielsweise, dass der eine Vogel bei dem Mädchen auf dem Arm sitzt, aber darüber hinaus gibt es keinerlei Anzeichen eines gegenseitigen Registrierens.
Die Farbwahl des Bildes lässt sich am ehesten mit natürlich beschreiben. Die Künstlerin hat zwar ausschließlich mit knalligen, intensiven Farben gearbeitet, allerdings fügen sich diese zu einem harmonischen Bild zusammen. Diese knalligen Farben heben sich sehr stark von dem schwarz-grauen Hintergrund ab, wodurch der Fokus des Betrachters ganz auf das Motives gelenkt und der Hintergrund unbedeutend wird. Das Vorherrschen von verschiedenen Braunnuancen und Weißtönen vermittelt einen unberührten und beinahe unschuldigen, naturbelassenen Eindruck. Mit dem knalligen Rot und auch Gelb sticht der Apfel aus der Farbkomposition heraus, allerdings gehören diese Farben genauso wie die anderen zu dem Farbrepertoire der Natur, weshalb sie sich ebenso unkompliziert in das Gesamtbild einfügen. Ganz anders sieht es da schon mit dem hellblauen Haargummi des Mädchens aus, Dieser drängt sich einen geradezu in den Blick, da er vollkommen aus diesem naturbelassenen, ursprünglichen Umfeld heraussticht. Der blaue Haargummi ist heute ein Gegenstand des alltäglichen Lebens, doch in dieses Bild will er nicht so recht passen, und genau deshalb hat er eine so zentreale Rolle in dem Bild. Ohne ihn könnte die Szene in dem Werk vor hundert Jahren, vor zweihundert Jahren oder auch vor fünfhundert Jahren passiert sein, sie wäre aber auf jeden Fall ein Relikt der Vergangenheit. Doch der kleine, hellblaue Haargummi verändert alles, denn er katapultiert die Szene in dem Werk in das hier und jetzt, in die Gegenwart. Auch wird dem Betrachter dadurch bewusst, dass die Aussage des Bildes nicht obsolet, sondern wahrscheinlich noch brandaktuell ist.
Das Mädchen wird, ebenso wie die Vögel, stark von einer externen, also einer sich nicht in dem Bild befindlichen, Lichtquelle beleuchtet. Bei dieser Lichtquelle handelt es sich wahrscheinlich eher um einen Scheinwerfer als beispielsweise um ein Kaminfeuer, da das Licht kalt und weiß wirkt, was dem ganzen Bild eine beinahe gefühlskalte, unbeteiligte und neutrale Ausstrahlung verleiht. Die Lichtquelle befindet sich höchstwahrscheinlich vor dem Mädchen, allerdings nicht frontal, sondern leicht nach links versetzt. Durch das starke arbeiten mit dunklen Farben, aber vor allem mit den hellen Akzentuierungen, wird außerdem die Räumlichkeit des Bildes erschaffen. So scheint sich der untere Vogel räumlich gesehen vor dem Mädchen zu befinden, welches sich augenscheinlich minimal der Lichtquelle zugewandt hat. Das kalte Licht, der Umstand, dass nicht alles von dem Mädchen abgebildet ist, die Frontalität des Motives, all dies erinnert stark an eine Fotografie, bei dem der Betrachter räumlich nicht in das Geschehen mit integriert, sondern seltsam außen vor ist.
Eine weiter Besonderheit des Bildes ist seine Beziehung zu Raum und Zeit. Trotz dem Umstand, dass es durchaus Bewegung in den Motiven gibt, beispielsweise der fliegende Vogel, oder das Messer, das den Apfel schält, hat das Bild etwas Starres, Unflexibles. Nicht so, als hätte man wie mit einem Foto den Moment festgehalten, sondern als wäre alles schon vor langer Zeit einfach in dieser Position erstarrt und die Künstlerin hätte alle Zeit der Welt gehabt, jedes Detail aus jeder Perspektive zu studieren um es dann auf Papier zu bringen.
4. Das Apfelorakel
Wenn man sich mit einem Werk beschäftigt, ist es immer wichtig, sich auch mit seinem Titel auseinanderzusetzten. Denn durch ihn kommuniziert der Künstler mit dem Beobachter. Der Titel ist seine persönliche Stellungnahme zu dem Werk. Er soll die Gedanken des Beobachters beim Betrachten des Werkes in die richtige Richtung lenken und gibt ihnen somit sowohl eine Orientierungshilfe als auch einen eingrenzenden Rahmen. Diese Orientierungshilfe gibt auch Dorothea Weise, indem sie ihrem Werk den Titel Das Apfelorakel verliehen hat.
Bei dem Wort Apfelorakel handelt es sich keinesfalls um ein Kunstwort, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte. Das Apfelorakel ist ein Volksbrauch, welcher in vielen Ländern weit verbreitet ist und zu den ältesten Orakeln der Welt zählt.1 Dass dem Apfel erkenntnisschaffende und hellseherische Fähigkeiten nachgesagt werden, geht bereits auf die biblische Schöpfungsgeschichte, die Genesis, zurück. In dieser steht geschrieben, dass Eva durch das Essen eines Apfels vom Baum der Erkenntnis zur selbigen gelangt ist (siehe auch 5.1. Der Apfel).2
Bei dem Begriff Apfelorakel handelt es sich um einen Oberbegriff, unter welchem viele verschiedene Bräuche der Zukunftsvorhersage mit Äpfeln zusammengefasst werden. Die jeweilige konkrete Vorgehensweise ist dabei stark von der Herkunft, also der Region, dem gesellschaftlichem Setting und dem Zeitpunkt im Jahr abhängig. Die üblichen Tage, oder besser gesagt Nächte, an denen das Apfelorakel, in welcher Form auch immer, traditionell befragt wird, sind die Sankt-Andreas-Nacht vom 29. auf den 30. November3 und Sylvester, die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Beide Tage haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam, doch bei historischer Betrachtung wird schnell klar, dass es sich bei beiden Nächten um den Übergang von einem Jahr auf das andere handelt. Sylvester ist in der heutigen westlichen Welt der Übergang von einem kalendarischen Jahr zu dem nächsten. Und die Sankt-Andreas Nacht ist offiziell das Ende des kirchlichen Jahres und läutet das Nächste Jahr, beginnend mit der Adventszeit, ein.4 Gerade in früheren Zeiten war die Sankt-Andreas-Nacht ein ähnliches Ereignis wie Silvester heute.5 Im Volksmund wird diese besondere Nacht auch Losnacht, die Nacht der Wahrsagerei und Vorhersage, genannt.6 Am weitesten verbreitet waren in diesem Zusammenhang Liebes- und Heiratsorakel.7 Auch dies lässt sich erklären, da der Apfel im allgemeinen als die „paradiesische Frucht der Versuchung“ galt (siehe auch 5.1. Der Apfel).8
Das Apfelorakel, welches in dem Werk von Dorothea Weise abgebildet ist, ist jener Brauch, der in der Losnacht am großflächigsten verbreitet war und auch noch ist.9 Bei dieser speziellen Form des Apfelorakels wird ein Apfel kurz vor dem Jahreswechsel so geschält, dass die Schale an einem Stück bleibt und am Ende eine lange Schlange ergibt.10 Anschließend wird die Schale über die Schulter hinter sich geworfen.11 Von der Form ausgehend, wie diese auf dem Boden zu liegen kommt, soll man den Anfangsbuchstaben seines zukünftigen Partners erkennen können.12 Auch diese Form des Brauches wurde vor allem von jungen, heiratswilligen Mädchen ausgeführt.13
Um noch einmal den sprichwörtlichen Blick über den Tellerrand zu werfen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass es noch eine Vielzahl weiterer Bräuche rund um das Apfelorakel, sowohl in Verbindung mit einem Jahreswechsel als auch davon losgelöst, gibt. So glaubte man zum Beispiel vor allem in England und auch Süddeutschland früher daran, dass man mithilfe von Äpfeln in die Zukunft sehen könne.14 In Tschechien ist der Silvesterbrauch besonders weit verbreitet, dass jeder kurz vor Mitternacht einen Apfel halbiert, sodass ein Querschnitt des Kerngehäuses entsteht.15 Dies soll einem einen kurzen Blick in die Zukunft gewähren.16 Hat das Kerngehäuse die Form eines Kreuzes, so kündigt sich Unheil an, doch hat es die Form eines Sternes, so startet man gesund und vom Glück gesegnet ins neue Jahr.17 Weitere Bräuche waren beispielsweise die Beantwortung einer einfachen Ja-oder-Nein-Frage durch das Abzählen der Kerne im Kerngehäuse18 oder auch der Glaube, mithilfe eines Apfels in der Nacht von seinem zukünftigen Ehemann zu träumen19.
5. Symboliken in Kunst und Gesellschaft
Die zentralen Stilmittel in dem Werk Das Apfelorakel sind Symbole. Deshalb ist essentiell, sich genauer mit diesen Symbolen zu beschäftigen, um ein Verständnis für die Aussage des Bildes zu bekommen. Zu diesem Zwecke werden auf den folgenden Seiten die wichtigsten Symbole des Werkes aufgeschlüsselt und unter der Lupe der allgemeinen Symbolbedeutung betrachtet.
5.1. Der Apfel
Der Apfel ist ein zentrales Motiv des Werkes von Dorothea Weise und in seinen, meist historischen, Symbolbedeutungen wohl eines der vielfältigsten und ambivalentesten Symbole der westlichen Welt.20 Er steht für ewige Jugend, Weiblichkeit, Verführung, aber auch für Zwietracht, Macht und Ewigkeit, um hier nur ein paar seiner zahlreichen Bedeutungen zu nennen. Ihre Ursprünge haben diese in volkstümlichen Märchen und Sagen ebenso wie in heidnischen Mythen und biblischen Geschichten.21 Im Folgenden werden eben jene wichtigsten Symboliken des Apfels kurz erläutert, um ein umfassendes Verständnis für die Vielschichtigkeit des Apfels als Symbol zu vermitteln.
Die Darstellung der Jugend mithilfe der Allegorie des Apfels stammt vor allem aus den Mythen Skandinaviens und des antiken Griechenlands.22 In letzteren übergab der Erzählung nach die Urgöttin Gaia dem Göttervater Zeus und seiner Gemahlin Hera goldene Äpfel als Hochzeitsgeschenk mit dem Versprechen, dass, wer von ihnen isst, nie wieder Hunger, Durst noch Leid und Krankheit erfahren muss.23 In der keltischen Mythologie wird Lug, einer der wichtigsten Götter, immer mit drei Äpfeln dargestellt, welche die Unsterblichkeit, die Macht und den Wohlstand der Götter symbolisieren sollen. Und in der skandinavischen Mythologie wacht die Göttin Iðunn (Iduna) über die sogenannten Äpfel der Unsterblichkeit, die Nahrung der Götter.24
Die Symbolik der Weiblichkeit und Fruchtbarkeit findet sich vor allem in der griechischen Mythologie wieder.25 In dieser wurden die zahlreichen Liebesgöttinnen stets mit einem Korb voller Äpfel dargestellt. Und Dionyssios, der Gott der Fruchtbarkeit, galt als der Schöpfer des Apfelbaumes.26 Den Überlieferungen nach widmete er Aphrodite, der Göttin der Liebe, der Schönheit und der Sinneslust, den Apfel als Sinnbild für ihre Schönheit.27 Neben der griechischen Mythologie wurde der Apfel auch in anderen Kulturen als Symbol der Weiblichkeit, der sinnlichen Reize und der Begierde angesehen.28 Dieses fußte vor allem auf der äußeren Erscheinung der Frucht, so wurde die runde Form der Äpfel mit den weiblichen Brüsten, und die Form des Kerngehäuses mit der Vulva verglichen.29
Aus der griechischen Mythologie geht ebenfalls die Assoziation des Apfels mit der Zwietracht hervor, da der Trojanische Krieg im weitesten Sinne durch einen Apfel ausgelöst wurde.30 Eris, ihrerseits die Göttin der Zwietracht, versteckte aus Wut darüber, nicht eingeladen geworden zu sein, auf dem Hochzeitsmahl der Götter Thetis und Peleus einen Apfel mit der Widmung „Für die Schönste“.31 Daraufhin entstand ein großer Streit unter den Göttern, denn wer sollte diesen Apfel nun bekommen?32 Schließlich sollte Paris entscheiden und er verschenkte den Apfel an Aphrodite, allerdings hatte diese ihm vorher im Austausch die schöne Helena zur Frau versprochen.33 Und durch die daraus resultierende Liebschaft zwischen Paris und Helena wurde letztendlich der Trojanische Krieg ausgelöst.34 Aber nicht nur in der griechischen Mythologie, sondern auch in volkstümlichen Märchen lässt sich der Apfel in Verbindung mit der Zwietracht wiederfinden. So wurde zum Beispiel Schneewittchen durch eine List mit einem vergifteten Apfel vergiftet.35 Diese negativen Assoziationen mit dem Apfel wurden auch in die Sprache übernommen, so kann das lateinische Wort malus sowohl schlecht, schlimm oder böse als auch Apfel bedeuten.36
Eine weitere negative Belegung des Apfels entstand durch die Schöpfungsgeschichte des christlichen Glaubens.37 In dieser werden Adam und Eva aus dem Paradies verbannt, als Eva die „verbotene Frucht“ vom sogenannten Baum der Erkenntnis, der Überlieferung nach ein Apfelbaum“, gekostet hat.38 Aus diesem Grund steht der Apfel in diesem Kontext für den menschlichen Sündenverfall.39
[...]
1 Vgl. Rückert, Andrea.
2 Vgl. Kein Autor. Apfel – Symbol von Schönheit und Zwist.
3 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
4 Vgl. Kein Autor. Andreastag. Brauchwiki.de.
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
8 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Starlight24.
9 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
10 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
11 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
12 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
13 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
14 Vgl. Kein Autor. Apfelorakel. Viatarot.
15 Vgl. Rückert, Andrea.
16 Vgl. Rückert, Andrea.
17 Vgl. Rückert, Andrea.
18 Vgl. Pusteblume 1990.
19 Vgl. Nußbaum, Margret und Zimmermann, Steffen.
20 Vgl. Kein Autor. Apfel – Symbol von Schönheit und Zwist.
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Ebd.
24 Ebd.
25 Vgl. Kein Autor. Apfel als Symbol – Zwischen Sündenfall und Weltherrschaft.
26 Ebd.
27 Vgl. Kein Autor. Apfel als Symbol – Zwischen Sündenfall und Weltherrschaft.
28 Vgl. Hartman, P.W.
29 Ebd.
30 Vgl. Kein Autor. Apfel – Symbol von Schönheit und Zwist.
31 Ebd.
32 Ebd.
33 Ebd.
34 Ebd.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Ebd.
38 Ebd.
39 Ebd.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Werk "Das Apfelorakel"?
Das Bild der Künstlerin Dorothea Weise thematisiert das komplexe Verhältnis des Menschen zur Zukunft mithilfe vielschichtiger Symbolik.
Welche Bedeutung hat der Apfel im Bild?
Der Apfel steht im Kontext des Orakels für das Streben nach Wissen über das Unbekannte, wobei das Schälen eine Form der Vorhersage symbolisiert.
Was symbolisiert die blutige Augenbinde des Mädchens?
Die Augenbinde verweist auf die Blindheit gegenüber der Zukunft, während das Blut eine Verletzlichkeit oder die Gefahr des Wissens andeutet.
Welche Rolle spielen die Vögel in der Komposition?
Die Vögel wirken teils geisterhaft und durchbrechen die Barriere zum Betrachter, was die Unfassbarkeit und Allgegenwärtigkeit der Zukunft unterstreicht.
Wie wird das Mädchen im Werk dargestellt?
Das Mädchen erscheint bizarr und unnatürlich proportioniert, was eine ernste, fast verstörende Atmosphäre erzeugt und philosophische Fragen aufwirft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Das Verhältnis zwischen Mensch und Zukunft in Dorothea Weises "Das Apfelorakel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1298458