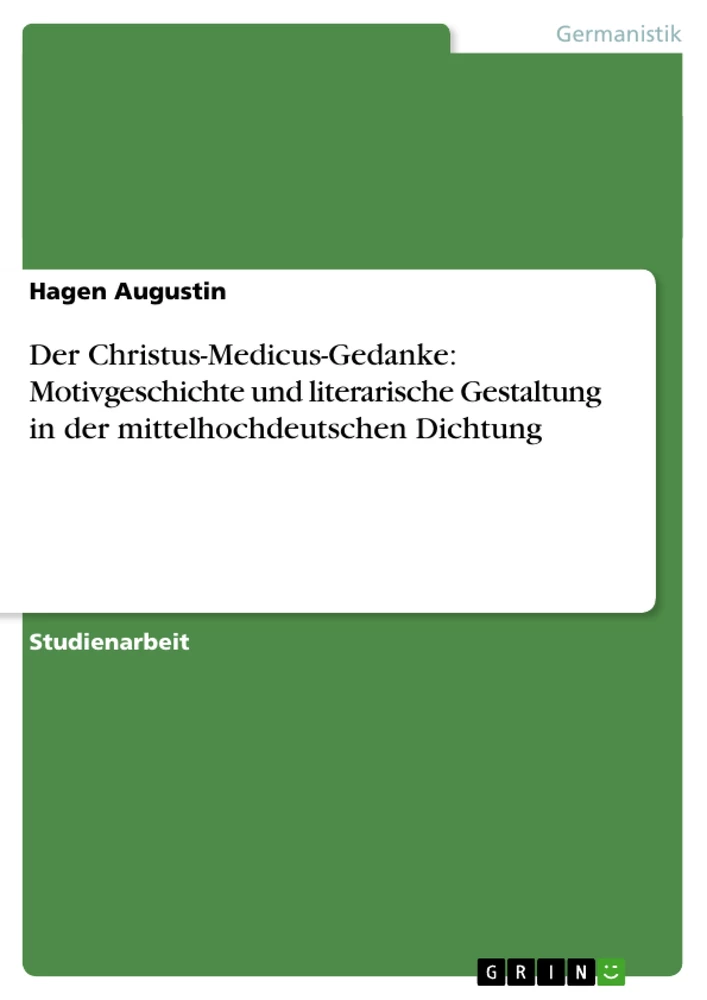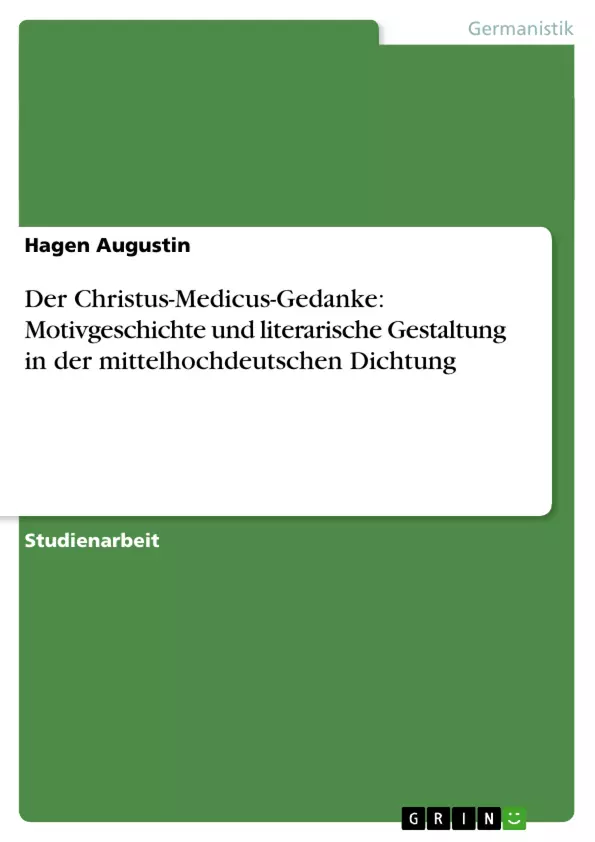Einleitung
Der Christus-Medicus-Gedanke, wie er immer wieder in theologischen und medizinischen Schriften des Mittelalters, aber auch in der poetischen Literatur (wie z.B. bei Hartmann von Aue) vorkommt, hat seine Wurzeln schon in der frühsten, vorchristlichen Zeit der kulturgeschichtlichen Anfänge des Abendlandes. Ziel dieser Arbeit ist es sowohl die philosophisch-religiösen, wie auch die kultisch-rituellen Aspekte des Heilgottglaubens in ihrer historischen Kontinuität von der heidnischen Antike bis zur christlichen Neuzeit darzustellen, wie es im Rahmen des Umfangs einer Hausarbeit möglich ist. Besonders berücksichtigt soll hier die poetische Ausgestaltung des Christus-Medicus-Gedanken in „Der arme Heinrich“ von Hartmann von Aue werden.
Die in Kapitel 1 vorgestellten Grundlagen mythologischer, medizinhistorischer und wissenschaftsgeschichtlicher Natur sollen die nötigen Hintergründe liefern um die These von der ununterbrochenen Präsenz eines Heilgottglaubens in der abendländischen Kultur zu untermauern. Kapitel 2 soll die Genese des Christus- Medicus-Gedanken näher beschreiben und Kapitel 3 der Hausarbeit beschäftigt sich mit der literarischen Gestaltung des Motivs in der deutschen poetischen Literatur des Mittelalters unter besonderer Berücksichtigung Hartmanns von Aue.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- latrotheologie und theurgische Medizin
- Asklepios
- Theurgische Praxis des Asklepios-Kultes
- Apollo Medicus
- Kulturhistorische Wurzeln der medizinischen Erkenntnisgewinnung
- Christus Medicus
- Der Christus-Medicus-Gedanke in Hartmanns „Der arme Heinrich“ und anderen Werken mittelhochdeutscher Dichtung.
- Hartmanns von Aue „Der arme Heinrich“
- Prüfung oder Strafe Gottes?
- Heinrichs Heilung
- Weitere Beispiele
- Konrads von Würzburg „Engelhard“
- Konrads von Würzburg „Silvester“
- Wolframs von Eschenbach „Parzival“
- Erzählstruktur und Christus-Medicus-Gedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Erforschung des Christus-Medicus-Gedanken in seiner historischen Entwicklung und seiner literarischen Gestaltung in der mittelhochdeutschen Dichtung. Sie verfolgt das Ziel, die philosophisch-religiösen und kultisch-rituellen Aspekte des Heilgottglaubens von der heidnischen Antike bis zur christlichen Neuzeit zu beleuchten. Im Zentrum steht dabei die Analyse von Hartmanns von Aue's „Der arme Heinrich“ als exemplarischem Beispiel für die literarische Ausgestaltung dieses Motivs.
- Die historischen Wurzeln des Heilgottglaubens in der Antike
- Die Entwicklung des Christus-Medicus-Gedanken im frühen Christentum
- Die literarische Gestaltung des Motivs in der mittelhochdeutschen Dichtung
- Die Rolle von Krankheit und Heilung als Metaphern für spirituelle Prozesse
- Die Verbindung von Religion, Medizin und Literatur im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Arbeit und erläutert die Zielsetzung sowie die Gliederung der Kapitel. Kapitel 1 beleuchtet die Grundlagen des Heilgottglaubens in der Antike, indem es die Konzepte der latrotheologie und der theurgischen Medizin sowie die Heilkulte des Asklepios und Apollons behandelt. Kapitel 2 widmet sich der Genese des Christus-Medicus-Gedanken im frühen Christentum. Kapitel 3 analysiert die literarische Gestaltung des Motivs in der mittelhochdeutschen Dichtung, mit besonderem Fokus auf Hartmanns von Aue's „Der arme Heinrich“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Christus-Medicus-Gedanken, der latrotheologie, der theurgischen Medizin, dem Asklepios-Heilkult, dem Apollo-Heilkult, der mittelhochdeutschen Dichtung, Hartmann von Aue, „Der arme Heinrich“, Krankheit, Heilung, Religion, Medizin, Literatur, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Christus-Medicus-Gedanke“?
Es ist das theologische Motiv von Christus als dem wahren Arzt, der nicht nur körperliche, sondern vor allem seelische Krankheiten heilt.
Welche antiken Wurzeln hat dieses Motiv?
Das Motiv knüpft an heidnische Heilgötter wie Asklepios und Apollo Medicus an und transformiert deren Eigenschaften in den christlichen Kontext.
Wie wird das Motiv in „Der arme Heinrich“ gestaltet?
Hartmann von Aue nutzt die Krankheit Aussatz als Strafe oder Prüfung, wobei die Heilung Heinrichs untrennbar mit seiner spirituellen Wandlung verknüpft ist.
Was ist theurgische Medizin?
Es handelt sich um eine religiös-kultische Heilpraxis, bei der Heilung durch göttliches Eingreifen oder rituelle Handlungen (z.B. im Asklepios-Kult) erwartet wird.
In welchen anderen Werken kommt das Motiv vor?
Die Arbeit nennt Beispiele aus Konrads von Würzburg „Engelhard“ und „Silvester“ sowie Wolframs von Eschenbach „Parzival“.
- Quote paper
- Hagen Augustin (Author), 2003, Der Christus-Medicus-Gedanke: Motivgeschichte und literarische Gestaltung in der mittelhochdeutschen Dichtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13037