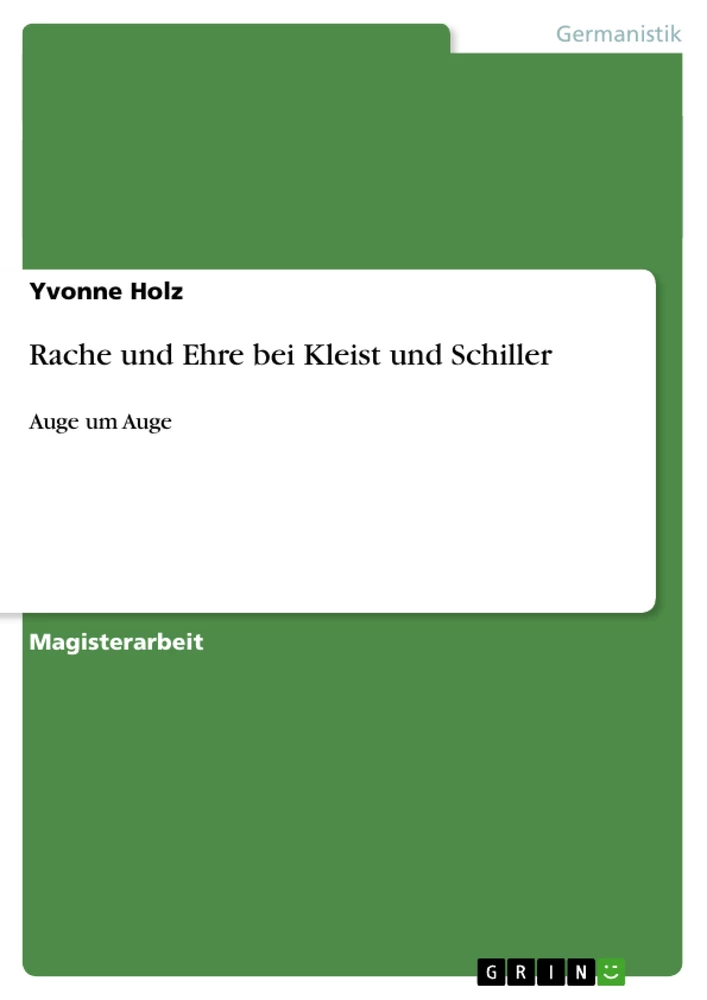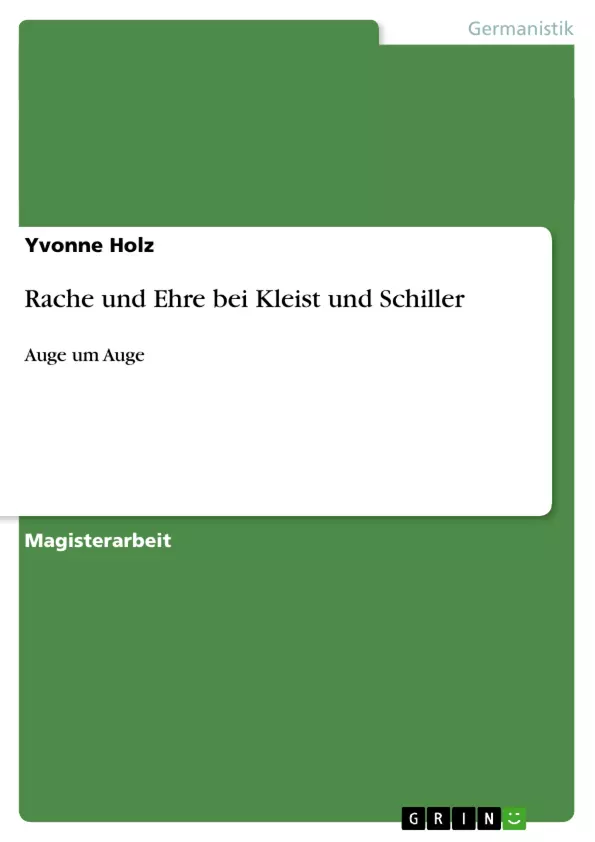„Was ist Ehre? – ein Wort.“ Das meint Shakespeare. Das Wort Ehre ist eng verbunden mit dem Ermessen anderer. Das heißt, Dritte beurteilen, was als ehrenvolles Verhalten und Handeln erachtet wird und was nicht. Ehre, als das Ansehen und die Anerkennung, die einem von anderen zuteil wird, bestimmt in großem Maße unsere Identität und unsere Stellung in der Gesellschaft. Heute scheint die Ehre als Normsystem keine allumfassende Bedeutung mehr zu haben. Sie kommt gegenwärtig nicht mehr explizit zur Sprache. Gleichwohl spiegelt sie sich immer dann wieder, wenn z.B. von „Image“ oder dem „guten Ruf“ die Rede ist. Der verbürgte Leumund einer Person oder Institution macht sie glaub- und vertrauenswürdig sowie achtbar. Von einer Bank zum Beispiel, die sich durch die eben dargelegten Attribute auszeichnet, lässt man sich lieber in Kreditfragen beraten als von einem Wucherer. Verliert jemand seine Ehre durch unehrenhaftes Handeln, wie z.B. dem Wuchern oder dem Begehen einer Straftat, wird er von der Gesellschaft geächtet und sozial ausgegrenzt. Er verliert buchstäblich sein Gesicht – beim Ehrverlust wird daher auch von Gesichtsverlust gesprochen – und ist somit nicht länger ein Teil der Gemeinschaft, sondern ein ausgestoßener Sonderling.
Kleists Michael Kohlhaas und Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre , namentlich Christian Wolf, sind zwei dieser Ehrlosen. Sie fallen aufgrund verletzter bzw. verlorener Ehre dem Mord und Diebstahl; kurz dem Verbrechen anheim. Enttäuscht vom Rechtssystem, das ihr Unglück maßgeblich mit verschuldet, nehmen sie das Recht selbst in die Hand. Als Rächer und Selbsthelfer üben sie Vergeltung an Justiz und Obrigkeit für ihr erlittenes Unrecht.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der vergleichenden Gegenüberstellung der obengenannten Erzählungen Kleists und Schillers unter besonderer Berücksichtigung der Frage nach den funktionalen und wirkungs-dimensionalen Bedeutungsbeziehungen von Rache und Ehre. Diese Fragestellung wird sowohl innerhalb des jeweils einzelnen Werkes als auch im Verhältnis zum jeweils anderen Werk betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedrich Schiller: Der Verbrecher aus verlorener Ehre
- Entstehungs- und Stoffgeschichte
- Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas
- Entstehungs- und Stoffgeschichte
- Ehre Recht - Rache
- Ehre und Rache
- Ehre und Recht
- Rache und Recht
- Kleist und Schiller als Rächer des Rechts
- Struktur
- Erzählstrategie und Sprache
- Charakteristika der Hauptfiguren
- ,,Sprechende❝ Namen
- Profile der Rächer
- Unehrliche Leute
- Adressaten der Rache
- Abschließende Betrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert und vergleicht die Erzählungen „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ von Friedrich Schiller und „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist. Im Fokus steht die Beziehung zwischen Ehre, Recht und Rache, die in beiden Werken eine zentrale Rolle spielt. Die Arbeit untersucht die psychologischen, religiösen und sozial-gesellschaftlichen Aspekte dieser Begriffe und beleuchtet die Justizkritik der beiden Autoren.
- Die Rolle von Ehre und Recht in der Gesellschaft
- Die Motivationen und Folgen von Rache
- Die Kritik am Rechtssystem und die Suche nach Gerechtigkeit
- Die Charakterisierung der Hauptfiguren als Rächer und Verbrecher
- Die Erzählstrategien und sprachlichen Besonderheiten der beiden Werke
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Ehre und Rache ein und stellt die beiden Werke von Schiller und Kleist vor. Anschließend werden die Entstehungs- und Stoffgeschichten der beiden Erzählungen beleuchtet. Dabei wird auf die historischen und literarischen Hintergründe sowie die Motivationen der Autoren eingegangen.
Im nächsten Abschnitt wird die Begriffs-Triade von Ehre, Recht und Rache analysiert. Die einzelnen Begriffe werden in ihren Bedeutungsbeziehungen zueinander untersucht und die psychologischen, religiösen sowie sozial-gesellschaftlichen Aspekte beleuchtet.
Die Arbeit geht dann auf die Beziehung der beiden Autoren zum Recht und ihre Justizkritik ein. Dabei wird die Frage untersucht, wie Schiller und Kleist das Rechtssystem kritisieren und welche Alternativen sie anbieten.
Im Folgenden werden die Struktur, Erzählstrategie und Sprache der beiden Werke analysiert. Dabei wird der Fokus auf den funktionalen Zusammenhang zwischen den narrativen Strukturmerkmalen und den Leitbegriffen von Rache und Ehre gelegt.
Das Kapitel über die Charakteristika der Hauptfiguren befasst sich mit den Profilen der Rächer und den „unehrlichen Leuten“. Die Analyse der sprechenden Namen und der Figurenrollen soll die Titelfiguren in ihrer Rolle als ehrlose Verbrecher umfassend charakterisieren.
Abschließend werden die Adressaten von Kohlhaas` und Wolfs Rache näher betrachtet. Die Arbeit untersucht, an wen sich die Rache richtet und welche Auswirkungen sie hat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Ehre, Recht, Rache, Justizkritik, Verbrecher, Rächer, Selbstjustiz, Gesellschaft, Psychologie, Religion, Literaturvergleich, Friedrich Schiller, Heinrich von Kleist, Der Verbrecher aus verlorener Ehre, Michael Kohlhaas.
- Quote paper
- Magister Artium Yvonne Holz (Author), 2008, Rache und Ehre bei Kleist und Schiller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130772