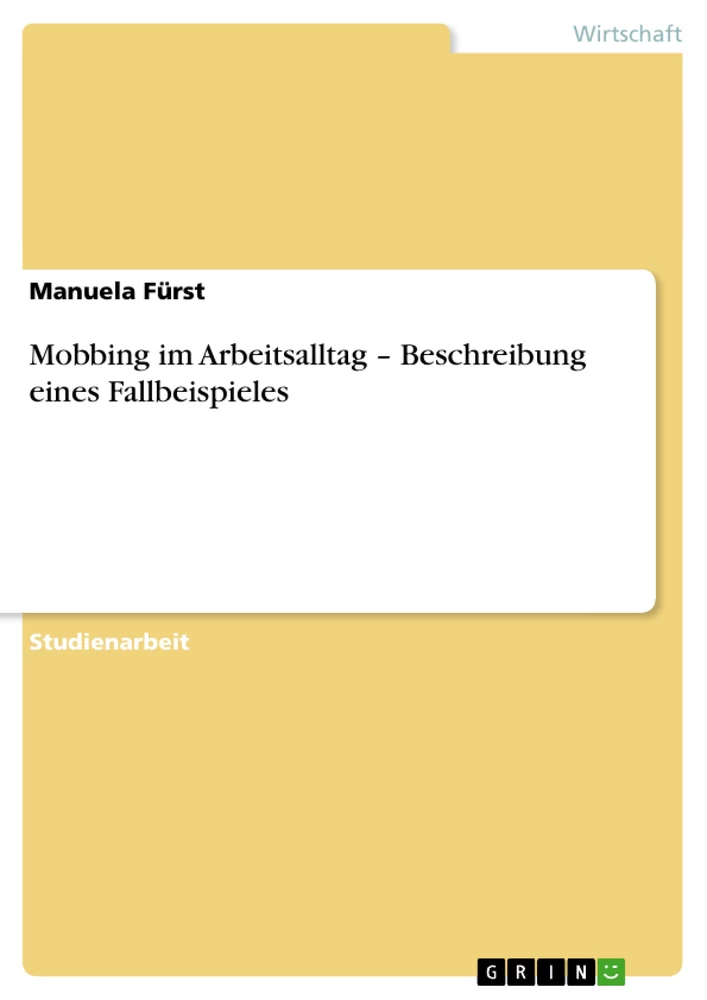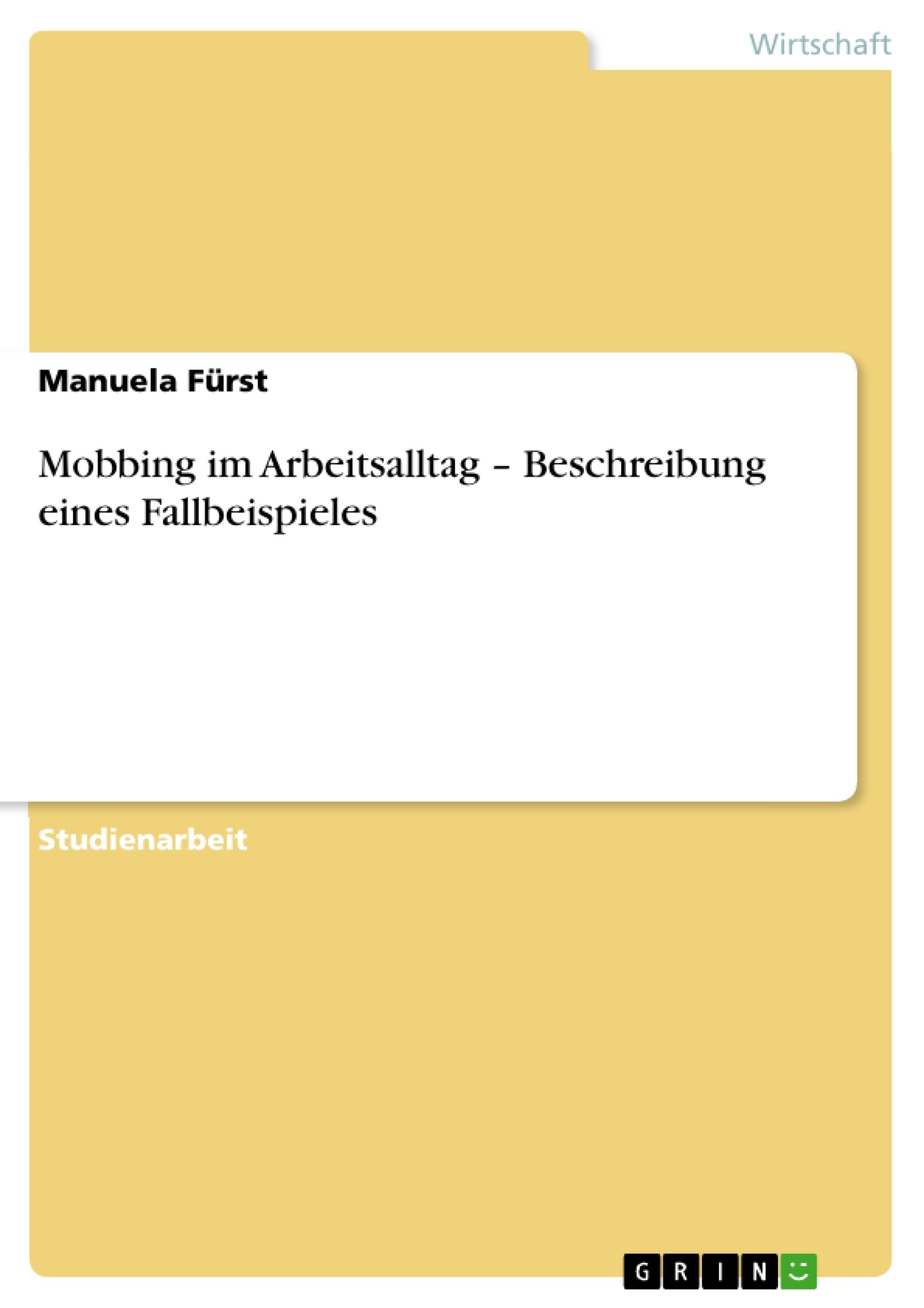Heinz Leymann, einer der bekanntesten Mobbingforscher, begann Ende der 70er Jahre mit seinen Forschungen. Er prägte den Begriff Mobbing, welcher 1991 bekannt wurde (vgl. HERMANS/KRINGS 2004, 21f.).
Als das Thema Mobbing aufkam, ging man davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt. Untersuchungen aber ergaben, dass cirka sieben Prozent aller Arbeitnehmer Mobbingbetroffene sind. Mobbing tritt vor allem in mittleren und größeren Unternehmen auf (vgl. ESSER u.a. 1999, 33 f.).
In den letzten Jahren haben sich die Belastungen am Arbeitsplatz verändert. Die Faktoren wie Hektik und Anspannung sind deutlich gestiegen. Die Erschwernisse am Arbeitsplatz haben sich von körperlichen hin zu psychischen bewegt. Immer öfter entstehen Auseinandersetzungen, die in den häufigsten Fällen auf Neid und Missgunst zurückzuführen sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von negativer Kommunikation (vgl. VOLK 2004, 1).
Ein häufiges Vorurteil ist, dass Mobbing hauptsächlich unter Frauen auftritt. Dies ist falsch, denn die Untersuchungen belegen, dass Mobbingfälle Frauen und Männer gleichermaßen betreffen. Häufig sind die jüngeren Arbeitnehmer die Mobbingbetroffenen, da sie noch nicht fest in ein Unternehmen integriert sind und ihre Karrierechancen den anderen Kollegen missfallen (vgl. ESSER u.a 1999, 33 f.).
Auch im Unternehmen im Fallbeispiel, welches ich mit Unternehmen X bezeichne, gewinnt Mobbing immer mehr an Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist Mobbing?
- 2.1 Der Unterschied zwischen Mobbing und Konflikten
- 2.2 Ab wann ist es Mobbing?
- 2.3 45-er Liste von Leymann
- 2.3.1 Angriffe auf die Möglichkeit sich mitzuteilen
- 2.3.2 Angriffe auf die sozialen Beziehungen
- 2.3.3 Auswirkungen auf das soziale Ansehen
- 2.3.4 Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation
- 2.3.5 Angriffe auf die Gesundheit
- 3 Phasen von Mobbing
- 3.1 Die Entstehung von Mobbing
- 3.2 Wie Mobbing erfolgt
- 3.3 Praxisbeispiele für Mobbinghandlungen
- 3.3.1 Ignoranz
- 3.3.2 Informationen werden zurückgehalten
- 3.3.3 Aufgabengebiete werden von anderen Kollegen übernommen
- 4 Wie können Mobbingbetroffene reagieren?
- 5 Die Folgen von Mobbing
- 5.1 Die Folgen für den Mobbingbetroffenen
- 5.2 Die Folgen für das Unternehmen
- 6 Wie kann ein Unternehmen Mobbing verhindern?
- 7 Zusammenfassung des Fallbeispieles
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt ein Fallbeispiel von Mobbing am Arbeitsplatz und analysiert die damit verbundenen Aspekte. Ziel ist es, die Problematik von Mobbing aufzuzeigen, die verschiedenen Facetten des Phänomens zu beleuchten und mögliche Reaktions- und Präventionsstrategien zu diskutieren.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing zu Konflikten
- Phasen und Entstehung von Mobbingprozessen
- Auswirkungen von Mobbing auf Betroffene und Unternehmen
- Mögliche Reaktionsmöglichkeiten für Mobbingopfer
- Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Mobbing am Arbeitsplatz
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mobbing ein und beschreibt die Bedeutung des Themas im Kontext der Arbeitswelt. Sie erwähnt die Forschung von Heinz Leymann und die Verbreitung von Mobbing in Unternehmen. Es wird auf die Veränderung der Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz eingegangen, mit einem Fokus auf den Wandel von körperlichen zu psychischen Belastungen und die Rolle von negativer Kommunikation. Schließlich wird das Vorurteil widerlegt, dass Mobbing hauptsächlich unter Frauen vorkommt, und der Fokus auf jüngere Arbeitnehmer als besonders gefährdete Gruppe gelegt. Der Text führt das Fallbeispiel „Unternehmen X“ ein.
2 Was ist Mobbing?: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Mobbing und grenzt es von normalen Konflikten ab. Es stellt die Frage, ab wann eine Situation als Mobbing einzustufen ist, und verwendet die „45-er Liste“ von Leymann, um verschiedene Angriffsformen zu kategorisieren. Diese Angriffe werden in verschiedene Kategorien unterteilt: Angriffe auf die Kommunikation, soziale Beziehungen, das soziale Ansehen, die Berufs- und Lebenssituation und schließlich die Gesundheit. Das Kapitel legt den Schwerpunkt auf die systematische und wiederholte Natur von Mobbinghandlungen.
3 Phasen von Mobbing: Dieses Kapitel beleuchtet die Phasen der Entstehung und des Verlaufs von Mobbing. Es beschreibt die Prozesse, die zu Mobbing führen, und wie Mobbinghandlungen konkret aussehen. Die Beschreibung konkreter Praxisbeispiele wie Ignoranz, Informationszurückhaltung und die Übernahme von Aufgaben durch Kollegen veranschaulicht die verschiedenen Formen von Mobbing. Der Fokus liegt auf der Eskalation und den verschiedenen Ausprägungen des Mobbings.
4 Wie können Mobbingbetroffene reagieren?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Handlungsmöglichkeiten für Betroffene von Mobbing. Es werden verschiedene Optionen vorgestellt, wie die Information des Betriebsarztes, des Vorgesetzten und des Betriebsrats. Zusätzlich wird die Möglichkeit der Beratungsstellen in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der aktiven Suche nach Hilfe und Unterstützung.
5 Die Folgen von Mobbing: Dieses Kapitel beschreibt die Auswirkungen von Mobbing sowohl auf die Betroffenen als auch auf das Unternehmen. Für Betroffene werden die gesundheitlichen, psychischen und sozialen Folgen dargelegt. Für das Unternehmen werden die wirtschaftlichen und sozialen Kosten von Mobbing aufgezeigt. Der Fokus liegt auf den weitreichenden und nachhaltigen Konsequenzen von Mobbing.
6 Wie kann ein Unternehmen Mobbing verhindern?: Dieses Kapitel befasst sich mit präventiven Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um Mobbing zu vermeiden. Es wird auf die Bedeutung eines positiven Arbeitsklimas und effektiver Kommunikationsstrukturen eingegangen. Konkrete Strategien und Maßnahmen zur Prävention werden diskutiert. Das Kapitel betont die Verantwortung des Unternehmens in der Vermeidung von Mobbing.
Schlüsselwörter
Mobbing, Arbeitsalltag, Fallbeispiel, Konflikte, Leymann, 45-er Liste, Phasenmodell, Auswirkungen, Prävention, Reaktionen, Unternehmen, Betroffene, Gesundheit, psychische Belastung.
Häufig gestellte Fragen zum Fallbeispiel Mobbing am Arbeitsplatz
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument analysiert ein Fallbeispiel von Mobbing am Arbeitsplatz. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition von Mobbing, der Abgrenzung zu Konflikten, den Phasen und Auswirkungen von Mobbing, sowie auf Reaktions- und Präventionsstrategien für Betroffene und Unternehmen.
Was wird unter Mobbing verstanden und wie unterscheidet es sich von Konflikten?
Das Dokument definiert Mobbing als systematische und wiederholte Angriffe auf eine Person am Arbeitsplatz. Es unterscheidet sich von normalen Konflikten durch die Dauer, die Intensität und die gezielte Schädigung der Person. Die "45-er Liste" von Leymann wird verwendet, um verschiedene Mobbing-Formen zu kategorisieren, die Angriffe auf Kommunikation, soziale Beziehungen, Ansehen, Berufs-/Lebenssituation und Gesundheit umfassen.
Welche Phasen des Mobbings werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt die Entstehung und den Verlauf von Mobbingprozessen in mehreren Phasen. Es werden konkrete Beispiele für Mobbinghandlungen wie Ignoranz, Informationszurückhaltung und die Übernahme von Aufgaben durch Kollegen genannt, um die Eskalation des Mobbings zu veranschaulichen.
Wie können Mobbingbetroffene reagieren?
Für Betroffene werden verschiedene Reaktionsmöglichkeiten aufgezeigt, wie die Information des Betriebsarztes, des Vorgesetzten und des Betriebsrats, sowie die Inanspruchnahme von Beratungsstellen. Der Fokus liegt auf der aktiven Suche nach Hilfe und Unterstützung.
Welche Folgen hat Mobbing für Betroffene und Unternehmen?
Das Dokument beschreibt die gesundheitlichen, psychischen und sozialen Folgen von Mobbing für die Betroffenen und die wirtschaftlichen und sozialen Kosten für das Unternehmen. Die weitreichenden und nachhaltigen Konsequenzen von Mobbing werden hervorgehoben.
Wie kann ein Unternehmen Mobbing verhindern?
Es werden präventive Maßnahmen zur Mobbingvermeidung im Unternehmen diskutiert. Die Bedeutung eines positiven Arbeitsklimas, effektiver Kommunikationsstrukturen und konkreter Strategien und Maßnahmen zur Prävention werden betont, wobei die Unternehmensverantwortung im Vordergrund steht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Mobbing, Arbeitsalltag, Fallbeispiel, Konflikte, Leymann, 45-er Liste, Phasenmodell, Auswirkungen, Prävention, Reaktionen, Unternehmen, Betroffene, Gesundheit, psychische Belastung.
Wer ist Heinz Leymann und welche Rolle spielt er im Dokument?
Heinz Leymann wird im Dokument erwähnt im Zusammenhang mit seiner bekannten "45-er Liste", einer Kategorisierung verschiedener Formen von Mobbinghandlungen, die im Dokument zur Definition und Klassifizierung von Mobbing eingesetzt wird.
Worum geht es im Fallbeispiel "Unternehmen X"?
Das Dokument verwendet "Unternehmen X" als ein allgemeines Beispiel, um die im Text beschriebenen Aspekte von Mobbing zu illustrieren. Details über das konkrete Fallbeispiel bleiben jedoch unkonkret. Der Fokus liegt auf den allgemeinen Prinzipien und Mechanismen von Mobbing am Arbeitsplatz.
- Citar trabajo
- Dipl.-Kffr. (FH) Manuela Fürst (Autor), 2007, Mobbing im Arbeitsalltag – Beschreibung eines Fallbeispieles, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131048