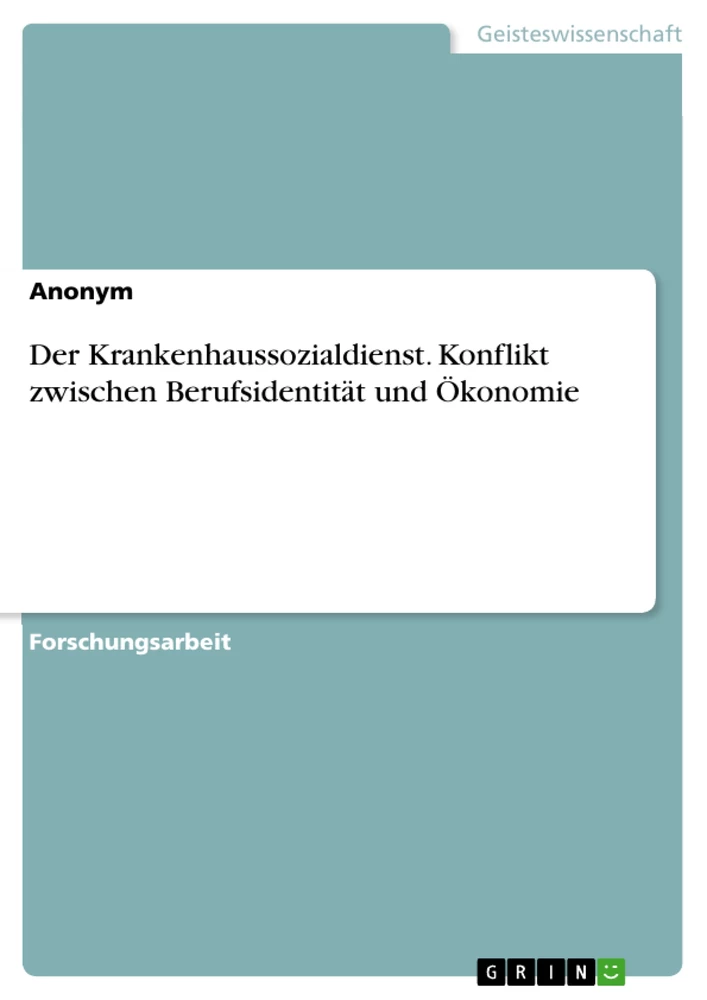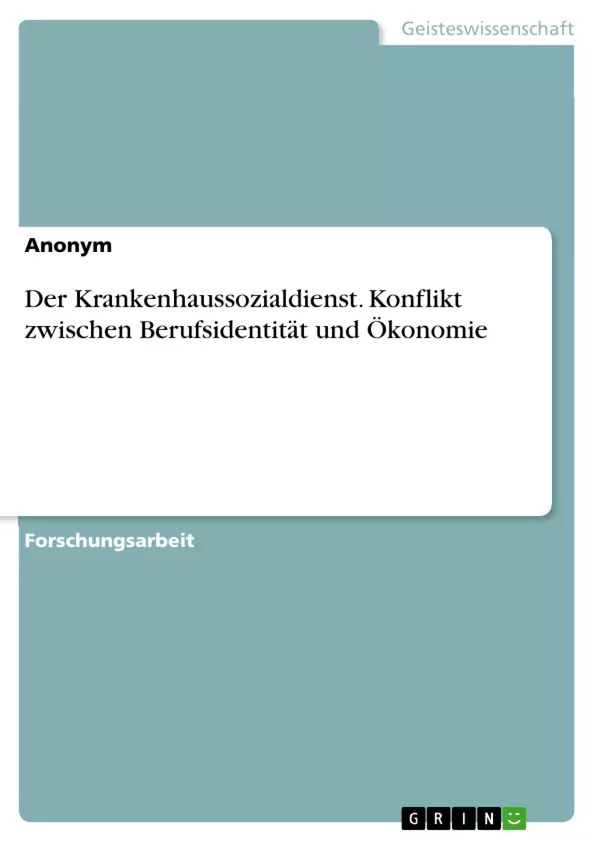Schränken die wirtschaftlichen Ansprüche die Ausführung der sozialen Arbeit ein? Inwiefern wird das Selbstverständnis der sozialen Arbeit durch die Ansprüche der Krankenhausökonomie verändert beziehungsweise in Frage gestellt? Wie können soziale Arbeit und Ökonomie voneinander profitieren? Wie lässt sich das Selbstverständnis der sozialen Arbeit und die ökonomischen Ansprüche des Krankenhauses in der Praxis miteinander vereinbaren?
Diese Fragestellungen werden in den nachfolgenden Kapiteln fachlich aufgegriffen und in Zusammenhang mit den empirisch erhobenen Daten ausgewertet, angefangen mit dem zweiten Kapitel, indem zunächst die Arbeitsfelder der klinischen Sozialarbeit und des Sozialdienstes gegenübergestellt und Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang geklärt werden. Weiterhin wird auf den historischen Verlauf des Kliniksozialdienstes von den Anfängen bis zum heutigen Stand eingegangen und nachfolgend Bezug auf den ökonomischen Hintergrund des Fallpauschalensystems in Krankenhäusern genommen. Das dritte Kapitel befasst sich anschließend explizit mit dem Berufsfeld des Kliniksozialdienstes, sowie seinem Selbstverständnis und setzt dieses in den Kontext des Fremdverständnisses des Wirtschaftsunternehmens Krankenhaus. Zudem werden die aktuellen ökonomischen Auswirkungen aufgezeigt und anschließend wird auf die wirtschaftlichen Ansprüche des Krankenhauses an den Kliniksozialdienst eingegangen. Innerhalb des vierten Kapitels werden dann Ansätze in der Praxis zur Vereinbarkeit des Selbstverständnisses des Kliniksozialdienstes und des ökonomischen Anspruchs des Krankenhauses dargestellt, aber auch die Grenzen dieser. Das fünfte Kapitel greift die vorangegangenen theoretischen Ausführungen auf und verknüpft sie mit den empirisch erhobenen Daten aus der Praxis. Dabei werden zunächst sowohl die Untersuchungsplanung, Samplestruktur, sowie Methoden der Untersuchung aufgelistet, als auch die quantitativen und qualitativen Befunde zusammengefasst dargestellt. Anschließend wird dann im sechsten Kapitel auf die vorherige Darstellung der Befunde nochmal Bezug genommen, indem die Ergebnisse im theoretischen Kontext dieser Ausarbeitung interpretiert und auch die Forschungsfragen in diesem Zusammenhang überprüft werden. Abschließend folgt das Fazit, welches Aufschluss und eventuelle Ausblicke aus der gesammelten Theorie gibt, sowie die Reflexion der Forschungsfragen, welche dieser schriftlichen Ausarbeitung zugrunde liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Krankenhaussozialdienst und das DRG-System
- Klinische Sozialarbeit vs. Kliniksozialdienst
- Ursprünge des Kliniksozialdienstes
- Einführung der Fallpauschalen
- Soziale Arbeit vs. Krankenhausökonomie
- Berufsidentität und Selbstverständnis des Kliniksozialdienstes
- Ökonomische Auswirkungen und Ansprüche an den Kliniksozialdienst
- Vereinbarkeit von Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Ansätze und Grenzen in der Praxis
- Forschungsdesign und Darstellung der Untersuchung
- Untersuchungsplanung, Samplestruktur und Methoden
- Darstellung der quantitativen Befunde und Prüfung der Gütekriterien
- Darstellung der qualitativen Befunde und Prüfung der Gütekriterien
- Interpretation der Befunde
- Interpretation der Ergebnisse
- Überprüfung der Forschungsfragen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Konflikt zwischen der Berufsidentität des Krankenhaussozialdienstes und den ökonomischen Anforderungen des DRG-Systems. Sie untersucht, inwiefern die wirtschaftlichen Ansprüche des Krankenhauses die Ausführung der sozialen Arbeit einschränken und das Selbstverständnis der sozialen Arbeit verändern. Darüber hinaus betrachtet sie die Möglichkeiten, wie Soziale Arbeit und Ökonomie voneinander profitieren können und wie sich das Selbstverständnis der sozialen Arbeit und die ökonomischen Ansprüche des Krankenhauses in der Praxis miteinander vereinbaren lassen.
- Berufliche Identität und Selbstverständnis des Kliniksozialdienstes im Kontext des DRG-Systems
- Ökonomische Auswirkungen auf die Krankenhaussozialarbeit und die Folgen für die Patientenversorgung
- Möglichkeiten der Vereinbarkeit von sozialen und ökonomischen Zielen im Krankenhaus
- Analyse von Praxisansätzen zur Vereinbarkeit von Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen des DRG-Systems auf die Krankenhaussozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 befasst sich mit dem Krankenhaussozialdienst und dem DRG-System. Es werden die Unterschiede zwischen klinischer Sozialarbeit und Kliniksozialdienst beleuchtet, die historischen Ursprünge des Kliniksozialdienstes dargestellt und die Einführung der Fallpauschalen im Kontext der Krankenhausökonomie beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die Beziehung zwischen Sozialer Arbeit und Krankenhausökonomie. Es werden das Selbstverständnis und die Berufsidentität des Kliniksozialdienstes im Kontext der ökonomischen Anforderungen des Krankenhauses betrachtet. Die Auswirkungen der ökonomischen Entwicklungen auf die Soziale Arbeit werden aufgezeigt und die wirtschaftlichen Ansprüche des Krankenhauses an den Kliniksozialdienst werden analysiert.
Kapitel 4 widmet sich der Frage, wie sich das Selbstverständnis des Kliniksozialdienstes und die ökonomischen Ansprüche des Krankenhauses in der Praxis vereinbaren lassen. Es werden verschiedene Ansätze und ihre Grenzen vorgestellt.
Kapitel 5 verknüpft die theoretischen Ausführungen mit den empirischen Daten aus der Praxis. Es werden die Untersuchungsplanung, die Samplestruktur und die Methoden der Untersuchung dargestellt, sowie die quantitativen und qualitativen Befunde zusammengefasst.
Kapitel 6 interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung im theoretischen Kontext der Hausarbeit und überprüft die Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Krankenhaussozialdienst, DRG-System, Fallpauschalen, Klinische Sozialarbeit, Kliniksozialdienst, Berufsidentität, Selbstverständnis, Krankenhausökonomie, Ökonomisierung, Patientenversorgung, Soziale Arbeit, Vereinbarkeit, Praxisansätze, empirische Untersuchung, Forschungsfragen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Der Krankenhaussozialdienst. Konflikt zwischen Berufsidentität und Ökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1311342