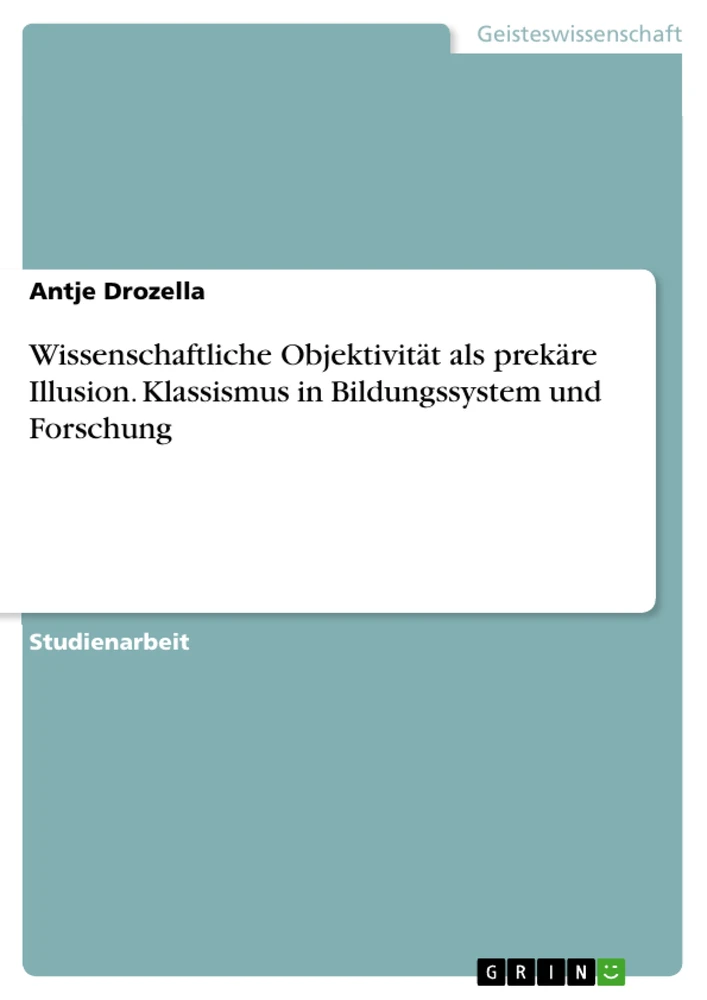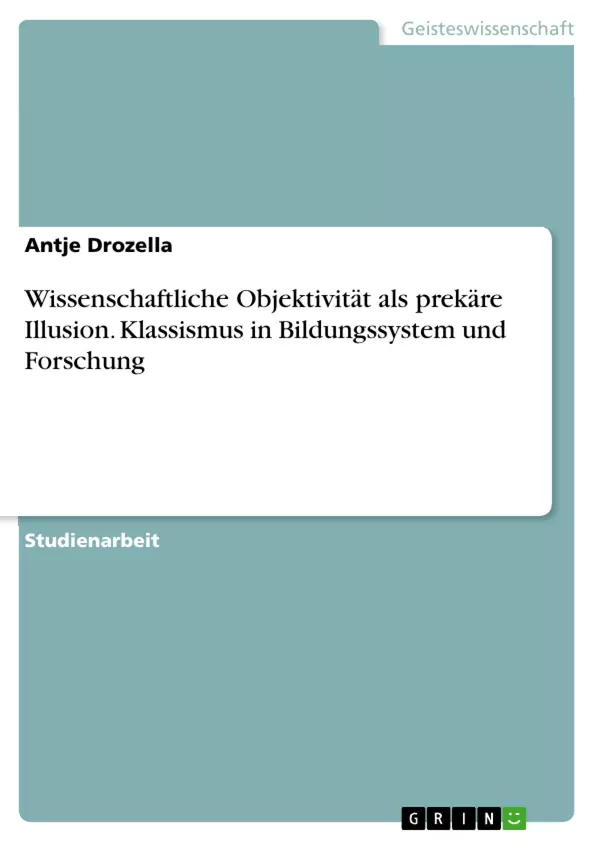Die wissenschaftliche Diskussion darüber, welches Maß an Nähe beziehungsweise Distanz der Forschenden zum Gegenstand im Forschungsprozess angemessen ist, ist keinesfalls neu. Bereits zum Ende des vorletzten Jahrhunderts bezichtigte der afroamerikanische Soziologe Du Bois, amerikanischer Pionier in Sachen soziologischer Empirie, seine weißen, männlichen Berufskollegen eine Car-Window-Soziologie zu betreiben. Der vorbeischweifende, oberflächliche Blick aus dem Fenster ihres Autos genügte, um darauf basierend Soziologie auszuüben und Du Bois sah darin unter anderem die Ursache für die Reproduktion von ideologischem und institutionellem Rassismus. Weit über 100 Jahre später ist Empirie längst fragloses Kernelement der Sozialforschung, aber die Frage über die legitime Tiefe des Eindringens ins Feld wird aktuell immer noch kontrovers diskutiert und ihre Beantwortung hängt stark vom jeweiligen Forschungsgegenstand und der jeweiligen Tendenzen landesspezifischer Wissenschaftskultur ab.
Wie unscharf und widersprüchlich die Konstrukte Nähe und Distanz gehandhabt und definiert werden, soll hier beginnend mit der Kritik an Nähe am bestimmten Fall und von da aus auf allgemeinerer Ebene problematisiert werden.
Dabei wird angelehnt an Du Bois Einschätzung, Wissenschaft ohne Empirie reproduziere Rassismus, die Überlegung angestellt, dass auch Wissenschaft mit Empirie aus einem Mangel an (Selbst-)Reflexion der Forschenden das Potenzial birgt, Klassismus zu perpetuieren. Denn Diskriminierung ist zwar heterogen geformt, diesen heterogenen Formen sind jedoch grundlegende Mechanismen der Differenzkonstruktion gemeinsam, „die für die Herstellung, Begründung und Rechtfertigung von Grenzziehungen und Hierarchien folgenreich sind“. Die Relevanz dieser Wahl speist sich daraus, dass Klassismus in der Wissenschaft zwar zunehmend thematisiert wird, im Vergleich zu Sexismus und Rassismus aber als relativ unterrepräsentiert gilt, gleichzeitig diesem jedoch der stärkste Wirkungsanteil an Bildungsdiskriminierung attestiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Soziologe auf Abwegen
- Mangel an begrifflicher Konzeptionalisierung
- Scheinevidente Dichotomien
- Idealtypen und Ausgrenzung
- Transfer auf die Wissenschaft
- Relativierung, Lösungswege und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, inwieweit Nähe oder Distanz der Forschenden zum Gegenstand im Forschungsprozess angemessen sind. Er beleuchtet die Debatte um Objektivität und Subjektivität in der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere in den Sozialwissenschaften, und stellt die gängige Annahme einer distanzierten Objektivität als Illusion in Frage.
- Kritik an der Dichotomie von Nähe und Distanz in der Forschung
- Relevanz der eigenen Positionierung und des Milieus der Forschenden
- Die Bedeutung von Empirie und die Gefahr von Klassismus in der Forschung
- Die Rolle des Körpers in der Forschung und die Herausforderungen der teilnehmenden Beobachtung
- Der Einfluss des Habitus auf die Forschung und die Frage nach der „göttlichen Trick“ der Objektivität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text beginnt mit einer Einordnung der Debatte um Nähe und Distanz in der Forschung und setzt die Frage nach der angemessenen Tiefe des Eindringens ins Feld in den Kontext der wissenschaftlichen Praxis. Hier wird auch der Fokus auf die Gefahr von Klassismus in der Forschung gelegt, die durch fehlende (Selbst-)Reflexion entstehen kann.
- Ein Soziologe auf Abwegen: Dieses Kapitel beleuchtet das Beispiel von Loïc Wacquant, der sich in seiner Feldstudie in Chicago tief in die Kultur und Lebensweise der von Armut betroffenen Menschen einbringt. Der Text analysiert die Kritik, die an Wacquants Vorgehen aufgrund der Nähe zum Forschungsgegenstand geäußert wird und setzt dies in Bezug zu den etablierten Forschungspraktiken.
- Mangel an begrifflicher Konzeptionalisierung: Hier wird die mangelnde Konzeptualisierung von Nähe und Distanz als wissenschaftliche Sachlagen kritisiert. Die Zuschreibung von „Zuviel Nähe“ wird als subjektiv und unwissenschaftlich dargestellt. Der Text stellt die Frage, ob eine objektive Distanz zum Forschungsgegenstand überhaupt möglich ist, da die Forschenden immer bereits einer Nähe zum eigenen Milieu verhaftet sind.
- Scheinevidente Dichotomien: In diesem Abschnitt wird die Kritik an den scheinbar eindeutigen Dichotomien in der Forschung aufgegriffen. Die Trennung zwischen Forschungssubjekt und -objekt wird als künstliche Grenze dargestellt, die der Komplexität der sozialen Wirklichkeit nicht gerecht wird. Der Text betont, dass Objektivität im Sinne einer distanzierten Betrachtung nicht realistisch ist, da Wissen immer situiert ist.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Nähe, Distanz, Objektivität, Subjektivität, Habitus, Klassismus, (Selbst-)Reflexivität, teilnehmende Beobachtung, situiertes Wissen, wissenschaftliche Praxis, Sozialforschung, Forschungsethik.
- Citation du texte
- Antje Drozella (Auteur), 2022, Wissenschaftliche Objektivität als prekäre Illusion. Klassismus in Bildungssystem und Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1311499