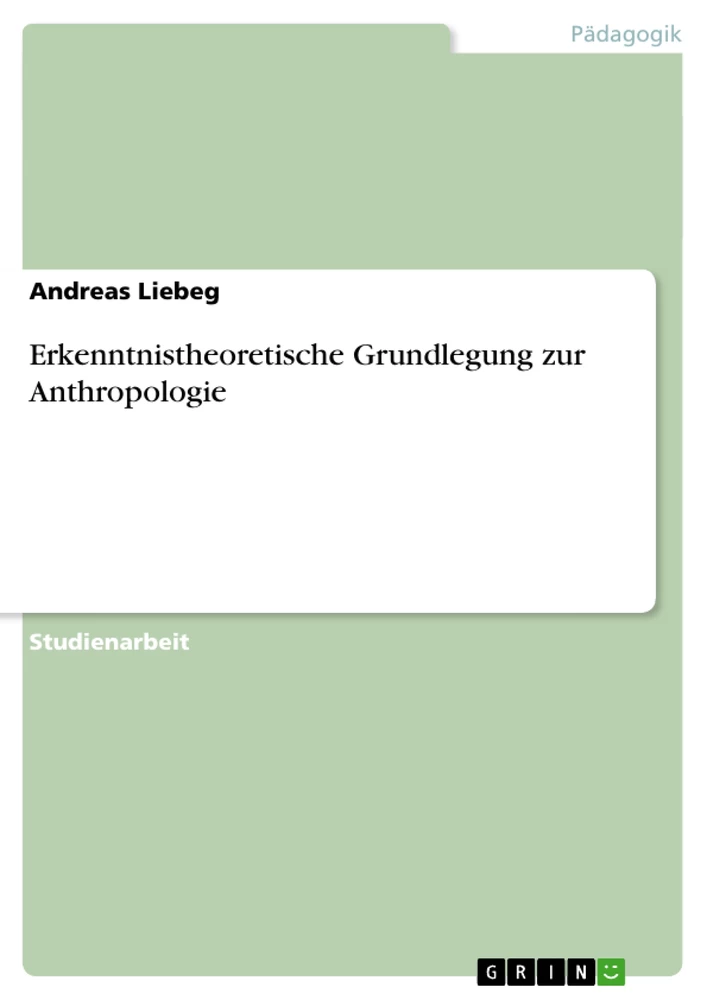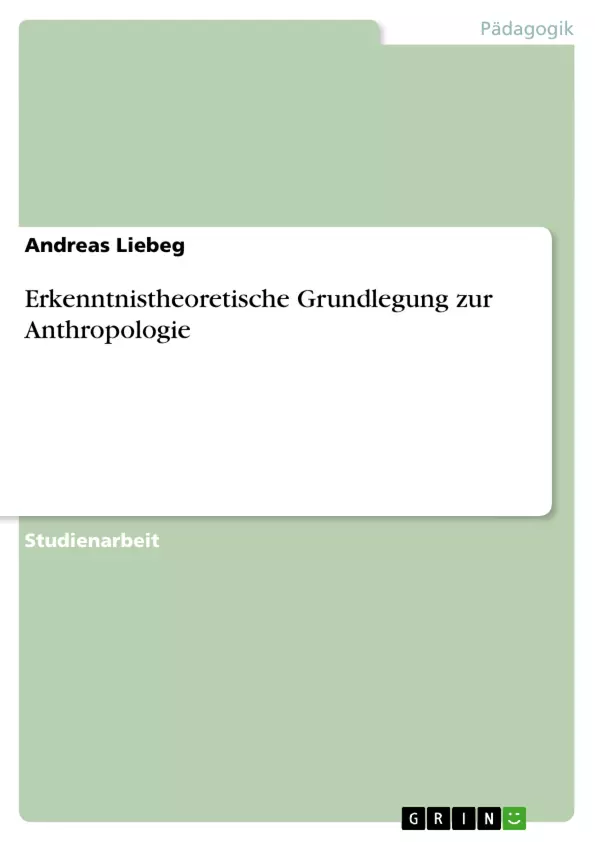Die Geschichte der anthropologischen Fragen kann wohl mit der der Philosophie in Übereinstimmung gebracht werden. „Was ist der Mensch?“ Das beschäftigte wohl nicht die Griechen als erste. Dementsprechend kann diese Arbeit unmöglich eine Zusammenfassung anthropologischer Denkrichtungen, und sei es auch nur derjenigen, die sich unter das Dach der Behindertenpädagogik gesellen, darstellen. Der Anspruch dieser Arbeit muß sich anderswo erfüllen. Es geht also, wie der Titel ja bereits besagt, um das Errichten eines Fundamentes. Man könnte sogar die Behauptung aufstellen, es ginge darum, ein Paradigma zu schaffen, doch scheint mir dieser Begriff zu belastet.
Ich werde in dem Folgenden vielmehr versuchen, einen Ausgangspunkt zu finden, welcher, sofern er eingenommen wird, eine wertschätzende Haltung gegenüber jeglichem menschlichem Leben unabdingbar macht.
Ausgerechnet Singer hat ja die Diskussion um den Wert des Menschen (gr.: anthropos) wiederbelebt und dafür kann man ihm durchaus dankbar sein. Mit ihm habe ich mich bereits im Rahmen meines Zivildienstes auseinandergesetzt, den ich in einer Euthanasie - Gedenkstätte ableistete. Damals hatte Singer vorerst die positive Wirkung auf mich, daß ich Vegetarier wurde und die Tatsache akzeptierte, daß wohl auch Tiere eine Art des Bewußtseins und Denkens sowie Gefühle besitzen. Sehr seltsam schien mir allerdings, daß der Mann, welcher mich zu dieser Veränderung inspirierte, andererseits behauptete, daß bei manchen Vertretern derjenigen Gattung, welche zu lange weit über das Tier gestellt wurde (im Sinne einer Unterbewertung des Tieres, nicht einer Überbewertung des Menschen), dagegen die Phänomene, die er nun auch Tieren zusprach, nicht auftreten. Das irritierte mich sehr und widersprach völlig meiner Ethik. Ich kam nicht dahinter, was einen Mann, der einerseits sich für die Rechte der Tiere einsetzt, dazu bewegt, sich andererseits gegen die Rechte von Menschen auszusprechen. Allerdings gab ich recht schnell anhand der intellektuellen Übermacht auf und glitt ab in Floskeln, die mir selbst nicht ausreichend schienen. Letzten Endes zweifelte ich sogar an der Richtigkeit meiner eigenen Überzeugungen und fragte mich, ob sie denn nicht bloß starr und anerzogen wären. Nun aber denke ich, einen Weg gefunden zu haben. Ich bin der festen Überzeugung, daß ich jetzt ein Menschenbild in mir trage, welches ich begründen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Über Wirklichkeit und Erkenntnis
- Wissen und Wahrheit
- Der Glaube an Ursache und Wirkung
- Raum und Zeit
- Konstruktivismus
- Die Subjekt- Objekt Differenzierung
- Determinismus
- Konsequenzen für die Anthropologie in der Heilpädagogik
- Das Problem der Gewißheit
- Die Unmöglichkeit des Unsinns
- Die Suche nach dem Verstehen
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, eine erkenntnistheoretische Grundlage für die Anthropologie zu schaffen, indem sie den Umgang mit dem Wissen über den Menschen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Heilpädagogik untersucht.
- Die Frage nach der Natur und Grenzen menschlichen Wissens
- Der Einfluss des Konstruktivismus auf die Anthropologie
- Die Bedeutung der Subjekt-Objekt-Differenzierung
- Das Problem der Gewissheit und die Suche nach dem Verstehen
- Konsequenzen für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Dieses Kapitel stellt die Motivation und den Hintergrund der Arbeit dar. Es beleuchtet die aktuelle Debatte um den Wert des Menschen und die ethischen Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
- Über Wirklichkeit und Erkenntnis: Dieses Kapitel untersucht die Frage nach Wissen und Wahrheit. Der Fokus liegt auf der Paradoxie, dass wir gleichzeitig wissen, dass wir nichts wissen. Es wird die Bedeutung von Wissen für den Umgang mit der Welt beleuchtet.
- Konstruktivismus: Dieses Kapitel stellt die Theorie des Konstruktivismus vor und erörtert ihre Implikationen für die Anthropologie. Es beleuchtet die Subjekt-Objekt-Differenzierung und den Einfluss des Determinismus auf die menschliche Erkenntnis.
- Das Problem der Gewissheit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Gewissheit und den Grenzen menschlichen Wissens. Es untersucht die Unmöglichkeit des Unsinns und die Notwendigkeit, das Verstehen zu suchen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Anthropologie, Erkenntnistheorie und Heilpädagogik. Schlüsselbegriffe sind: Wissen, Wahrheit, Konstruktivismus, Subjekt-Objekt-Differenzierung, Determinismus, Gewissheit, Verstehen, Behinderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser erkenntnistheoretischen Arbeit?
Die Arbeit möchte ein Fundament für die Anthropologie schaffen, das eine wertschätzende Haltung gegenüber jeglichem menschlichen Leben unabdingbar macht.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus in der Arbeit?
Der Konstruktivismus wird genutzt, um die Grenzen menschlicher Erkenntnis und die Subjekt-Objekt-Differenzierung im Kontext der Heilpädagogik zu untersuchen.
Warum wird die Position von Peter Singer kritisch betrachtet?
Der Autor setzt sich mit Singers Thesen zum Wert des menschlichen Lebens auseinander, die im Widerspruch zu einer Ethik stehen, die jedem Menschen gleiche Rechte zuspricht.
Was bedeutet „Subjekt-Objekt-Differenzierung“?
Dies beschreibt die erkenntnistheoretische Trennung zwischen dem erkennenden Ich (Subjekt) und der wahrgenommenen Welt (Objekt) und deren Folgen für das Menschenbild.
Was sind die Konsequenzen für die Heilpädagogik?
Die Arbeit leitet aus der Erkenntnistheorie ab, wie Wissen über Menschen mit Behinderung konstruiert wird und fordert eine grundlegende Achtung der menschlichen Würde.
- Quote paper
- Andreas Liebeg (Author), 2001, Erkenntnistheoretische Grundlegung zur Anthropologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13140