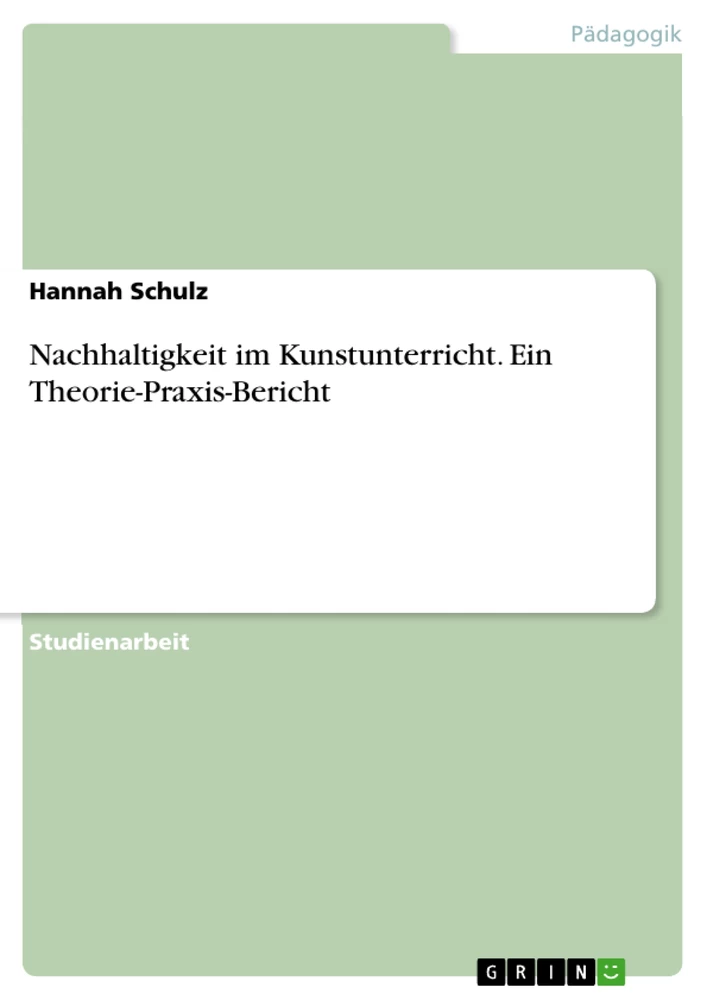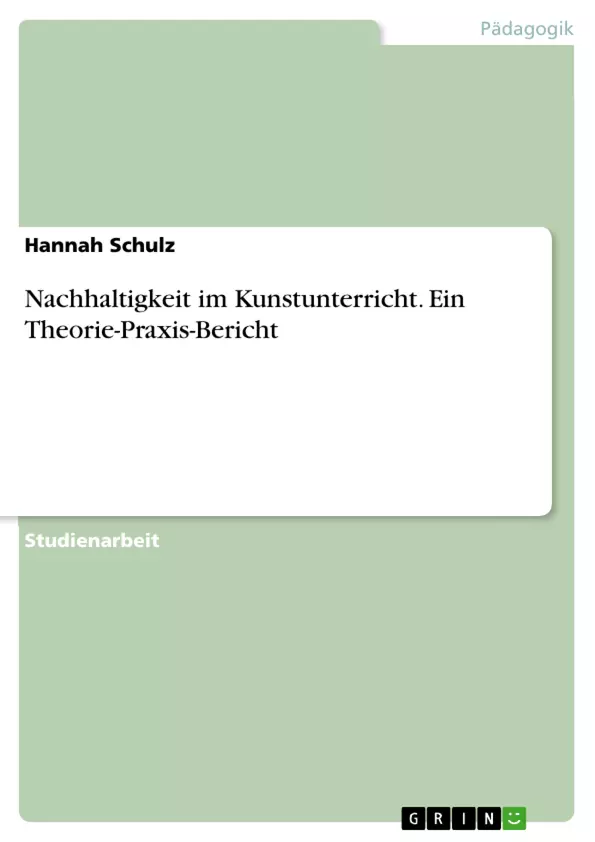Die konkrete Forschungsfrage lautet: Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit bei der Unterrichtsplanung im Fach
Kunst?
Die Forschung hinsichtlich dieser Frage soll dazu dienen, zu untersuchen, inwiefern Nachhaltigkeit bereits als Themenfeld im Kunstunterricht behandelt wird und für wie relevant Lehrpersonen dieses Thema bei der Planung von Kunstunterricht halten und berücksichtigen. Des Weiteren ist es interessant, mehr über die konkrete Umsetzung im Unterricht zu erfahren. Das Fach Kunst ist prädestiniert Nachhaltigkeit zu vermitteln, da Kunstwerke an sich Repräsentanten von Nachhaltigkeitskonzepten sind. Kunstwerke werden gepflegt und über Jahrtausende aufbewahrt. Dies wiederum gibt Auskunft über ihren Existenz- und Prestigewert. Demnach können Kunstwerke, eingebettet in museale und sammlerbezogene Nachhaltigkeitskonzepte als Repräsentanten und mediale Repräsentationen von historischen, soziokulturellen, ökonomischen und ökologischen Abläufen verstanden werden. An und mit ihnen ist es möglich, Traditionen, Veränderungen und Brüche zu rekonstruieren. Manche Kunstwerke werden geschaffen, um Jahrtausende zu überdauern. Die Intention der Künstler*innen ist, etwas Dauerhaftes zu schaffen. Daher wird deutlich, dass Historizität ein wesentliches Konzept der bildenden Kunst darstellt. Die in der Schule erlernten Wahrnehmungsweisen und Einschätzungen von Kunst haben Einfluss darauf, wie die Schüler*innen als Entscheidungsträger mit dem kulturellen Erbe verfahren werden. Es gehört zur Wertebildung in der Schule, in Unterrichtsvorhaben Kunstwerke unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeitskonzepten zu beleuchten. Autonomie und Selbstreferenzialität sind zwar als Konzepte erfolgreich, doch verweist Kunst unwillkürlich auf mehr als sich selbst, denn sie ist durchdrungen von historischen und soziokulturellen Prozessen. Allein durch Kunst ist es möglich, ganze Welten oder eben nur winzige Details abzubilden. Kunst wird aber auch zur Machtdemonstration verwendet. Es wird deutlich, dass Kunst alles kann. Sie kann inkludieren als auch exkludieren, idealisieren und entstellen, sowie klären und verwirren. Aber eines macht sie immer: „Sie lenkt den Blick der Schauenden stets zurück auf sie selbst, ihr Leben, ihre Ängste, Hoffnungen und Wünsche.“ Daher bildet die Thematisierung von Nachhaltigkeit im Kunstunterricht eine grundlegende Basis für ein bewusstes, nachhaltiges und reflektierendes Leben der Schüler*innen.
Inhaltsverzeichnis
- Begründung und Herleitung des gewählten Themenfeldes
- Darstellung des Themenschwerpunktes
- Forschungsvorgehen
- Auswertungsschritte
- Darstellung der Ergebnisse
- Interpretation und Fazit
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit im Kunstunterricht. Sie analysiert den aktuellen Diskurs um Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf Bildung und Kultur, und untersucht, wie diese Erkenntnisse in die Planung und Gestaltung von Kunstunterricht integriert werden können.
- Die Bedeutung von Nachhaltigkeit als Megatrend und die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen und kulturellen Wandels
- Die Rolle von Bildung und Kultur für eine nachhaltige Entwicklung
- Die Integration von Nachhaltigkeit in den Kunstunterricht als fächerübergreifendes Thema
- Die Kunst als Instrument der Veränderung und Zukunftsgestaltung
- Die Bedeutung der künstlerischen Praxis für eine nachhaltige Lebensweise
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Nachhaltigkeit als Megatrend und die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen und kulturellen Wandels. Es werden die Herausforderungen der Klimakrise und anderer Umweltprobleme sowie die Rolle von Bildung und Kultur für eine nachhaltige Entwicklung diskutiert.
Das zweite Kapitel stellt den Themenschwerpunkt der Arbeit vor und definiert die Forschungsfrage. Es untersucht die Bedeutung der Kunst als Instrument der Veränderung und Zukunftsgestaltung und zeigt auf, wie Nachhaltigkeit im Kunstunterricht zum Thema werden kann.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Forschungsvorgehen und erläutert die Methode, mit der die Forschungsfrage beantwortet werden soll.
Das vierte Kapitel beschreibt die Auswertungsschritte und die verwendeten Methoden zur Analyse der Daten.
Das fünfte Kapitel stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar.
Das sechste Kapitel interpretiert die Ergebnisse und zieht ein Fazit.
Das siebte Kapitel reflektiert den Forschungsprozess und die Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Bildung, Kultur, Kunst, Kunstunterricht, gesellschaftlicher Wandel, Umweltschutz, Zukunftsgestaltung, Kunst und Kultur, transformative Bildung, kreative Problemlösung, gesellschaftliche Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann Nachhaltigkeit im Kunstunterricht thematisiert werden?
Kunstwerke können als Repräsentanten von Nachhaltigkeitskonzepten (z.B. Erhalt kulturellen Erbes) und als mediale Darstellungen ökologischer Abläufe analysiert werden.
Warum ist das Fach Kunst für Nachhaltigkeit prädestiniert?
Kunstwerke werden über Jahrtausende bewahrt; diese Historizität und Pflege sind Kernaspekte von Nachhaltigkeit und Wertenbildung.
Was ist "transformative Bildung" im Kunstkontext?
Es beschreibt einen Bildungsprozess, der Schüler dazu befähigt, durch kreative Praxis und Reflexion aktiv an einem gesellschaftlichen Wandel mitzuwirken.
Welchen Stellenwert geben Lehrkräfte der Nachhaltigkeit bei der Planung?
Die Forschungsarbeit untersucht empirisch, wie wichtig Lehrpersonen dieses Thema einschätzen und wie sie es konkret im Unterricht umsetzen.
Wie beeinflusst Kunst die Wahrnehmung der Klimakrise?
Kunst lenkt den Blick der Schauenden auf ihr eigenes Leben und ihre Ängste, was ein Bewusstsein für ökologische und soziokulturelle Probleme schaffen kann.
- Citation du texte
- Hannah Schulz (Auteur), 2022, Nachhaltigkeit im Kunstunterricht. Ein Theorie-Praxis-Bericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316567