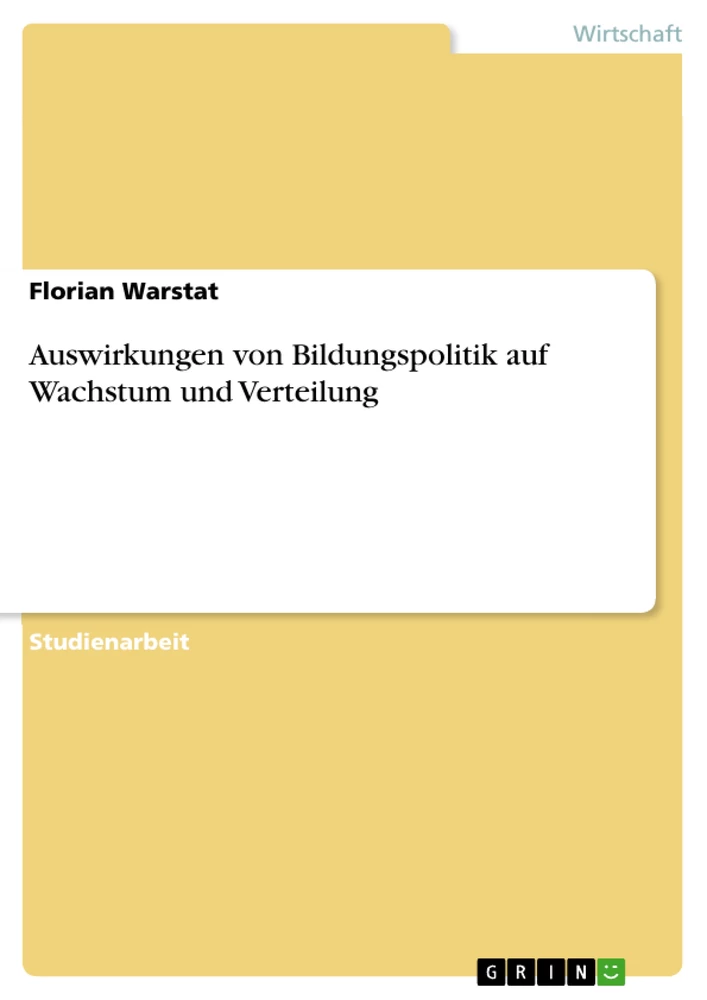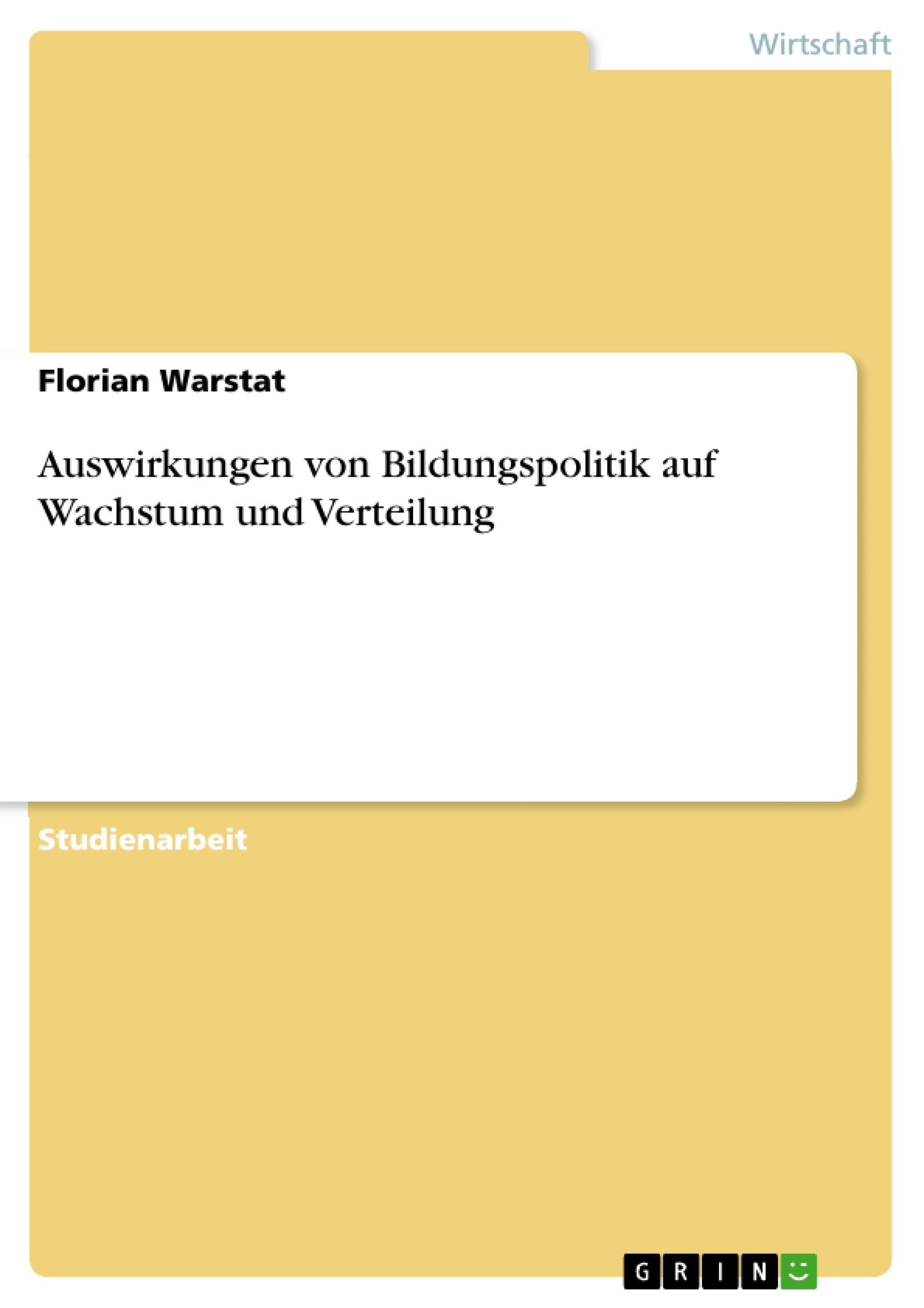Bildung und freier Zugang zu ausbildenden Institutionen gehören heute zu den
grundlegenden Menschenrechten der meisten Gesellschaften und wurde so
auch in Artikel 26 der von den Vereinten Nationen entwickelten
Menschenrechtskonventionen festgehalten.1 Die Bedeutung dieses Punktes
wird allerdings von vielen Ländern und den politisch Verantwortlichen
weiterhin unterschätzt. Dabei scheint sich die Ausbildung der Bevölkerung,
vor allem auch für Länder im Entwicklungsprozess, als entscheidender Faktor
für die Verbesserung der Lebensqualität, die wirtschaftliche Entwicklung und
die Verminderung der Armut herausgestellt zu haben. 2
Warum dies so ist und auf welche Weise sich Bildung auf den
Entwicklungsprozess eines Landes auswirken kann, soll im Rahmen dieser
Seminararbeit erläutert werden. Es wird dabei zunächst das Problem der
geeigneten Messung von Bildung thematisiert, um danach einen geeigneten
Schätzer für das Humankapital eines Landes entwickeln zu können. Im dritten
Abschnitt dieser Arbeit wird dann gezeigt, wie sich Bildung, unter anderem
auch unter Berücksichtigung des entwickelten Humankapitalkoeffizienten, auf
wirtschaftliche Wachstumsprozesse auswirkt. Dabei wird erst der aus
Ausbildung resultierende Nutzen einzelner Personen untersucht, um danach
den Blick auch auf die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums
und den gesellschaftlichen Gewinn aus individueller Ausbildung zu werfen. Im
folgenden Teil stehen dann die Verteilung von Bildung und vor allem die Frage
der geeigneten Messung dieser Verteilung im Vordergrund. Es soll in diesem
Zusammenhang verdeutlicht werden, welche entscheidende Rolle auch die
Verteilung der Bildung zwischen Regionen und Bevölkerungsteilen einer
Gesellschaft spielt, und welche Auswirkungen sich daraus auf die
Einkommensentwicklung eines Landes ergeben. Zum Schluss soll dann noch
anhand des afrikanischen Kontinents exemplarisch gezeigt werden, wie sich
einige der ärmsten Länder der Erde entwickelt haben, und welche Rolle die
Bildung bei dieser Entwicklung gespielt hat.
1 vgl. World Education Report 2000: The right to education, UNESCO Publishing, pp. 16 ff.
2 vgl. P. Hay und M. Hazaq (2000): Wachstumsqualtiät - Schlüssel zu Armutsminderung und besserer
Lebensqualität für alle, Pressemitteilung der Weltbank, Nr. 2001/071/S, S.2
INHALT
1. Überblick
2. Bildung
2.1 Das Problem der Erfassung von Bildung
2.2 Die Einteilung von Bildung
2.3 Die Messung des Humankapitals
3. Wachstum
3.1 Mikroökonomische Theorie
3.1.1 Die Lohngleichung von Mincer
3.1.2 Privater Gewinn vs. Gesellschaftliche Wohlfahrt
3.2 Makroökonomische Theorie
3.2.1 Die Erweiterung des Solow Modells
4. Verteilung
4.1 Die Bedeutung der Verteilung
4.2 Die Standardabweichung der Ausbildung
4.3 Der Ginikoeffizient der Ausbildung
5. Fallbeispiel: Der afrikanische Kontinent
6. Rückblick und Ausblick
ANHANG
LITERATURVERZEICHNIS
1. Überblick
Bildung und freier Zugang zu ausbildenden Institutionen gehören heute zu den grundlegenden Menschenrechten der meisten Gesellschaften und wurde so auch in Artikel 26 der von den Vereinten Nationen entwickelten Menschenrechtskonventionen festgehalten.1 Die Bedeutung dieses Punktes wird allerdings von vielen Ländern und den politisch Verantwortlichen weiterhin unterschätzt. Dabei scheint sich die Ausbildung der Bevölkerung, vor allem auch für Länder im Entwicklungsprozess, als entscheidender Faktor für die Verbesserung der Lebensqualität, die wirtschaftliche Entwicklung und die Verminderung der Armut herausgestellt zu haben.2
Warum dies so ist und auf welche Weise sich Bildung auf den Entwicklungsprozess eines Landes auswirken kann, soll im Rahmen dieser Seminararbeit erläutert werden. Es wird dabei zunächst das Problem der geeigneten Messung von Bildung thematisiert, um danach einen geeigneten Schätzer für das Humankapital eines Landes entwickeln zu können. Im dritten Abschnitt dieser Arbeit wird dann gezeigt, wie sich Bildung, unter anderem auch unter Berücksichtigung des entwickelten Humankapitalkoeffizienten, auf wirtschaftliche Wachstumsprozesse auswirkt. Dabei wird erst der aus Ausbildung resultierende Nutzen einzelner Personen untersucht, um danach den Blick auch auf die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums und den gesellschaftlichen Gewinn aus individueller Ausbildung zu werfen. Im folgenden Teil stehen dann die Verteilung von Bildung und vor allem die Frage der geeigneten Messung dieser Verteilung im Vordergrund. Es soll in diesem Zusammenhang verdeutlicht werden, welche entscheidende Rolle auch die Verteilung der Bildung zwischen Regionen und Bevölkerungsteilen einer Gesellschaft spielt, und welche Auswirkungen sich daraus auf die Einkommensentwicklung eines Landes ergeben. Zum Schluss soll dann noch anhand des afrikanischen Kontinents exemplarisch gezeigt werden, wie sich einige der ärmsten Länder der Erde entwickelt haben, und welche Rolle die Bildung bei dieser Entwicklung gespielt hat.
2. Bildung
2.1 Das Problem der Erfassung von Bildung
Bevor untersucht wird, wie Bildung gemessen wird bzw. welche Auswirkungen Bildung auf die Entwicklung bestimmter Prozesse wie z.B. dem Wirtschaftswachstum eines Landes hat, soll hier zunächst einmal eine einführende Erklärung des abstrakten Begriffes Bildung gegeben werden.
Leider gibt es in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur keine allgemeingültige Definition dieses Wortes und so könnte versucht werden Bildung z.B. durch Lese-/Schreibraten, Analphabetenraten oder ähnlichem zu charakterisieren. Diese Größen sind aber schon aus dem Grunde nicht geeignet, weil sie in entwickelten Ländern bei fast 100% liegen und deshalb keine Vergleiche zwischen diesen Ländern zuliessen.3 Ein besserer Schätzer für die Bildung ist unter anderem mit dem Schülerbeitrittsverhältnis gegeben. Dieses zählt die jährlichen Schülerzahlen und kann nur in Wachstumsmodellen deswegen schlecht verwendet werden, weil es vielleicht das zukünftige, aber nicht das derzeitige Ergebnis der Ausbildung und des Humankapitalbestandes anzeigt.4
Der beste Wert, um den Stand der Ausbildung einer Gesellschaft zu messen, ist die durchschnittliche Schulbildung. Diese wird durch die Anzahl der Schuljahre bestimmt, die ein Individuum aus der arbeitenden Bevölkerung durchschnittlich in seinem Leben an ausbildenden Institutionen verbracht hat. Der Vorteil dieses Schätzers liegt vor allem in seiner quantitativen Aussage über den Output eines Bildungssystems, sein großer Nachteil darin, dass leider keine qualitative Bewertung erfolgt. Möglichkeiten, diese Qualität von Bildung zu erfassen, bieten allerdings der sogenannte „Input Approach“ und der „Output Approach“ [vgl. Measuring Human Capital like Physical Capital]. Der Input Ansatz versucht über die für die Ausbildung aufgebrachten Ressourcen, beispielsweise die Ausgaben für Lehrkräfte, Ausbildungsmaterialien, usw., eine Bewertung der Qualität zu erbringen. Problematisch bei diesem Ansatz ist natürlich weiterhin, dass Quantität, nämlich die Summe der Ausgaben, nicht gleichbedeutend mit dem eigentlichen Wert der Ausbildung sein müssen, und dass die Ausgaben außerdem nicht unabhängig vom Einkommen des betreffenden Landes sind. Der Output Ansatz widmet sich auf der anderen Seite tatsächlich dem, was die Ausbildung hervorbringt, nämlich dem Wissen der Schüler. Hier werden vergleichende Tests zwischen den Schülern der einzelnen Länder durchgeführt, wie es beispielsweise auch bei der PISA Studie getan wurde, um den wirklichen Wert der Ausbildung zu bestimmen. Die Schwierigkeit bei dieser Methode liegt zum einem in den nicht möglichen Zeitvergleichen, aber vor allem darin, dass solche Daten nur in sehr beschränktem Ausmaß, d.h. nur für einige industrialisierte Länder, zur Verfügung stehen.5
Das Hauptproblem wird also im Folgenden darin bestehen, die quantitative Komponente der Bildung so zu bewerten, dass sie eine korrekte Messung und Einschätzung des Humankapitals darstellt. Hierin liegt auch der eigentliche Unterschied zwischen dem Begriff der Bildung und dem des Humankapitals. Wenn vom Humankapital der Länder gesprochen wird, dann ist dies eine bewertete Größe der Ausbildung, welche in der Wachstumstheorie bei der Untersuchung der Auswirkungen von Bildung auf Wachstum die entscheidende Rolle spielt.6
2.2 Die Einteilung von Bildung
Ein wichtiger Punkt für die spätere Messung und Schätzung des Humankapitals einer Gesellschaft ist auch die Differenzierung zwischen verschiedenen Bildungsniveaus. Wenn also die Schulausbildung eines Individuums weiterhin in durchschnittlichen Schuljahren gemessen wird, so lässt sich diese in verschiedene Stufen oder Ebenen einteilen, welche im Zeitablauf erreicht und absolviert werden. Gängig sind zwei Arten der Einteilung: Zunächst eine Dreiteilung in Primär-, Sekundär- und Tertiärstufe beziehungsweise eine weitere Zweiteilung dieser, um eine noch genauere Abgrenzung der Ausbildungsstufen zu ermöglichen. Im Folgenden wird der Einfachheit halber die erste Unterscheidung benutzt, welche auf das deutsche Schulsystem angewandt etwa der Einteilung in Vor- und Grundschulniveau, Ebene der weiterführenden Schulen und der universitären Ausbildungsstufe entsprechen dürfte. Die Wichtigkeit dieser Einteilung für die spätere Messung des Humankapitals ergibt sich schlicht daraus, dass die einzelnen Bildungsstufen nicht gleich kostenintensiv sind. Es ist intuitiv einsichtig, dass z.B. ein Jahr Ausbildung an einer Universität zu höheren Kosten führt, als einem Kind ein Jahr Grundschulbildung zukommen zu lassen.7 So geben derzeit beispielsweise alle OECD Mitgliedsländer im Durchschnitt US$ 4229 für einen Schüler im primären, US$ 5174 im sekundären und US$ 11422 im tertiären Aus- bildungsbereich aus [vgl. Education at a glance:OECD Indikators 2002,p.145]8.
[...]
1 vgl. World Education Report 2000: The right to education, UNESCO Publishing, pp. 16 ff.
2 vgl. P. Hay und M. Hazaq (2000): Wachstumsqualtiät - Schlüssel zu Armutsminderung und besserer Lebensqualität für alle, Pressemitteilung der Weltbank, Nr. 2001/071/S, S.2
3 vgl. ANHANG 1
4 vgl. Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education a.a.O., pp.4 ff.
5 vgl. Judson, Ruth (2002): Measuring Human Capital like Physical Capital: What does it tell us?, Bulletin of Economic Research, Vol.54, No.3, pp. 213 ff.
6 vgl. Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education a.a.O., pp. 1ff.
7 vgl. Measuring Human Capital like Physical Capital: What does it tell us? a..a.O., pp. 213 ff.
8 vgl. Education at a Glance: OECD Indicators 2002, Organisation for Economic Cooperation and Development
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat Bildung auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes?
Bildung gilt als entscheidender Faktor für die Verbesserung der Lebensqualität, die Steigerung des Wirtschaftswachstums und die Verminderung von Armut, insbesondere in Entwicklungsländern.
Wie wird Bildung in der Wirtschaftswissenschaft am besten gemessen?
Der gängigste quantitative Schätzer ist die durchschnittliche Anzahl der Schuljahre, die ein Individuum der arbeitenden Bevölkerung absolviert hat.
Was ist der Unterschied zwischen dem "Input Approach" und dem "Output Approach"?
Der Input Ansatz misst Ressourcen wie Bildungsausgaben, während der Output Ansatz das tatsächliche Wissen (z. B. durch PISA-Tests) bewertet.
Was versteht man unter dem Humankapital eines Landes?
Humankapital ist eine bewertete Größe der Ausbildung, die in der Wachstumstheorie genutzt wird, um die ökonomischen Auswirkungen von Bildung zu untersuchen.
Warum ist die Verteilung von Bildung innerhalb einer Gesellschaft wichtig?
Die Verteilung (gemessen z. B. durch den Gini-Koeffizienten) beeinflusst maßgeblich die Einkommensentwicklung und die soziale Gerechtigkeit eines Landes.
- Citar trabajo
- Florian Warstat (Autor), 2002, Auswirkungen von Bildungspolitik auf Wachstum und Verteilung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13207