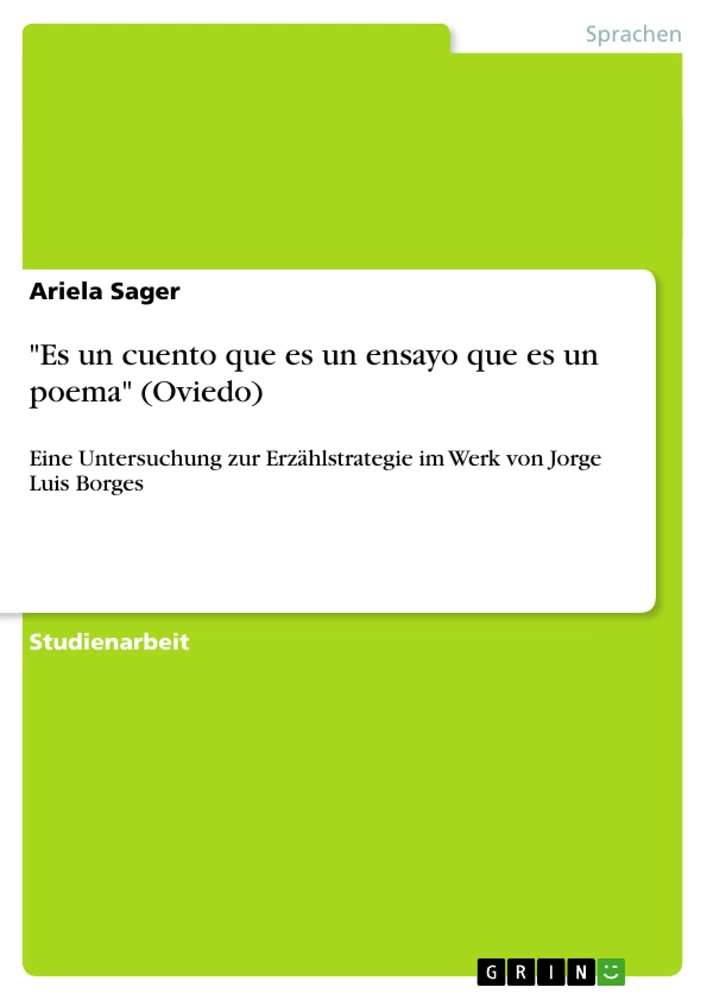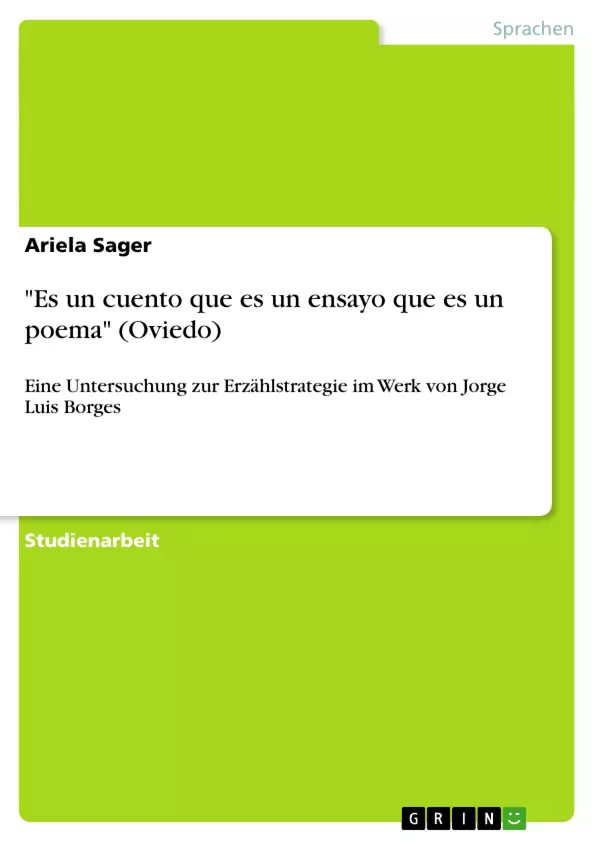„Borges descubre en su obra, o quizás inventa, otra dimensión de lo real“ (José Luis Rodríguez Zapatero). Entdecken oder erfinden, um diese beiden Verben scheinen sich die Arbeiten des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges zu formieren. Die Unterscheidung, ob Realität in Text geschrieben und damit entdeckt oder ob Fiktion als Realität ausgegeben und damit erfunden wird, ist für den Leser nicht immer eindeutig zu treffen. Für gewöhnlich beobachtet man in Lesungen oder in Feuilletoninterviews bei Autoren die Tendenz, dass die autobiographischen Züge in ihren fiktionalen Texten Lesern und Kritikern gegenüber möglichst verheimlicht, ja vertuscht oder zumindest herunter gespielt werden. Vermutlich wird dieser Versuch unternommen, um nicht dem Vorwurf des Unkünstlerischen ausgesetzt zu werden, der Kritik, „zu autobiographisch zu schreiben“, zu wenig zu verfremden, vielleicht auch, um das Private vor dem Zugriff der Leser zu schützen, sobald es zu einem persönlichen Dialog kommt. Bei Jorge Luis Borges scheint die Kunst anders geartet zu sein. Es scheint, als würde er in seinen Texten am liebsten den Eindruck erwecken, alles Erzählte sei selbst erlebt und was vom Leser als erfunden aufgenommen werden soll, wird deutlich als Fiktion ausgewiesen, so dass die anderen Textteile umso biographischer scheinen können: „Ich nehme an, daß alles, was ich schreibe, biographisch ist, nur daß ich die Vorgänge nicht direkt erzähle. Ich ziehe es vor, mich in Symbolen auszudrücken“ (nach Fritz Rudolf Fries), zitiert Fries den Autor aus einem Interview, das 1964 mit Borges geführt wurde. Was die folgende Arbeit untersuchen will, ist die Strategie, mit der Borges diese Selbst- und Text-Inszenierung verfolgt, bei der es dem Leser schwer gemacht wird zu unterscheiden, was im Text entdeckt und was erfunden wurde, wenn doch vom Autor auf beides hin gezielt wird. Mit welchen Verfahren sorgt Borges für das Verschwimmen von faktualem und fiktionalem Erzählen bzw. welche Mittel sorgen dafür, dass vom Leser faktuales Erzählen angenommen wird, obwohl Fiktion vorliegt oder umgekehrt? Und letztlich: Welche Bedeutung lässt sich aus diesem Verfahren herauslesen? Die Arbeit untersucht die Texte eher dekonstruktivistisch, vor allem aber aus der Perspektive der lernenden Autorin und nimmt dabei hauptsächlich Bezug auf die Erzählungen aus Artificios.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeugenaussage Erzählung
- Überredungskunst
- Borges und das Ich
- Fiktion Welt
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Erzählstrategie von Jorge Luis Borges und untersucht, wie er in seinen Texten die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt. Dabei wird analysiert, wie Borges den Leser glauben machen möchte, dass das Erzählte selbst erlebt wurde, obwohl es sich um Fiktion handelt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Erzählungen aus Artificios und untersucht die Verfahren, mit denen Borges die Selbst- und Text-Inszenierung verfolgt.
- Die Verschwimmung von faktualem und fiktionalem Erzählen
- Die Mittel, die Borges einsetzt, um dem Leser faktuales Erzählen vorzugaukeln, obwohl Fiktion vorliegt
- Die Bedeutung des Verfahrens für die Interpretation der Texte
- Die Rolle der autobiographischen Elemente in Borges' Werk
- Die Frage, ob Borges Realität in Text schreibt oder Fiktion als Realität ausgibt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Frage nach der Erzählstrategie von Jorge Luis Borges. Dabei wird die besondere Art und Weise beleuchtet, wie Borges in seinen Texten die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt. Die Einleitung stellt die These auf, dass Borges den Leser glauben machen möchte, dass das Erzählte selbst erlebt wurde, obwohl es sich um Fiktion handelt.
Das Kapitel „Zeugenaussage Erzählung“ analysiert die Rolle der Spiegelmetapher in Borges' Werk und untersucht, wie Borges den Leser durch die Verwendung von „Straßen- oder Landkarten“ als Metapher für seine Fiktion in die Irre führt. Das Kapitel beleuchtet die Frage, ob Borges' Texte als Mimesis, als Nachahmung von Realität, verstanden werden können oder ob sie eher als „wirkliche Fiktion“ gelesen werden sollten.
Das Kapitel „Überredungskunst“ untersucht die Schreibstrategie von Borges, die auf einem intensiven Einsatz beglaubigender Faktoren beruht, die das Erzählte meist direkt in der Lebenswelt des Autors situieren. Das Kapitel analysiert, wie Borges den Leser durch die Verwendung von „Zeugenaussagen“ in seinen Texten überzeugen möchte, dass das Erzählte real ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Erzählstrategie von Jorge Luis Borges, die Verschwimmung von Realität und Fiktion, die Rolle der autobiographischen Elemente in Borges' Werk, die Verwendung von Metaphern und die Frage nach der Interpretation der Texte. Die Arbeit untersucht, wie Borges den Leser durch die Verwendung von „Zeugenaussagen“ und anderen beglaubigenden Faktoren in seinen Texten überzeugen möchte, dass das Erzählte real ist.
Häufig gestellte Fragen
Wie verwischt Jorge Luis Borges die Grenzen zwischen Realität und Fiktion?
Borges nutzt Strategien der Selbstinszenierung, bei denen er fiktive Ereignisse durch biographische Details, Fußnoten und reale Bezüge wie eine Zeugenaussage wirken lässt.
Was ist das Ziel von Borges' Erzählstrategie?
Er möchte den Leser im Unklaren darüber lassen, was im Text entdeckt (Realität) und was erfunden (Fiktion) wurde, um eine "andere Dimension des Realen" zu schaffen.
Welche Rolle spielen autobiographische Elemente in seinem Werk?
Borges behauptet selbst, dass alles, was er schreibt, biographisch sei, er sich jedoch lieber in Symbolen ausdrückt, anstatt direkt zu erzählen.
Was wird im Kapitel „Zeugenaussage Erzählung“ untersucht?
Es analysiert die Rolle von Metaphern wie Spiegeln oder Landkarten, die Borges nutzt, um den Leser in seine fiktive Welt hineinzuziehen und gleichzeitig zu täuschen.
Auf welche Texte von Borges bezieht sich die Arbeit hauptsächlich?
Die Untersuchung konzentriert sich vor allem auf die Erzählungen aus dem Band „Artificios“.
Was bedeutet „Überredungskunst“ im Kontext von Borges?
Es bezieht sich auf seinen Einsatz beglaubigender Faktoren, die das Erzählte direkt in der Lebenswelt des Autors verankern, um den Leser von der Echtheit der Fiktion zu überzeugen.
- Citation du texte
- Ariela Sager (Auteur), 2009, "Es un cuento que es un ensayo que es un poema" (Oviedo), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132140