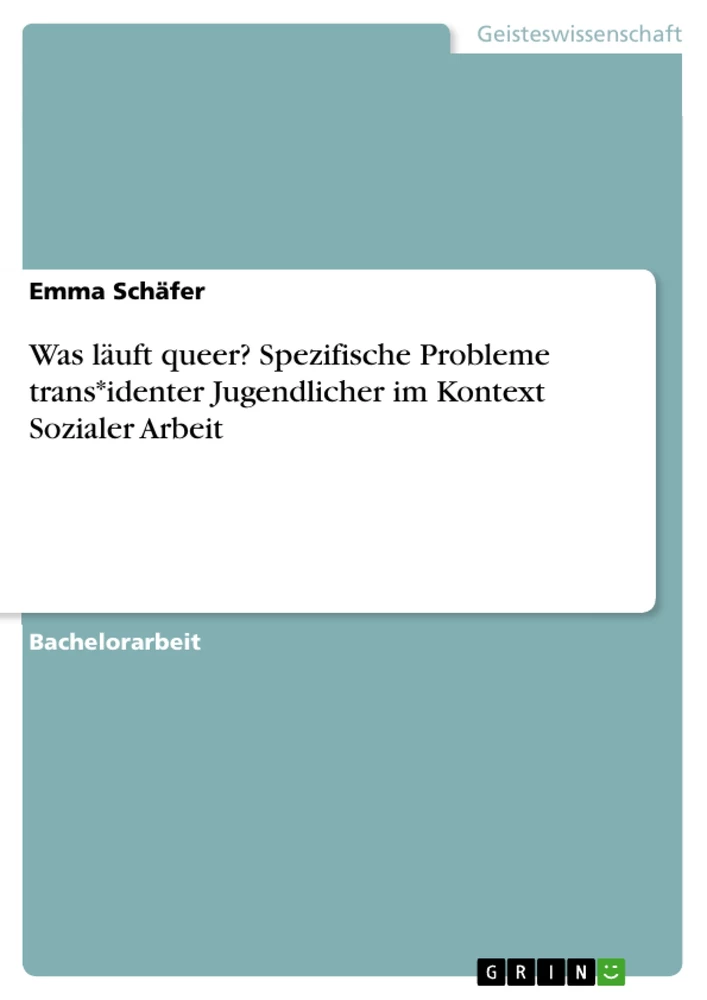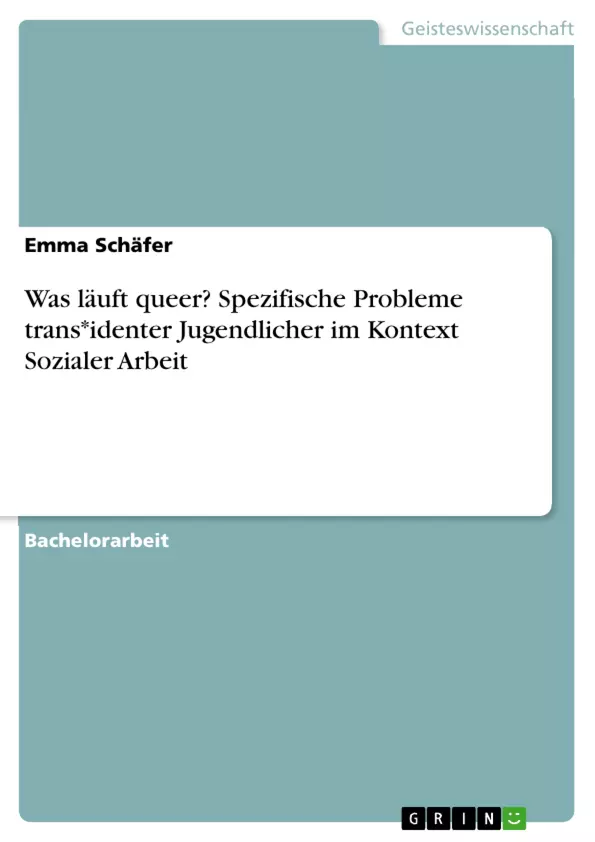Durch die zunehmende, oft tabuisierte oder unerwünschte Präsenz der Thematik geriet die Betrachtung von Trans*identität auch im wissenschaftlichen Kontext in den Fokus. Da das Jugendalter, mit der der Entwicklungsaufgabe der Entwicklung einer (geschlechtlichen) Identität einhergeht, hat die folgende Arbeit trans*idente Jugendliche als Gegenstand. Das Ziel der literaturanalytischen Arbeit ist zunächst die Beantwortung der Frage, mit welchen spezifischen Problemen trans*idente Jugendliche in Deutschland konfrontiert sind. Dabei werden unter dem Begriff der spezifischen Probleme, all jene Probleme verstanden, welche sich auf Grund der geschlechtlichen Orientierung der jugendlichen Trans* ergeben. Nachdem diese dargestellt wurden, wird die Frage beantwortet, welchen Beitrag die Soziale Arbeit zur Verbesserung der Lage der Jugendlichen leisten kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Begriffsdefinitionen
- 3.1 LSBTI*Q
- 3.2 Sexuelle und geschlechtliche Orientierung
- 3.3 Trans*identität
- 3.4 Passing
- 4. Das „System“ der Heteronormativität
- 4.1 Rechtliche Bedingungen
- 4.2 Medizinischer Kontext
- 4.3 Forderungen zur Selbstbestimmung und Entpathologisierung
- 5. Trans*idente Jugendliche
- 5.1 Coming-Out
- 5.1.1 Chancen, Risiken und Bedingungen
- 5.2 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- 5.3 Entwicklung der Identität
- 5.4 Lebenswelt trans*identer Jugendlicher
- 5.4.1 Familie
- 5.4.2 Freund*innen/Peergroup
- 5.4.3 Ausbildungsstätte
- 5.4.4 Community/Internet
- 6. Bezug zur Sozialen Arbeit
- 6.1 Relevanz für die Soziale Arbeit
- 6.2 Der heteronormative Einfluss auf die Soziale Arbeit
- 6.3 Zugänge der Sozialen Arbeit
- 6.4 Anforderungen an Fachkräfte
- 6.5 Einflussnahme queerer Jugendarbeit
- 6.6 Kritik an LSBTI*Q spezifischen Angeboten in der Sozialen Arbeit
- 7. Entwicklung Workshop
- 7.1 Bedarfsanalyse
- 7.2 Zielgruppenanalyse
- 7.3 Organisationsform
- 7.4 Lernzielformulierung
- 7.5 Planung
- 7.5.1 Tag 1
- 7.5.2 Tag 2
- 7.6 Chancen und Grenzen
- 8. Zusammenfassung und Ausblick
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den spezifischen Problemen trans*identer Jugendlicher im Kontext Sozialer Arbeit. Ziel ist es, die Herausforderungen, denen diese Jugendlichen im deutschen Kontext gegenüberstehen, zu beleuchten und die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu erörtern.
- Herausforderungen, denen trans*idente Jugendliche im deutschen Kontext gegenüberstehen
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Verbesserung der Lebensbedingungen trans*identer Jugendlicher
- Sensibilisierung für die Thematik Trans*identität in der Freizeitpädagogik
- Entwicklung eines Workshops zur Sensibilisierung ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen im Freizeitbereich
- Kritische Auseinandersetzung mit der queeren Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen darlegt. Im Anschluss wird der Forschungsstand zur Trans*identität im Kontext Sozialer Arbeit beschrieben. Kapitel 3 definiert wichtige Begriffe, wie LSBTI*Q, sexuelle und geschlechtliche Orientierung, Trans*identität und Passing. Kapitel 4 beleuchtet das "System" der Heteronormativität, insbesondere die rechtlichen und medizinischen Bedingungen, die trans*idente Jugendliche benachteiligen. Es werden auch Forderungen zur Selbstbestimmung und Entpathologisierung vorgestellt.
Kapitel 5 befasst sich mit den spezifischen Problemen trans*identer Jugendlicher, darunter der Coming-Out Prozess, die Entwicklungsaufgaben im Jugendalter und die Entwicklung der Identität. Die Lebenswelt trans*identer Jugendlicher wird anhand von verschiedenen Studien und Beispielen beleuchtet. Kapitel 6 erörtert den Bezug der Sozialen Arbeit zur Thematik, die Relevanz für die Soziale Arbeit und den Einfluss des heteronormativen Systems auf die Sozialarbeit. Es werden trans*freundliche Zugänge der Sozialen Arbeit vorgestellt sowie die Anforderungen an Fachkräfte. Kapitel 6.5 befasst sich mit der queeren Jugendhilfe und Kapitel 6.6 kritisiert die Differenzierung von Jugendlichen in "straight" und "queer".
Abschließend wird ein Workshop entworfen, der junge, ehrenamtlich tätige Erwachsene für das Thema der Trans*identität sensibilisieren soll.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Trans*identität, Coming-Out, Heteronormativität, Selbstbestimmung, Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, Identität, Lebenswelt trans*identer Jugendlicher, Soziale Arbeit, queere Jugendarbeit, Sensibilisierung und Workshop.
Häufig gestellte Fragen
Mit welchen spezifischen Problemen sind trans*idente Jugendliche in Deutschland konfrontiert?
Trans*idente Jugendliche stehen vor Herausforderungen, die sich aus dem System der Heteronormativität ergeben. Dazu gehören rechtliche Barrieren, Diskriminierung im medizinischen Kontext sowie Probleme im familiären Umfeld, in Freundeskreisen und in Bildungseinrichtungen.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Unterstützung trans*identer Jugendlicher?
Die Soziale Arbeit trägt zur Verbesserung der Lebenslage bei, indem sie sensibilisiert, Beratungsangebote schafft und die Selbstbestimmung der Jugendlichen fördert. Sie arbeitet gegen Diskriminierung und unterstützt den Coming-out-Prozess.
Was wird unter dem Begriff "Passing" verstanden?
Passing beschreibt in diesem Kontext den Umstand, dass eine trans*idente Person von ihrer Umwelt als das Geschlecht wahrgenommen wird, mit dem sie sich identifiziert, was oft einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Sicherheit im Alltag hat.
Welche Anforderungen werden an Fachkräfte in der queeren Jugendarbeit gestellt?
Fachkräfte müssen über eine hohe Sensibilität für geschlechtliche Vielfalt verfügen, heteronormative Strukturen kritisch hinterfragen können und fundiertes Wissen über die spezifischen Lebenswelten von LSBTI*Q-Jugendlichen besitzen.
Wie kann ein Workshop zur Sensibilisierung beitragen?
Ein gezielter Workshop für ehrenamtliche Mitarbeiter kann Vorurteile abbauen, Wissen über Trans*identität vermitteln und konkrete Handlungskompetenzen für den Umgang mit queeren Jugendlichen in der Freizeitpädagogik stärken.
- Quote paper
- Emma Schäfer (Author), 2022, Was läuft queer? Spezifische Probleme trans*identer Jugendlicher im Kontext Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1327780