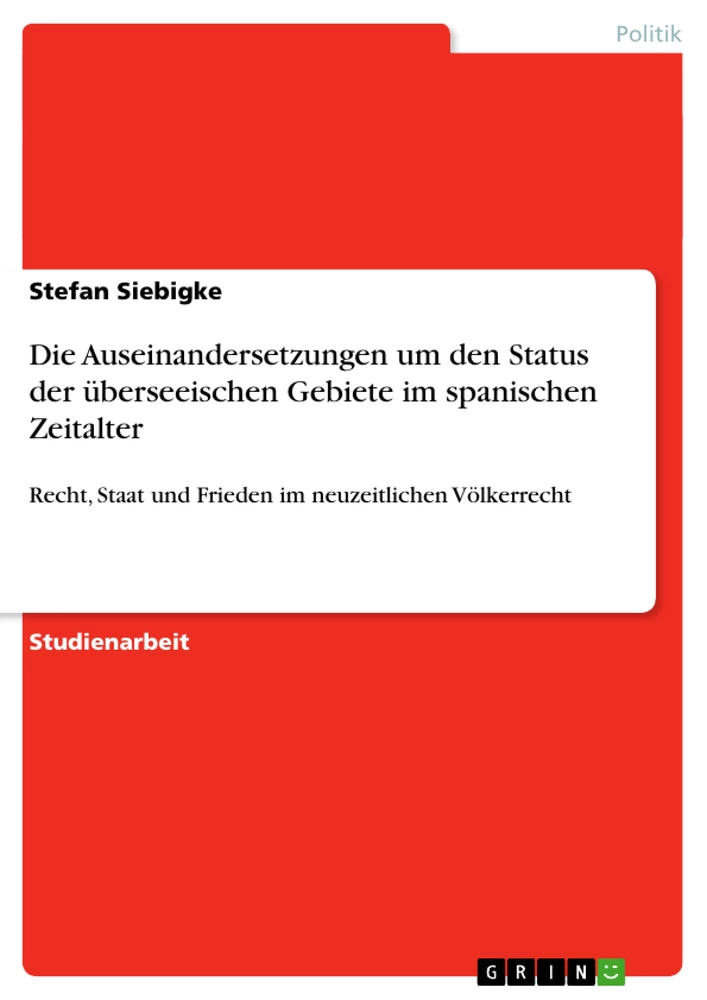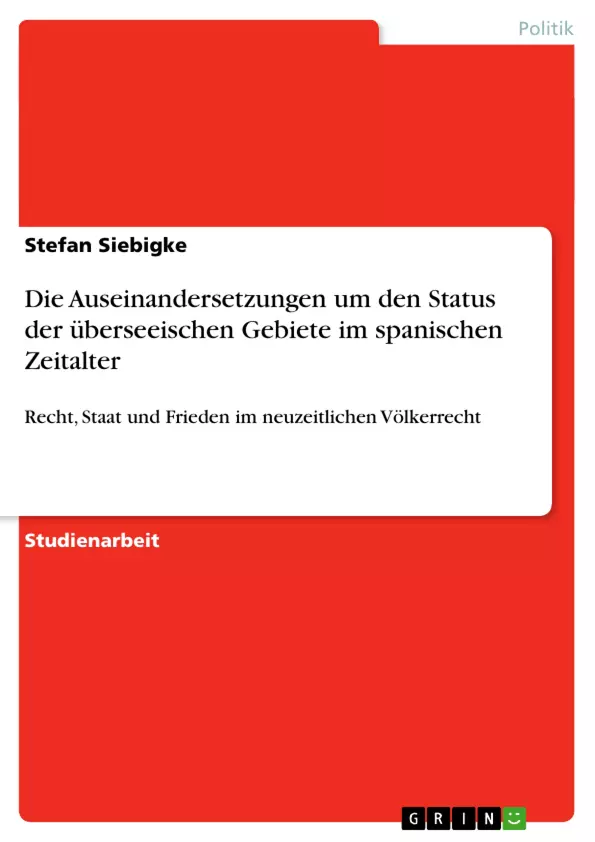Als am 12. Oktober im Jahre 1492 die Spanier auf der kleinen Bahamainsel Guanahani zum ersten Mal amerikanischen Boden betraten, war das Schicksal der Neuen Welt besiegelt. Am 15. März 1493 kehrte Columbus von seiner Rei-se zurück nach Spanien. Dem Irrglauben folgend, er hätte die Ostküste Asiens gefunden und somit die portugiesische Interessensphäre berührt, begannen die Auseinandersetzungen Spaniens mit Portugal über den Besitz der Neuen Welt. Noch im selben Jahr konferierten beide Staaten über Monate hinweg, ohne ein Ergebnis zu erzielen. Portugal bezog sich auf päpstlich verliehene Rechte an allen neu entdeckten Ländern, woraufhin die Spanier sich ihrerseits von dem spanischen Papst Alexander VI. die Rechte an dem Besitz der Neuen Welt zu-sprechen ließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Ursprünge des modernen Völkerrechts
- Das Völkerrecht unmittelbar vor der Entdeckung Übersees
- Der Völkerrechtsverkehr zwischen den europäischen Mächten in Bezug auf die überseeischen Gebiete
- Das iberische Monopol
- Spanien-Portugal und Frankreich
- Spanien-Portugal und England
- Spanien Portugal und die Niederlande
- Schlussbetrachtungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die völkerrechtlichen Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete im spanischen Zeitalter. Sie untersucht die historischen Hintergründe, die Entstehung des iberischen Monopols und die daraus resultierenden Konflikte mit anderen europäischen Mächten. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Völkerrechts im Kontext der Entdeckung und Kolonisierung Amerikas.
- Die Rolle des Völkerrechts in der Kolonialisierung Amerikas
- Die Auseinandersetzungen zwischen Spanien und Portugal um die Vorherrschaft in der Neuen Welt
- Die Entwicklung des iberischen Monopols und seine völkerrechtlichen Implikationen
- Die Konflikte mit anderen europäischen Mächten um den Zugang zu den überseeischen Gebieten
- Die völkerrechtlichen Konsequenzen der Kolonialisierung für die indigene Bevölkerung Amerikas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die historische Bedeutung der Entdeckung Amerikas für die Entwicklung des Völkerrechts dar. Sie beleuchtet die frühen Auseinandersetzungen zwischen Spanien und Portugal um die Vorherrschaft in der Neuen Welt und die Rolle des päpstlichen Edikts „Inter caetera“ und des Vertrags von Tordesillas.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Ursprüngen des modernen Völkerrechts. Es untersucht die Entwicklung des Völkerrechts in der Antike und im Mittelalter und zeigt die Bedeutung von Verträgen und Gewohnheitsrecht für die Gestaltung der Beziehungen zwischen Staaten.
Das dritte Kapitel analysiert die Situation des Völkerrechts unmittelbar vor der Entdeckung Übersees. Es beleuchtet die Rechtsordnung der christlichen europäischen Staatswesen des Mittelalters und die Herausforderungen, die sich durch die Entdeckung neuer Gebiete stellten.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Völkerrechtsverkehr zwischen den europäischen Mächten in Bezug auf die überseeischen Gebiete. Es untersucht die Entstehung des iberischen Monopols, die Konflikte mit Frankreich, England und den Niederlanden sowie die völkerrechtlichen Implikationen dieser Auseinandersetzungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Völkerrecht, die Kolonialisierung Amerikas, das spanische Zeitalter, das iberische Monopol, die Entdeckung Übersees, die Auseinandersetzungen zwischen Spanien und Portugal, die völkerrechtlichen Konsequenzen der Kolonialisierung und die Entwicklung des modernen Völkerrechts.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Vertrag von Tordesillas?
Ein Abkommen von 1494, das die neu entdeckten Gebiete außerhalb Europas zwischen Spanien und Portugal aufteilte, um Konflikte zu vermeiden.
Welche Rolle spielte der Papst bei der Entdeckung Amerikas?
Papst Alexander VI. verlieh Spanien durch päpstliche Edikte (wie „Inter caetera“) Rechte an den neu entdeckten Ländern, was völkerrechtlich legitimierend wirken sollte.
Was versteht man unter dem „iberischen Monopol“?
Der Anspruch von Spanien und Portugal, den Zugang und Handel mit den überseeischen Gebieten allein zu kontrollieren und andere europäische Mächte auszuschließen.
Wie reagierten England, Frankreich und die Niederlande auf diesen Anspruch?
Sie forderten das Monopol heraus, was zu langwierigen völkerrechtlichen Auseinandersetzungen und kriegerischen Konflikten um den Zugang zur „Neuen Welt“ führte.
Wie beeinflusste die Kolonialisierung die Entwicklung des modernen Völkerrechts?
Die Notwendigkeit, Ansprüche über weite Entfernungen zu regeln, führte zur Weiterentwicklung von Konzepten wie dem Gewohnheitsrecht und internationalen Verträgen.
- Quote paper
- Stefan Siebigke (Author), 2003, Die Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete im spanischen Zeitalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133170