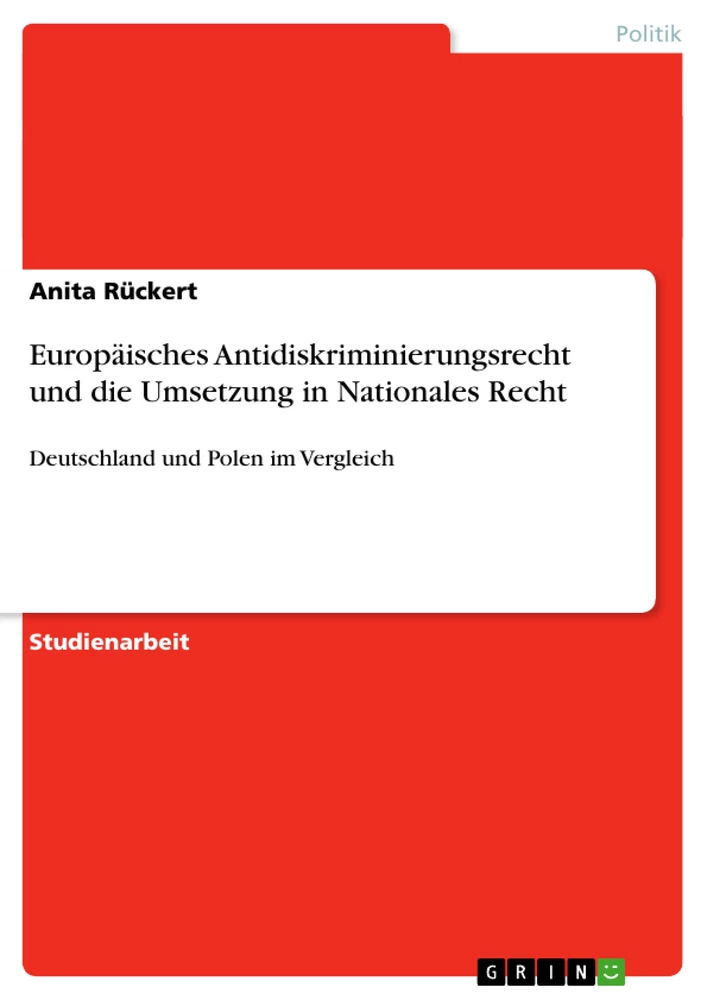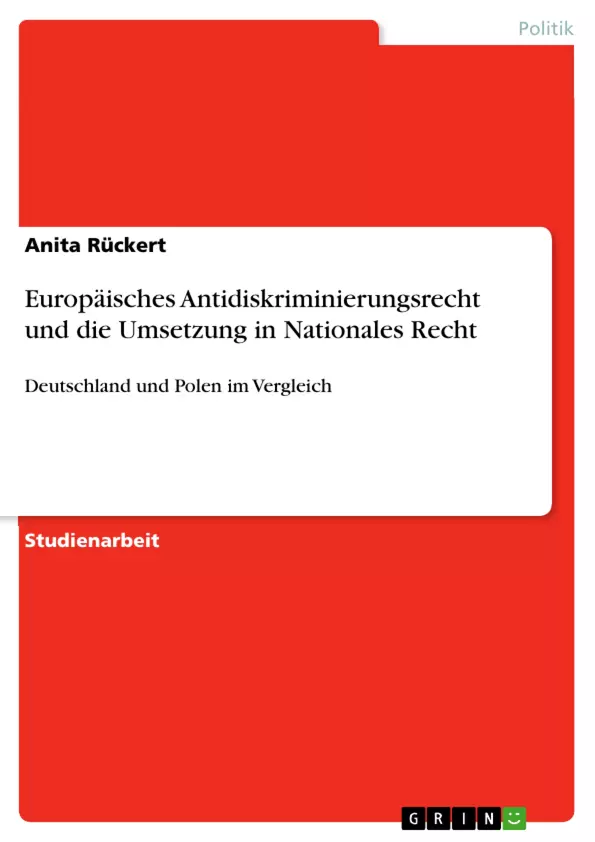Die Europäische Union ist zuallererst eine Wertegemeinschaft, in der die Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, der Gleichstellung und der Nichtdiskriminierung zu den Werten gehören, denen „größte Wertschätzung entgegengebracht wird. Das Grundprinzip - und somit auch die Tätigkeitsbereiche - der Gemeinschaft ist, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern (Art. 3 Abs. 2 EG). Da Werte das Rechtssystem prägen, gibt es eine Reihe von Diskriminierungsverboten im Europäischen Recht.
Bereits Mitte der achtziger Jahre war der Kampf gegen Diskriminierung, insbesondere die Bekämpfung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Thema auf europäischer Ebene. Die Gemeinschaft hatte jedoch lediglich Kompetenzen in Form von Erklärungen und Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. Daher wurden, insbesondere vom Parlament, bindende Maßnahmen gefordert. Mit dem Amsterdamer Vertrag 1997 wurde dann Art. 13 EGV ins europäische Primärrecht eingefügt, der den gemeinsamen Willen ausdrückt, Diskriminierungen aufgrund anderer Faktoren (Geschlecht, Rasse, ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung) zu bekämpfen, also nicht nur Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern aktiv dagegen vorzugehen. Somit gab es erstmals die Möglichkeit ohne Bindung an Vorgaben auf europäischer Ebene Rechtsvorschriften (Verordnungen und Richtlinien) mit dem Ziel der Bekämpfung von Diskriminierung wegen Be-hinderung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu erlassen. Die Anti-Diskriminierungsrichtlinien, welche als Grundlage für die Diskriminierungsverbote im nationalen Recht in einzelnen europäischen Staaten dienen und auf die im Folgenden näher eingegangen wird, wurden auf Grundlage des Art. 13 des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft (EG) erlassen.
Diese Thematik ist äußerst umfangreich und daher soll im Folgenden lediglich ein Überblick anhand der Staaten Deutschland und Polen gegeben werden, inwieweit die vier Antidiskriminierungsrichtlinien in nationales Recht umgesetzt wurden. Dazu werden Vorab die elementaren Inhalte der einzelnen Richtlinien aufgeführt um dann den Stand einiger wesentlicher Kriterien bezüglich der Umsetzung als auch der noch vorhandenen Defizite aufzugreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Die Richtlinien
- RL 2000/43/EG - Antirassismusrichtlinie
- RL 2000/78/EG — Rahmenrichtlinie Beschäftigung und Beruf
- RL 2002/73/EG- „Gender-Richtlinie"
- RL 2004/113/EG — Gleichbehandlung Geschlecht bei Gütern und Dienstleistungen
- Die Umsetzung in nationales Recht
- Umsetzung in Deutschland
- Umsetzung in Polen
- Defizite bei der Umsetzung
- Defizite in Deutschland
- Defizite in Polen
- Fazit
- Anlagen
- Anlage 1
- Anlage 2
- Anlage 3
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit dem europäischen Antidiskriminierungsrecht und dessen Umsetzung in nationales Recht, insbesondere in Deutschland und Polen. Sie analysiert die vier wichtigsten Antidiskriminierungsrichtlinien der EU und untersucht, inwieweit deren Vorgaben in den beiden Ländern erfüllt wurden. Die Arbeit soll einen Überblick über den Stand der Umsetzung des europäischen Antidiskriminierungsrechts in Deutschland und Polen geben und die wichtigsten Defizite aufzeigen.
- Die vier Antidiskriminierungsrichtlinien der EU
- Die Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht
- Defizite bei der Umsetzung der Richtlinien
- Der Schutz vor Diskriminierung in Deutschland und Polen
- Die Bedeutung von Werten für die Bekämpfung von Diskriminierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung des europäischen Antidiskriminierungsrechts vor und führt in die Thematik ein. Im zweiten Kapitel werden die vier wichtigsten Antidiskriminierungsrichtlinien der EU vorgestellt, wobei die Inhalte der einzelnen Richtlinien kurz erläutert werden. Im dritten Kapitel werden die Umsetzungen der Richtlinien in nationales Recht in Deutschland und Polen näher beleuchtet. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Defiziten bei der Umsetzung der Richtlinien in beiden Ländern. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Europäische Antidiskriminierungsrecht, die Umsetzung in nationales Recht, Deutschland, Polen, Antirassismusrichtlinie, Rahmenrichtlinie Beschäftigung und Beruf, Gender-Richtlinie, Gleichbehandlung Geschlecht bei Gütern und Dienstleistungen, Defizite, Schutz der Betroffenen, Beweislast, Gleichstellungseinrichtungen, Wertewandel.
Häufig gestellte Fragen
Welche EU-Antidiskriminierungsrichtlinien gibt es?
Es gibt vier Hauptrichtlinien: die Antirassismusrichtlinie (2000/43/EG), die Rahmenrichtlinie Beschäftigung (2000/78/EG), die Gender-Richtlinie (2002/73/EG) und die Richtlinie zur Gleichbehandlung bei Gütern und Dienstleistungen (2004/113/EG).
Wie wurde das EU-Recht in Deutschland umgesetzt?
In Deutschland erfolgte die Umsetzung primär durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), um Diskriminierung in Beruf und Alltag zu bekämpfen.
Was sind typische Defizite bei der Umsetzung in Polen?
Die Arbeit weist auf Lücken im Rechtsschutz und bei der Etablierung wirksamer Gleichstellungseinrichtungen hin, die den EU-Vorgaben noch nicht voll entsprechen.
Was änderte der Vertrag von Amsterdam 1997?
Mit Art. 13 EGV erhielt die EU erstmals die Kompetenz, aktiv gegen Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung vorzugehen.
Welche Rolle spielt die Beweislast im Antidiskriminierungsrecht?
Die Richtlinien sehen oft eine Beweislasterleichterung vor: Wenn Indizien für eine Diskriminierung vorliegen, muss die Gegenseite beweisen, dass kein Verstoß vorlag.
- Arbeit zitieren
- LL.B. Anita Rückert (Autor:in), 2009, Europäisches Antidiskriminierungsrecht und die Umsetzung in Nationales Recht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133222