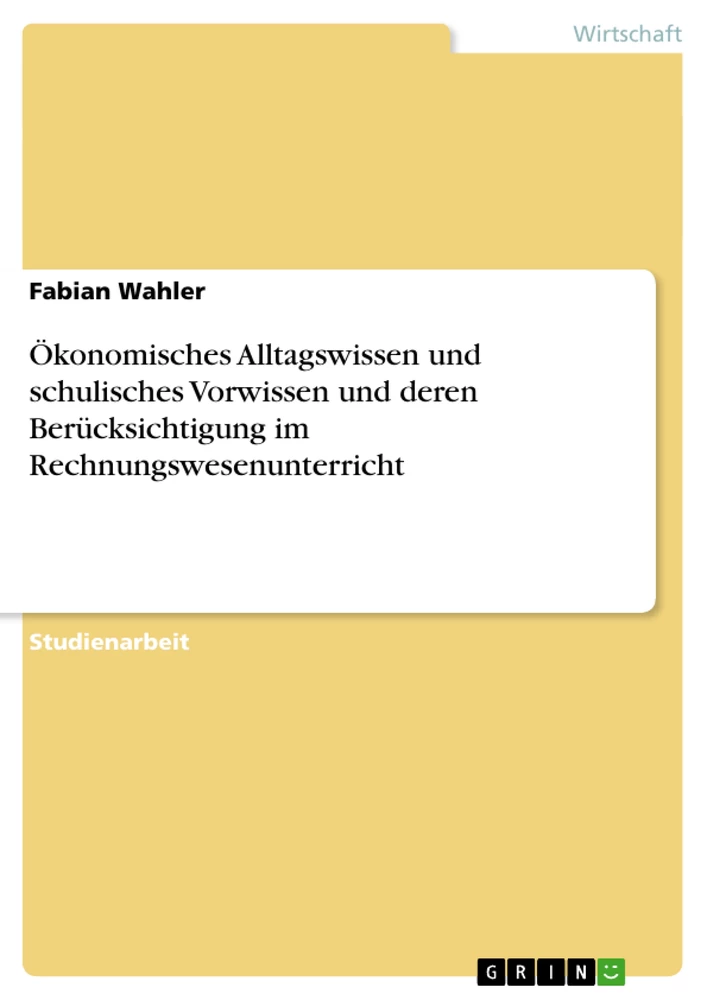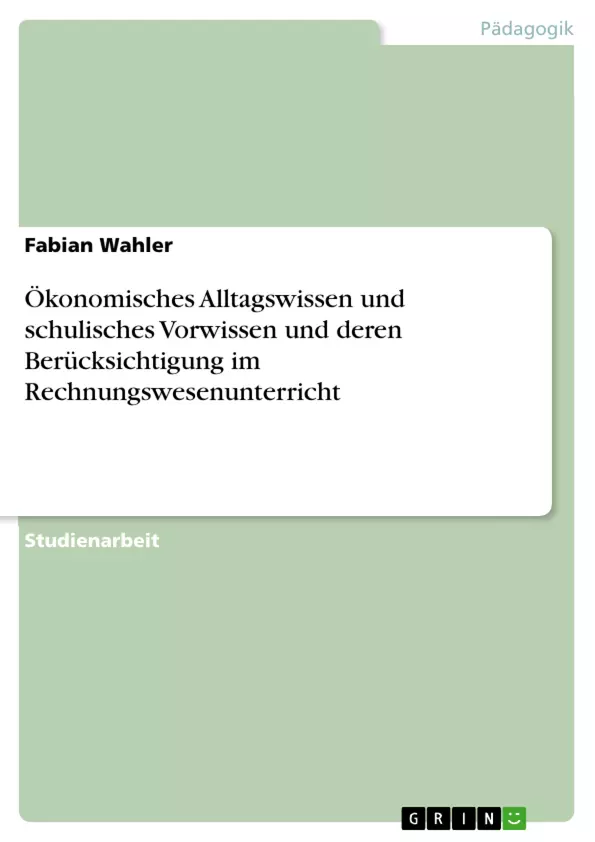Unsere Gesellschaft sieht sich einem nicht zu übersehenden Wandel in
wirtschaftlichen, sozialen und geographischen Bereichen ausgesetzt.
Knappheit der Ressourcen, Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten
und das Aufstreben der fernöstlichen Wirtschaftsnationen sind nur einige, in der
aktuellen Tagespresse nahezu täglich auftauchende, Schlagworte, die uns
darauf aufmerksam machen, dass ein auf den Binnenmarkt beschränkter
wirtschaftlicher Blick globalen Herausforderungen gewichen ist.
Durch diesen Strukturwandel, in den hier nur schlagwortartig angedeuteten
wirtschaftlichen Bereichen, sehen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im kaufmännischen
Bereich in den kommenden Jahren neuen Technologien und
Herausforderungen ausgesetzt, welche WEBER bereits 1994 mit einem Rückgang
des „Tayloristischen Prinzip[s] der Arbeitsorganisation […] zu Gunsten
neuer komplexer Formen der Aufgabenstrukturierung“ (WEBER 1994, 1) beschreib.
Es stellt sich folglich die Frage, wie insbesondere Arbeitnehmer für dieses neue
Anforderungsprofil ausgebildet werden und inwieweit kaufmännischer Unterricht
die Schüler auf den Berufsalltag vorbereitet. Hierbei ist interessant, mit
welchem Vorwissen Schüler in den Unterricht kommen und inwiefern dieses
Wissen konform mit dem ist, was sie lernen sollen.
Im Hinblick auf die Fähigkeiten und Erfahrungen treffen Lehrer stets auf Schüler
mit individuellen Lernbiographien. Jeder Mensch macht im Laufe seines Lebens
Alltagserfahrungen und verfügt hierdurch über psychologisches, technisches
oder auch physikalisches Alltagswissen, welches er sich in unterschiedlichen
Lebensbereichen angeeignet hat. (Vgl. JUNG 1981, WAHL 1981).
Zieht man verschiedene theoretische Ansätze zur Unterrichtsdidaktik heran, so
zeigt sich, dass dem Vorwissen der Lernenden immer wieder eine nicht unerhebliche
Bedeutung für die Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements beigemessen
wird (Vgl. HEIMANN, OTTO & SCHULZ 1972, KLAFKI 1981, DUBS 1987,
MEYER 1991, PÄTZOLD 1993). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Wissen und Vorwissen im Unterricht
- 2.1 Conceptual change - Der Umgang mit Alltagsvorstellungen im Unterricht
- 2.2 Aktivierung von Wissen im Lernprozess
- 2.3 Ökonomisches Alltagswissen und schulisches Vorwissen
- 3 Konzeption der Studie
- 3.1 Erstellung der Sachstrukturdiagramme
- 3.2 Kodierung der Merkmale ökonomisches Alltagswissen und schulisches Vorwissen
- 4 Empirische Befunde
- 4.1 Häufigkeit der Bezugnahme auf Vorwissen aus Alltag und Schule
- 4.2 Zeitpunkt und Unterrichtsphase der Bezugnahme auf Vorwissen aus Alltag und Schule
- 4.3 Unterschiede der Bezugnahme hinsichtlich verschiedener Lehrkräfte und der Unterrichtsmethode
- 5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Alltagswissen und schulisches Vorwissen im Rechnungswesenunterricht. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Vorwissens für die didaktische Gestaltung des Unterrichts zu erforschen und zu analysieren, wann und wie Lehrkräfte darauf Bezug nehmen. Die Studie beleuchtet die Interaktion zwischen Alltagsvorstellungen und dem im Unterricht vermittelten Wissen.
- Bedeutung von Alltagswissen und schulisches Vorwissen im Rechnungswesenunterricht
- Zeitpunkt und Phase des Bezugs auf Vorwissen im Unterricht
- Einfluss von Lehrkräften und Unterrichtsmethoden auf die Berücksichtigung von Vorwissen
- Conceptual Change als Ansatz zum Umgang mit Alltagsvorstellungen
- Aktivierung von Wissen im Lernprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Die Arbeit thematisiert den Wandel in wirtschaftlichen Bereichen und die damit verbundenen Herausforderungen für die kaufmännische Ausbildung. Sie fragt nach der Vorbereitung des kaufmännischen Unterrichts auf den Berufsalltag und der Rolle des Vorwissens der Schüler. Ausgehend von der Bedeutung des Vorwissens in didaktischen Modellen, wird die Frage gestellt, wie Alltagswissen und schulisches Vorwissen im Rechnungswesenunterricht berücksichtigt werden. Drei Forschungsfragen werden formuliert, die im empirischen Teil der Arbeit untersucht werden: die Rolle von Alltagsvorstellungen und schulisches Vorwissen im Unterricht, der Zeitpunkt der Bezugnahme auf dieses Wissen und Unterschiede in der Bezugnahme je nach Lehrkraft und Methode.
2 Wissen und Vorwissen im Unterricht: Dieses Kapitel legt die theoretische Grundlage der Arbeit. Es behandelt den Umgang mit Alltagsvorstellungen im Unterricht im Kontext des Conceptual Change und die Aktivierung von Wissen im Lernprozess. Der Fokus liegt auf der Transformation von Alltagswissen in wissenschaftliches Wissen und der Bedeutung des Vorwissens für die Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements. Es wird erläutert, wie bereits vorhandenes Wissen aktiviert und träges Wissen vermieden werden kann, um Anknüpfungspunkte für den Unterricht zu schaffen. Der Abschnitt beleuchtet verschiedene didaktische Modelle, welche die Wichtigkeit des Vorwissens der Lernenden betonen.
3 Konzeption der Studie: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Studie. Es erläutert die Erstellung von Sachstrukturdiagrammen zur Analyse des Vorwissens und die Kodierung der Merkmale ökonomisches Alltagswissen und schulisches Vorwissen. Die Beschreibung der methodischen Vorgehensweise liefert die Grundlage für die Interpretation der im nächsten Kapitel präsentierten empirischen Befunde. Der detaillierte Ablauf der Datenerhebung und -aufbereitung wird dargelegt, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studie zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Rechnungswesenunterricht, ökonomisches Alltagswissen, schulisches Vorwissen, Conceptual Change, Wissensaktivierung, Lehr-Lern-Arrangements, Unterrichtsdidaktik, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Rechnungswesen-Unterricht und Vorwissen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Alltagswissen und schulisches Vorwissen im Rechnungswesen-Unterricht. Sie analysiert, wie und wann Lehrkräfte auf dieses Vorwissen Bezug nehmen und welche Bedeutung es für die didaktische Gestaltung des Unterrichts hat. Ein besonderer Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Alltagsvorstellungen und dem im Unterricht vermittelten Wissen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht drei zentrale Forschungsfragen: 1. Wie wirken sich Alltagsvorstellungen und schulisches Vorwissen auf den Rechnungswesen-Unterricht aus? 2. Wann und in welcher Phase des Unterrichts wird auf dieses Vorwissen Bezug genommen? 3. Wie unterscheiden sich die Bezugnahmen auf Vorwissen je nach Lehrkraft und Unterrichtsmethode?
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien zum Conceptual Change (Umgang mit Alltagsvorstellungen im Unterricht) und zur Aktivierung von Wissen im Lernprozess. Es werden didaktische Modelle diskutiert, die die Bedeutung des Vorwissens für die Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements betonen. Der Fokus liegt auf der Transformation von Alltagswissen in wissenschaftliches Wissen und der Vermeidung von trägem Wissen.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen zu Wissen und Vorwissen im Unterricht. Kapitel 3 erläutert die Methodik der Studie (Erstellung von Sachstrukturdiagrammen und Kodierung der Merkmale). Kapitel 4 präsentiert die empirischen Befunde. Kapitel 5 bietet einen Ausblick.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet qualitative Methoden. Es wurden Sachstrukturdiagramme erstellt, um das Vorwissen der Schüler zu analysieren. Die Merkmale "ökonomisches Alltagswissen" und "schulisches Vorwissen" wurden kodiert, um die Daten auszuwerten. Die detaillierte methodische Vorgehensweise wird im Kapitel 3 beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die empirischen Befunde (Kapitel 4) untersuchen die Häufigkeit der Bezugnahme auf Vorwissen aus Alltag und Schule, den Zeitpunkt und die Unterrichtsphase dieser Bezugnahmen und die Unterschiede hinsichtlich verschiedener Lehrkräfte und Unterrichtsmethoden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Rechnungswesenunterricht, ökonomisches Alltagswissen, schulisches Vorwissen, Conceptual Change, Wissensaktivierung, Lehr-Lern-Arrangements, Unterrichtsdidaktik, empirische Forschung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung von Alltagswissen und schulisches Vorwissen für die didaktische Gestaltung des Rechnungswesen-Unterrichts zu erforschen und zu analysieren. Es soll herausgefunden werden, wie dieses Vorwissen effektiv im Unterricht genutzt werden kann, um den Lernprozess zu optimieren.
- Citar trabajo
- Fabian Wahler (Autor), 2008, Ökonomisches Alltagswissen und schulisches Vorwissen und deren Berücksichtigung im Rechnungswesenunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133257