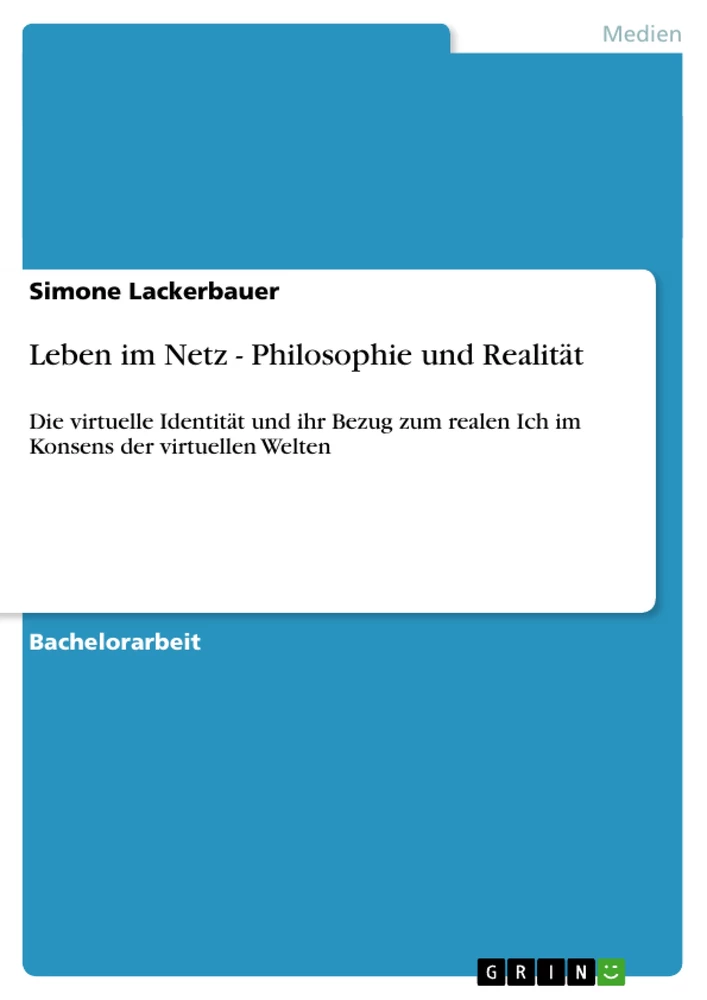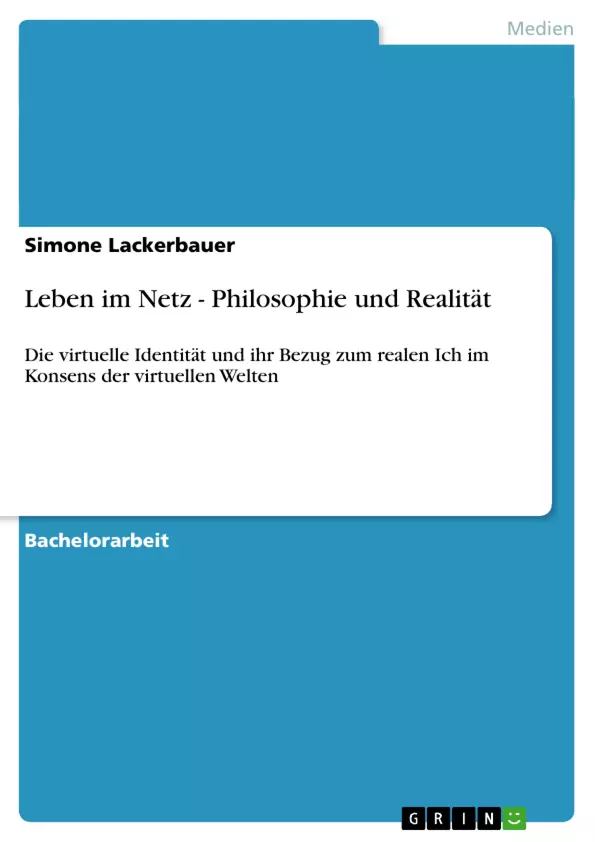Leben im Netz – Philosophie und Realität: Fragestellung, Vorgehensweise und Zielsetzung
In dieser Arbeit geht es um die Frage, inwieweit philosophische Ansätze bezüglich der Virtualität in all ihren Facetten mit den tatsächlichen Lebenswelten von Nutzern synthetischer Welten übereinstimmen und in welchen Bereichen sie divergieren.
Es soll auf der Basis von theoretischen und empirischen Ansätzen dargestellt werden, ob virtuelle Welten zur Erweiterung der eigenen Identität beitragen, oder ob das „Ich“ im virtuellen Raum in der anonymen, vernetzten Masse untergeht. Unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte virtueller Räume soll veranschaulicht werden, welche Bereiche dem Internetnutzer heute zur Verfügung stehen, um die eigene Identität zu konstatieren und zu erweitern. Die bei der Identitätsbildung ablaufenden Prozesse sollen anhand der Einflüsse durch virtuelle Räume und anhand der individuellen Motive der Nutzer analysiert und in ihrer Wirkungsweise beschrieben werden. Auf Basis der Erkenntnis der ständigen Wechselwirkungen zwischen realem und virtuellem Selbst soll festgestellt werden, inwieweit der Internet-Alltag positiven oder negativen Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Identität nehmen kann und inwieweit diese in ihrer Substanz greifbar ist. Anhand der Analyse sozialer Beziehungen auf der Basis von computervermittelter Kommunikation soll die Bedeutung von sozialen Netzwerken dargestellt werden, um das Gesamtbild der vernetzten Identität abzurunden.
Diese Arbeit versucht zu zeigen, dass der Umgang mit virtuellen Welten im Bewusstsein der Existenz eines realen Lebens außerhalb des Internet als positiv einzustufen ist. Zudem soll dargestellt werden, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, das Zweitleben im Internet mit dem normalen Leben in Verbindung zu bringen, ohne dass der Bezug zur Wirklichkeit und ohne dass das Individuum als reale Person verloren geht. Unter Berücksichtigung der Argumente für und gegen den intensiven Umgang mit Online-Netzen soll erläutert werden, dass Möglichkeiten der Selbstdarstellung für den Einzelnen im virtuellen Raum vorhanden sind und dass die Bildung von aus dem realen Leben adaptierten virtuellen Sozialstrukturen Auswirkungen auf die Wahrnehmung sozialer Beziehungen hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Fragestellung, Vorgehensweise und Zielsetzung
3. Zum Grundkonzept virtueller Welten
3.1 Begriffliche Eingrenzung
3.1.1 Virtualität. Begriffsdefinition und -gebrauch
3.1.2 Erweiterte und virtuelle Realität
3.2 Was ist Cyberspace?
3.2.1 Cyberspace: Eine Begriffsdefinition
3.2.2 Die Entstehung des Mythos Cyberspace
3.2.3 Höhepunkte und Niedergang der Ära Cyberspace
3.2.4 Begriffsverwendung in der heutigen Zeit
3.2.5 Die Etablierung des Internet
3.3 Synthetische Welten
3.3.1 Was sind synthetische Welten?
3.3.2 Textbasierte synthetische Welten
3.3.3 Soziale Software und Netzwerke
3.3.4 Die Bedeutung der Online-Games
3.3.5 Medienkompetenz zwischen Simulation und Realität
4. Identitätsbildung und Selbstinszenierung
4.1 Identitätsbildung
4.1.1 Identität in virtuellen Welten
4.1.2 Zum Verhältnis von Flexibilität und Stabilität
4.2 Selbstinszenierung
4.2.1 Der Nickname
4.2.2 Der Avatar, das virtuelle Abbild
4.2.3 Die Bedeutung virtueller Werte
4.2.4 Das Rollen-Spiel
4.2.5 Screenshots: Virtuelle Fotografien
5. Zum Umgang mit virtuellen Räumen
5.1 Kommunikationsmodi in Online-Netzwerken
5.1.1 Computervermittelte Kommunikation
5.1.2 Sprache in der computervermittelten Kommunikation
5.1.3 Emotionen in textbasierter Kommunikation
5.2 Ansätze zur Internetnutzung
5.2.1 Erste Erfahrungen im Netz
5.2.2 Integration des Internet in den Alltag
5.2.3 Nutzergruppen im Internet
5.2.4 Passive, aktive und soziale Nutzung des Internet
6. Online-Communities und ihre Bedeutung für das Individuum
6.1 Prozesse in einer Online-Community
6.1.1 Die Identität einer Online-Community
6.1.2 Ansätze zum Aufbau von Beziehungen
6.2 Feste Spielergemeinschaften
6.2.1 Gründung und Nutzen einer Gilde
6.2.2 Hierarchische Stufen und Gruppenprozesse
6.2.3 Vertiefung der Beziehungen
7. Fazit und Ausblick: „Bin ich viele?“
8. Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Leben im Netz – Philosophie und Realität
An die Erforschung der Identität in virtuellen Welten gibt es verschiedene Herangehensweisen. Man kann die Theorie studieren, die von der klassischen Kommunikationstheorie über sozialpsychologische Identitätsstudien, bis hin zu fiktionalen Werken der digitalen Vernetzung von Mensch und Maschine reicht. Es ist möglich, das Gespräch mit aufgeschlossenen und skeptischen Internetnutzern zu suchen, um sie zu ihrem Netzverhalten befragen und sich auch selbst in die Vielfalt der virtuellen Welten von „World of Warcraft“ bis „Spiegel Online“[1] zu begeben, um dort neben sozialen Abgründen auch Indizien für Identitätsbildung und Medienkompetenz zu entdecken, die sich den Nutzern durch ehrgeizige Lernprozesse erschließen.
Sobald man beginnt sich in virtuellen Welten zu bewegen, handelt das virtuelle Ich abgekoppelt vom realen Selbst. Man tritt nicht als Person auf, sondern zunächst als reiner Beobachter, als Geist in einer Umgebung der kreierten Identitäten. Eine virtuelle Identität ist zu Beginn nichts weiter als die Adresse einer Webseite oder die vage Vorstellung eines Online-Angebotes, das Neugierde weckt. Von dort aus führen zig Wege zu weiteren Netzen und Möglichkeiten und mit jedem Klick manifestiert sich ein Grundkonsens dessen, was der Mensch in den virtuellen Umgebungen als interessant ansieht. Aus dieser Basis entwickeln sich sodann unterschiedliche Identitätsfragmente: mal tritt der Mensch so auf, wie er im realen Leben ist, mal so, wie er gesehen werden möchte, mal schlüpft er in eine Rolle, die aufregender scheint als diejenige, die er im wahren Leben bekleidet.
Erst mit der Verankerung in diversen Welten, Diensten oder bei der Nutzung verschiedener Angebote entwickelt sich die Vorstellung des Einflusses des virtuellen auf das reale Ich. Die online erschlossenen Erkenntnisse des virtuellen Ich werden zu einer Bereicherung für die reale Identität – und einzigartig in ihrer Art, denn ohne virtuelles Selbst hätte das reale Ich die entsprechenden Möglichkeiten nicht entdecken können.
Man muss sich an dieser Stelle ebenso davon loslösen, dass Identität gleichbedeutend mit Körperlichkeit ist, wie von der Vorstellung, dass zu jedem realen Ich genau eine virtuelle Identität als Gegenpart existiert. In der Pluralität der Netze schreibt der Mensch seine eigene Online-Geschichte und erforscht den virtuellen Raum auf der Suche nach Strömen, die zur Festigung seiner Identität beitragen. Ob aus eigenem Antrieb sozial motiviert, oder unbewusst im Grundmuster des Verhaltens verankert – das Leben im Netz birgt viele aufschlussreiche Erkenntnisse über die Entwicklung der eigenen Identität.
2. Fragestellung, Vorgehensweise und Zielsetzung
In dieser Arbeit geht es um die Frage, inwieweit philosophische Ansätze bezüglich der Virtualität in all ihren Facetten mit den tatsächlichen Lebenswelten von Nutzern synthetischer Welten übereinstimmen und in welchen Bereichen sie divergieren.
Es soll auf der Basis von theoretischen und empirischen Ansätzen dargestellt werden, ob virtuelle Welten zur Erweiterung der eigenen Identität beitragen, oder ob das „Ich“ im virtuellen Raum in der anonymen, vernetzten Masse untergeht. Unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte virtueller Räume soll veranschaulicht werden, welche Bereiche dem Internetnutzer heute zur Verfügung stehen, um die eigene Identität zu konstatieren und zu erweitern. Die bei der Identitätsbildung ablaufenden Prozesse sollen anhand der Einflüsse durch virtuelle Räume und anhand der individuellen Motive der Nutzer analysiert und in ihrer Wirkungsweise beschrieben werden. Auf Basis der Erkenntnis der ständigen Wechselwirkungen zwischen realem und virtuellem Selbst soll festgestellt werden, inwieweit der Internet-Alltag positiven oder negativen Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Identität nehmen kann und inwieweit diese in ihrer Substanz greifbar ist. Anhand der Analyse sozialer Beziehungen auf der Basis von computervermittelter Kommunikation soll die Bedeutung von sozialen Netzwerken dargestellt werden, um das Gesamtbild der vernetzten Identität abzurunden.
Diese Arbeit versucht zu zeigen, dass der Umgang mit virtuellen Welten im Bewusstsein der Existenz eines realen Lebens außerhalb des Internet als positiv einzustufen ist. Zudem soll dargestellt werden, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, das Zweitleben im Internet mit dem normalen Leben in Verbindung zu bringen, ohne dass der Bezug zur Wirklichkeit und ohne dass das Individuum als reale Person verloren geht. Unter Berücksichtigung der Argumente für und gegen den intensiven Umgang mit Online-Netzen soll erläutert werden, dass Möglichkeiten der Selbstdarstellung für den Einzelnen im virtuellen Raum vorhanden sind und dass die Bildung von aus dem realen Leben adaptierten virtuellen Sozialstrukturen Auswirkungen auf die Wahrnehmung sozialer Beziehungen hat.
3. Zum Grundkonzept virtueller Welten
Um die Bildung von Netzkultur und ihrer Bedeutung für das Individuum vollends erfassen zu können, soll zunächst erläutert werden, wie mit der Entstehung des Cyberspace die lokalen Gegebenheiten zur Entwicklung sozialer virtueller Identitäten geschaffen wurden.
3.1 Begriffliche Eingrenzung
Seit dem Beginn des Diskurses um künstliche Welten in den 1980er Jahren haben sich Begriffe etabliert, die den Traum von virtueller Freiheit und völliger Vernetzung prägten.
3.1.1 Virtualität: Begriffsdefinition und -gebrauch
Der Begriff Virtualität lässt sich auf das lateinische Adjektiv „virtualis[2] “ und auf das Substantiv „virtus[3] “ zurückführen. Im medizinischen Bereich wurde „virtualis“ als „möglicherweise vorhanden“ eingesetzt[4]. Mit Begriffen wie „virtual reality“ oder „virtueller Speicher“ erhält der Begriff eine Bedeutungsfacette, die einem Schwebezustand zwischen „fast ganz wirklich, dennnoch scheinhaft“ entspricht[5]. Der Inhalt der Virtualität ist seit jeher Bestandteil der menschlichen Entwicklung, denn Disziplinen wie Kunst, Wissenschaft und Literatur arbeiten mit Gedankenmodellen und Ideen, die von der reinen Imagination erst in die Realität eintreten müssen. So definiert auch Schmidt (2006):
Der Begriff virtuell bezeichnet den Zustand eines Objekts, das zwar nicht physisch vorhanden ist, dessen Auswirkungen und Funktionen aber durchaus real sind. Die Welten (…) sind mit Adjektiven wie künstlich oder synthetisch sehr viel besser beschrieben. (S. 34)
Im IT-Sprachgebrauch wird „virtuell“ im Sinne von „nicht physisch vorhanden“ auch als Synonym für „Simulation“ verwendet. Ein virtuelles Faxgerät ist beispielsweise ein Programm, das auf dem Computer ein Faxgerät mimt, indem es „simuliert“, dass der Computer mit einem Faxgerät kommuniziert, während das Faxgerät lediglich aus einem Stück Software im Computer besteht. Zu virtuellen Räumen führt Castronova (2006) an:
This [practical virtual reality] technology would allow (…) [anyone to spend time] in some kind of alternate reality space that was built and stored on a computer. We are not talking about a Holodeck here; this place isn’t “real” by any means. However, it does feel real enough to the users that they can fairly easily immerse themselves in it (…). For the most part, I will refer to these places as synthetic worlds: crafted places inside computers that are designed to accommodate large numbers of people. (S. 3f)
Die Autoren schlagen vor, statt „virtuell“ den Begriff „synthetisch“ einzuführen. Das Attribut „virtual“ wurde in der Vergangenheit auf die technische Verschmelzung von Mensch und Maschine bezogen. Dabei wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass es auch ohne diese möglich sein würde, in simulierten Räumen zu interagieren. Dass die daraus resultierenden Konsequenzen durchaus Einfluss auf das reale Leben nehmen, soll im Verlauf dieser Arbeit erläutert werden.
3.1.2 Erweiterte und virtuelle Realität
Der bekannteste Gegensatz von virtuell und real wird durch „Virtual Life“ und „Real-Life“, virtuelles und reales Leben, verdeutlicht. Vor allem Internetnutzer differenzieren diese beiden Bereiche bewusst, um sich und ihre Handlungen im Netz von der realen Umgebung abzugrenzen. Im Fall der erweiterten („augmented reality“, im Folgenden AR) und virtuellen („virtual reality“, im Folgenden VR) Realität ist die Unterscheidung jedoch anders vorzunehmen. Stellt man sich VR bildlich vor, so wird deutlich, dass laut Schmidt
[u]nsere Vorstellung von Virtual Reality (…) geprägt [wurde] durch die eigentümlichen Maschinen, die mittels aufwändiger Hardware Illusionen erzeugen sollten. (S. 35)
Die Menschen assoziieren mit dem Begriff Virtual Reality Personen, die mittels technisch unterstützter Verschmelzung in einen virtuellen Raum eindringen, wobei die physischen Bewegungen des vernetzten Körpers auf den virtuellen Raum übertragen werden. Zugänglicher gestaltet sich hingegen eine Form der Unterstützung durch technische Mittel. Anders als bei der vollständigen Vernetzung des Körpers werden nur bestimmte Teile durch technische Attribute erweitert, wodurch zusätzliche verwertbare Informationen verfügbar werden. Wichtiger Aspekt ist die Interaktivität der Anwendungen, die in ständiger Kommunikation mit ihrer Umwelt stehen. Die Betrachtung eines menschlichen Köpers durch einen Computertomograph zählt ebenso dazu wie die Verwendung eines Navigationsgerätes, das Meldungen zur Verkehrslage in die Routenplanung einbezieht[6].
3.2 Was ist Cyberspace?
Cyberspace bezeichnet heute Raum, der technologisch unterstützt simuliert werden kann. Der Raum basiert auf der Vernetzung menschlicher und künstlicher Identität.
3.2.1 Cyberspace: Eine Begriffsdefinition
Das Präfix „cyber“ stammt ursprünglich vom griechischen „Kybernetike“ ab, welches mit „Kunst des Steuerns“ übersetzt werden kann. Die Einführung des Begriffes erfolgte lange vor den ersten Cyberspace-Utopien. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener verwendete ihn erstmals im Jahr 1947[7] und begründete den Wissenschaftszweig Kybernetik, der sich mit der Kommunikation komplexer Systeme befasst. Der polnische Autor Stanislaw Lem präsentierte in seinem Werk „Summa Technologicae“ 1964 eine philosophische Herangehensweise an die Kybernetik und nannte sie als „periphere Phantomatik.“ Er beschrieb dort bereits Ansätze der Entwicklung künstlicher Intelligenz, sowie die Vernetzung biologischer und technischer Komponenten.
Das beide oben aufgeführten Aspekte verbindende Kunstwort „Cyberspace“ wurde 1982 vom amerikanischen Science Fiction-Autor William Gibson erstmals in seiner Kurzgeschichte „Chrom brennt“ verwendet[8]. Zusammengesetzt ist es aus den englischen Begriffen„cybernetic“ und „space[9] “. Gibson nahm die Vorstellung der Kommunikation komplexer Systeme und gab dem abstrakten Begriff einen Raum, den „space“, in dem die Kybernetik visualisiert und somit für den Nutzer greifbar wurde.
[I]n Bobbys Loft kam das einzige Licht von einem Monitor und den grünen und roten LEDs an der Vorderseite des Matrixsimulators. Ich kannte jeden Chip in Bobby Simulator in- und auswendig; er sah aus wie ein ganz alltäglicher Ono-Sendai VII, der „Cyberspace Seven“ (…)[10]
Dieser „space“ war jedoch nur für Nutzer erreichbar, die ihr Nervensystem mittels Brille und Sensoren mit einer Konsole verbanden und ihre biologische Identität somit um technische Komponenten erweiterten.
3.2.2 Die Entstehung des Mythos Cyberspace
Für Gibson war die Vision vom Cyberspace eine Metapher für die Medienrealität der 1980er. Er wollte damit andeuten, dass der mediale Kontext für etwas Neues im Sinne einer parallelen Realität gegeben war und dass eine solche Entwicklung eintreten könnte. Der Begriff und das Gedankenkonstrukt gewannen rasch an Popularität, als Gibson in seiner „Neuromancer[11] “-Trilogie das Prinzip vertiefte. Die Medien hatten jedoch Gefallen an dem neumodischen Begriff gefunden und mit den Entwicklungen der Computer, Mikrotechnologie und Raumfahrt schienen Gibsons Visionen in greifbare Nähe zu rücken, so dass sein Werk als zukunftsweisende Anleitung für die Forschung interpretiert wurde. Der Cyberspace wurde zum Synonym für globale Vernetzung und biotechnologische Verschmelzung. Gerade weil es keine eindeutigen Definitionen oder Einschränkungen gab, stiegen überspitzte Wünsche und Erwartungen an die virtuelle Freiheit. Bruce Sterling schreibt in seinem Werk “The Hacker Crackdown” über Cyberspace:
Cyberspace is the “place” where a telephone conversation appears to occur. Not inside your actual phone, the plastic device on your desk. Not inside the other person's phone, in some other city. THE PLACE BETWEEN the phones. The indefinite place OUT THERE, where the two of you, human beings, actually meet and communicate.[12]
Aussagen wie diese ließen den Wunsch entstehen, den von Sterling genannten „Ort“ tatsächlich zu bereisen. Die Erwartungen an technische Entwicklungen stiegen. In vielen Köpfen begann eine digitale Revolution.
3.2.3 Höhepunkte und Niedergang der Ära Cyberspace
Ende der 1980er und Anfang der 1990er war „Cyberspace“ eines der wichtigsten Themen in den modernen Mediengesellschaften. Das österreichische „Ars Electronica[13] “-Festival setzte ab 1989 mit Themen wie „Digitale Träume, virtuelle Welten“ die Wünsche der Technikbegeisterten zumindest in künstlerischer Form um, denn von Gibsons Vorbild war die Technik weit entfernt. Nach „Neuromancer“ erlebte auch die Hacker-Gemeinde großen Zuwachs. Die als kriminell gefürchtete Szene bekam mit einem Mal eine mystifizierende Konnotation. Die Hacker agierten öffentlich unter dem Banner des ersten „Hacker-Manifest“ von „The Mentor“:
This is our world now... the world of the electron and the switch, the beauty of the baud. We make use of a service already existing without paying for what could be dirt-cheap if it wasn't run by profiteering gluttons, and you call us criminals. We explore... and you call us criminals. We seek after knowledge... and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias... and you call us criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals.[14]
Die Zugehörigkeit zu einer so mächtigen, aber nicht greifbaren Institution war für viele Nutzer verlockend und die kollektive Identität der Hacker begann sich rascher denn je zu entwickeln. Das „Wir“ verlieh der Gruppe Substanz und Stärke, der die als „das System“ bezeichnete Gesellschaft nichts entgegenhalten konnte. Ein weiteres prominentes Beispiel für den Cyber-Rummel ist die von John Perry Barlow im Jahr 1996 veröffentlichte „Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace“. Barlow bezeichnet den Cyberspace darin als autonome „Zivilisation des Geistes“ mit kollektiven Handlungen, Freiheit und Gleichheit.
Regierungen der industriellen Welt, Ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich Euch, Vertreter einer vergangenen Zeit: Laßt uns in Ruhe! Ihr seid bei uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, besitzt Ihr keine Macht mehr[15]
Er definierte Cyberspace als ein Netz aus Beziehungen, Transaktionen und dem Denken selbst, als eine Welt „überall und nirgends“. Neben Erwartungen wurden somit auch Emotionen investiert, um die Freiheit des Cyberspace zu gewährleisten. Doch die technologischen Entwicklungen konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Als der Erfolg ausblieb, war die Ära des Cyberspace Mitte der 1990er beendet. Der Mythos lebt jedoch trotz der Fehlschläge weiter. Zahlreiche philosophische, fiktionale und filmische Werke beschäftigen sich mit der Frage, wie die Zukunft einer Menschheit aussehen könnte, die ihre Identität mit digitalen Mitteln erweitert. Dabei wird einerseits von Körpermodifikationen erzählt, die biologische Existenz und Technik verbinden, andererseits aber auch von Möglichkeiten, nur den Geist auf virtuelle Reisen zu schicken[16].
3.2.4 Begriffsverwendung in der heutigen Zeit
Cyberspace umfasst heute im weiten Sinn alle Aspekte und Vorgänge per Simulation virtuell erzeugter Welten, die im geographischen Sinn nicht erfasst werden können. Es ist zu einem Machtwort geworden, das die moderne IT-Gesellschaft spricht, wenn es um Vorstellungen und Anwendungsformen neuartiger Technologien geht. Die greifbarste Form des Reisens in den Cyberspace ist die der Internetnutzung. Synonyme für Cyberspace werden als Attribute verwendet, um einen Bezug zwischen virtuellem Dienst und realem Kontext herzustellen und gleichzeitig die Bereiche von einander abzugrenzen. Eine „Online-Beziehung“ wird anders bewertet als eine „reale“ Beziehung, auch die Begriffe „e-Learning“ oder „virtual goods“ erzeugen nicht zuletzt aufgrund der im IT-Sprachgebrauch üblichen Anglizismen, andere Assoziationen als „Lerngemeinschaft“ oder „Güter“. Bekannte Präfixe für Vorgänge im Cyberspace sind:
- „e-“ für „electronical“, beispielsweise e-Mail, e-Business, e-Commerce, e-Book; in vielen Fällen löst „e-“ das ältere „Cyber-“ ab, siehe beispielsweise Döring S. 48 – Cyber-Learning wird zu e-Learning
- „Online-“, zu Deutsch „im Netz“ bei Vorgängen in aktiver Verbindung zum Internet, beispielsweise Online-Beziehung, Online-Community, Online-Shop
- „virtual“ (oder auch „synthetic“) im Sinne von „künstlich erzeugt“, meist bei umfassenden Begriffen wie „virtual Reality“ oder „virtual World“
- „Cyber-“ findet hauptsächlich bei älteren Begriffen im Rahmen der Virtualität Verwendung, beispielsweise Cyberpunk, Cybersex[17]
Fälschlicherweise wird Cyberspace in der heutigen Zeit als Ersatz für das Internet eingesetzt. Dass sich hinter dem Kunstwort Cyberspace mehr als nur das Internet verbirgt, ist für Endnutzer im Umgang mit virtuellen Welten nur von geringer Bedeutung. Aufgrund einer fehlenden, allgemein gültigen Definition bildet sich so jeder User selbst eine Meinung von dem bedeutungsleeren Begriff:
- User 1: ein Wort: Neuromancer
- User 2: ein komisches wort was immer in seltsamen filmen benutzt wird. für mich ein leeres wort
- User 3: hmm … cyberspace fängt für mich hinter dem monitor an … alles was auf deranderen seite der mattscheibe is, is für mich cyberspace – die möglichkeit normen zu brechen – verrücktes zu tun ohne dass was passiert – leute zu treffen die man sonst nie treffen würde und einfach ein stück weit eine freiheit zu genießen die einem die gesellschaft seit längerem nicht mehr zugesteht
- User 4: wenn man bedenkt, wieviel % nur ihr webmailinterface, google und wikipedia kennen
- User 5: Cyberspace ist die eigene Realität, die sich Nutzer eines großen Netzwerkes schaffen, um dieses zu beschreiben; wenn man sich das Internet vorzustellt: was dabei rauskommt. [sic][18]
Einig sind sich alle Nutzer jedoch in dem Punkt, dass Cyberspace etwas mit Vernetzung und Kommunikation zu tun hat und dass dort Dinge passieren können, die ohne die technische Grundlage in Form eines Computers nicht möglich wären. Es gibt verschiedene Karten und Protokolle über Cyberspace. Manche davon ähneln Schaltkreisen, andere befassen sich auf eine abstrakt-assoziative Weise mit dem Begriff. Drei Beispiele sollen zeigen, wie unterschiedlich verschiedene Menschen Cyberspace auffassen.[19] Fest steht jedoch, dass Cyberspace eine Vielzahl von Möglichkeiten meint, virtuelle Räume zu gestalten. Entfernt man sich von Gibsons Definition, kann man den Begriff Cyberspace ohne Weiteres mit jeglicher Art von virtueller Simulation in Verbindung bringen, in denen Vernetzung und technische Unterstützung der Prozesse gegeben sind.
3.2.5 Die Etablierung des Internet
Die Entstehungsgeschichte des Internet begann am 15. April 1958, als in den USA ein Budget zur Erstellung des ARPANET[20] eingerichtet wurde. Mit diesem vom Verteidigungsministerium finanzierten Projekt sollte gewährleistet werden, dass auch im Falle eines nuklearen Angriffs wichtige Informationsressourcen erhalten blieben. Realisiert wurde das Vorhaben, indem zwischen einzelnen Computern ein Datennetz geschaffen wurde, in dem die Informationen kursierten und dezentralisiert an verschiedenen Orten abgespeichert und abgerufen werden konnten, wie auch Leitner (2003) beschreibt.
Das Internet entstand, um ein militärisches – und paradoxerweise soziales – Problem zu lösen: Nämlich um die Kommunikation in einem technischen Netzwerk zwischen weit verteilten Arbeitsgruppen auch unter schwierigsten Bedingungen aufrecht zu erhalten, selbst wenn Störungen wie etwa Kriegseinwirkungen beliebige Teile des Systems lahm legen sollten. (S. 15)
1969 als universitäres Projekt mit vier vernetzten Rechnern gestartet, wuchs das ARPANET im Laufe der nächsten Jahre stetig an. Der Terminus Internet[21] entstand 1974, um das mittlerweile international agierende Netzwerk global zu umschreiben. Zurückzuführen ist das Wort auf den lateinischen Begriff „inter“ (zwischen) und das englische „networking“ (vernetzen). Übersetzt bedeutet der Begriff die Vernetzung zwischen Computernetzen und definiert das Internet somit als ein „Netz der Netze“. Ab 1988 wurde das Internet auch privaten Nutzern und kommerziellen Diensten zugänglich gemacht. Das große Interesse lässt sich anthropologisch erklären, denn die Entwicklung der Menschheit brachte die Entwicklung von Kommunikationssystemen mit sich und die erfolgreiche Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung hängt somit mit der Fähigkeit zur Kommunikation zusammen. Die Medien nahmen das Phänomen mit der Einführung des „World Wide Web“ als Ersatz für die fehlgeschlagenen Cyberspace-Utopien auf. Das 1991 entwickelte „WWW“ war eine Schnittstelle, über die Nutzer im Internet „surfen“ konnten. Die zugrunde liegenden Datenprotokolle waren darin integriert, so dass die Nutzung nicht mehr nur technisch versierten Spezialisten, sondern der breiten Masse zugänglich gemacht werden konnte.
Dass jedoch das „WWW“ nicht der Vision vom Cyberspace entspricht, wird rasch deutlich, denn viele vorgegebene Einschränkungen verhindern die komplette Digitalisierung und das vollständige Eintauchen in die Welt zwischen den Computern. Auch wenn die Medien vom gläsernen Nutzer und dem Realitätsverlust der Internet-Junkies sprechen, per synaptischer Verbindung ist es immer noch nicht möglich, körperlich eins mit dem Computer zu werden. Doch basierend auf Fantasie und Vorstellungskraft kann die geistige Immersion ebenfalls zu einer Art von Verschmelzung führen.
3.3 Synthetische Welten
In der Auseinandersetzung mit der Vielfalt der simulierten und künstlich erzeugten Welten sind Lernprozesse und Kommunikation wichtige Schlüsselfaktoren zur Orientierung.
3.3.1 Was sind synthetische Welten?
Allgemein betrachtet sind synthetische Welten durch Software und die Partizipation der Nutzer ins Leben gerufene, gemeinsame Aktionen in computervermittelten Räumen. Doch hinter dem Terminus verbirgt sich mehr als nur das technisch reglementierte Miteinander. So beschreibt auch Schmidt (2006) das Verständnis von künstlichen Welten.
Die künstlichen Welten (…) sind Orte der Begegnung und des Austausches von natürlichen Personen. Sie haben nachweislich große Auswirkungen auf unsere physische Welt, und müssen deshalb als „echt“ angesehen werden. (S. 34)
Der Autor nennt hier wichtige Aspekte, die es im Umgang mit synthetischen Welten zu beachten gilt, denn hinter jedem Nutzer online steht ein realer Mensch mit eigenen Absichten und einer eigenen Identität. Die Welten leben von der Kommunikation dieser Menschen, die sich in verschiedenen Netzen zusammenschließen, gemeinsame Identitäten bilden und als Individuen ihr konstruiertes Selbst repräsentieren. Aufgrund der engen Verbindungen vieler Nutzer zu ihren persönlichen Online-Netzwerken und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Identitätsbildung, können synthetische Welten nicht auf ihre technische Komponente reduziert werden. Der soziale Kontext der Kommunikation ist Ausschlag gebend für die Partizipation der Nutzer und diese wiederum ist die Voraussetzung für die Weiterentwicklung synthetischer Welten. Es steht fest, dass der Mensch selbst aktiv werden muss, um ein Teil dieser Prozesse zu werden. Die Palette an Möglichkeiten erschließt sich nur demjenigen, der bereit dazu ist, ein virtuelles Ich zu konstruieren und sich mit Hilfe dieses Mediums mit den synthetischen Welten auseinanderzusetzen, um in sie einzutauchen, wie Castronova (2006) beschreibt.
[T]he [augmented and virtual reality] science program focused on sensory-input hardware, while the gamers focused on mentally and emotionally engaging software. As you can imagine, a person can become “immersed” in either way: either the sensory inputs are so good that you actually think the crafted environment you’re in is genuine, or, you become so involved mentally and emotionally in the synthetic world hat you stop paying attention to the face that it is only synthetic. It turns out that (…) the software-based approach seems to have had much more success. (S. 5)
Der Erfolgsfaktor der synthetischen Welten besteht demnach darin, dass sie die Nutzer dazu verleiten, mental und emotional einzutauchen und darüber zu vergessen, dass das dargestellte Weltenkonstrukt künstlich erstellt wurde. Emotionale Immersion setzt jedoch voraus, dass der Nutzer in der Welt tatsächlich nicht als anonymer Zuschauer, sondern als aktiver Teilnehmer mit seiner virtuell konstruierten Identität präsent ist.
3.3.2 Textbasierte synthetische Welten
Anders als bei grafisch unterstützten Online-Spielen, bestehen die Aktionen und Taten in textbasierten Welten aus dem geschriebenen Wort. Für die gelungene Weltenkreation ist es demnach notwendig, dass alle Teilnehmer den Regeln dieser Welt entsprechend kommunizieren und ein einheitliches Bild schaffen. Es regt Fantasie und Kreativität des Einzelnen an, das eigene Ich in seinem Äußeren und seinen Charakterzügen zu beschreiben. Zu textbasierten Welten zählen themenbezogene Chats, die entweder über eine Schnittstelle im Internet[22], oder über Chatprogramme[23] erreicht werden können. Eine Sonderform dieser Chats sind so genannte Rollenspiel-Chats[24], in denen der Nutzer beispielsweise die Rolle eines mittelalterlichen Kriegers übernehmen kann. Eine bis in die 1990er Jahre weit verbreitete, heute unter jungen Nutzergruppen kaum mehr bekannte Form des textbasierten Rollenspiel sind zudem die „MUDs[25] “. In MUDs gibt es auch eine komplett auf Text basierende Online-Welt. Der Spieler kann zwischen verschiedenen Rassen wählen, er kann gegen Monster kämpfen, mit dem System und anderen Spielern interagieren. Den Reiz des Spiels beschreibt auch Turkle (1999):
MUDs liefern Welten für anonyme soziale Interaktionen, in denen Sie eine Rolle spielen können, die Ihrem wirklichen Selbst so nahe kommt oder so fern bleibt, wie Sie es wünschen. Für viele Mitspieler werden die Darstellung der Figur(en) und die Aktivitäten im / in MUD(s) zu einem wichtigen Teil ihres Lebens. Da der Reiz des Spiels weitgehend davon abhängt, daß man viele persönliche Beziehungen knüpft und an den rasch wechselnden Debatten und Projekten einer MUD-Gemeinschaft teilhat, läßt sich die Spielzeit schlecht auf ein moderates Maß einschränken. Kein Wunder, daß unter MUD-Spielern häufig über Sucht und Abhängigkeit diskutiert wird. (…) „Du kannst nicht wirklich dazugehören, wenn du nicht jeden Tag dabei bist. Andauernd geschieht was. Den Kick geben dir die MUDs nur, wenn du direkt an der Entwicklung der Geschichte beteiligt bist“, erklärt ein Stammspieler (S. 295f)
Im Unterschied zum bloßen Lesen von Texten ist der Spieler in MUDs dazu berechtigt, selbst an der Schaffung neuer Cyber-Literatur teilzunehmen. Die Spieler sind gleichzeitig Schöpfer und Konsument der kollektiv geschriebenen Literatur. Der Selbstentwurf in textbasierten synthetischen Welten setzt kommunikative Kompetenz voraus. Da alle Handlungen und Aktionen in geschriebener Form ablaufen und der Nutzer nicht durch Gestik oder Mimik bestimmte Konnotationen erzeugen kann, muss genau auf die Wortwahl geachtet werden. Der Nutzer lernt, seine virtuelle Identität schriftlich zu artikulieren und kann auch für das reale Ich neue Wege der Kommunikation erschließen.
3.3.3 Soziale Software und Netzwerke
2002 als Modewort eingeführt, meint soziale Software Programme oder Online-Dienste, die allgemein dem Austausch dienen. Dabei stehen neben der Bereitstellung von Informationen auch die Verwaltung von Beziehungen über das Netzwerk und die Betonung der eigenen Darstellung im Vordergrund. Die Pflege sozialer Kontakte wird somit aus dem realen Leben ausgelagert und durch medial vermittelte Kommunikation übernommen. Turkle (1999) beschreibt diese Verflechtung wie folgt:
Je enger die Menschen (…) über die Technologie mit einander verflochten werden, um so fragwürdiger werden alte Unterschiede zwischen dem, was spezifisch menschlich ist, und dem, was als spezifisch technisch galt. Spielt sich unser Leben am oder im Bildschirm ab? (S. 30)
Allgemein kann bei sozialen Netzwerken zwischen zwei Typen unterschieden werden. Dienstbasierte Netzwerke offerieren die Nutzung einer bestimmten Applikation, die zur webbasierten Einbindung eigener Inhalte dient[26]. Aufgrund der Beschränkung auf eine Funktion wird dieser Aspekt der Identität betont und gezielt weiterentwickelt. Kollektive Identität wird insbesondere bei den Autoren der Online-Enzyklopädie „Wikipedia[27] “ deutlich. Das Schreiben erfordert ein Verständnis von gemeinsamen Zielen, wodurch zwar Diskussionen entstehen, Kooperation und Gemeinschaftsgefühl hingegen gestärkt werden. Im Dialog mit dem vernetzten Programm ergeben sich einerseits neue kreative Lösungen, andererseits steht der Nutzer stets unter dem Druck, etwas Neues anbieten und produzieren zu müssen, um stets interessant für Besucher zu wirken. Vor allem in Blogs[28] ist dieser Druck allgegenwärtig. Diese virtuellen Tagebücher lassen jede geschriebene Nachricht zum Teil einer persönlichen Web-Chronik des Autors werden und ermöglichen es den Lesern, zu kommentieren und eigene Inhalte beizusteuern. Durch Blogs entsteht im Internet ein ausgeprägter Personenkult um die virtuellen Identitäten von Autoren.
Die zweite Gruppe bilden die profilbasierten Netzwerke. Zur Teilnahme benötigt der Nutzer nichts außer Informationen über sich selbst und den Willen, diese preiszugeben, somit stehen Selbstinszenierung und der Aufbau von Kontakten im Vordergrund. Je nach Anbieter werden Daten zu beruflichem Werdegang, persönlichen oder themenbezogenen Interessen abgefragt[29]. Der Erfolg ist davon abhängig, wie intensiv die Besitzer der Profile miteinander kommunizieren und die Aktualisierung ihrer Informationen, sowie das Abrufen neuer Profile in ihren Alltag integrieren. Da es keine Beurteilung von Inhalten gibt, ist ein Profil umso mehr wert, je mehr „Freunde“ dort eingetragen sind. Es entsteht durch eine Häufung von Profil-Freunden der Eindruck eines stabilen sozialen Umfelds. Oftmals sind diese „Freundschaften“ jedoch nur flüchtige Kontakte, die von der symbolisch zur Schau gestellten Verbundenheit profitieren. Es muss bei der Betrachtung dieser sozialen Verbindungen deshalb stets beachtet werden, dass der Wunsch nach Status und Anerkennung den tatsächlichen Nutzen in den Hintergrund drängen kann.
3.3.4 Die Bedeutung der Online-Games
Online-Spiele, bei denen zwischen zwei und Tausenden von Nutzern gemeinsam in einer synthetischen Welt vernetzt sind, stellen die greifbarste Annäherung an den Cyberspace dar. Konstituiert das Online-Poker bereits einen imaginären Spieltisch, so präsentieren sich „MMO(RP)Gs[30] “ in kompletten 3D-Welten. Die Steuerung eines eigenen Charakters, Weiterentwicklung der virtuellen Identität und die Macht der visualisierten Fantasien ziehen Millionen von Spielern in ihren Bann. Innerhalb der Vielfalt der Online-Spiele gibt es große Unterschiede. Einerseits besteht eine Unterteilung nach Genres, andererseits existiert aber auch eine Differenzierung in Bezug auf die mögliche Immersion in die Welt selbst[31]. Trotz der vielen unterschiedlichen Spiele-Genres haben doch alle Formen einige wichtige Aspekte gemeinsam. Spiele konstituieren eine eigene Realität und laden dazu ein, sich darauf einzulassen. Jedes Spiel besitzt eigene Regeln, die zu respektieren ein Bestandteil der Immersion ist. In der Gesellschaft werden sie allerdings anders wahrgenommen, wie auch Schmidt (2006) erläutert:
[MMORPGs] werden als skurriles Randphänomen wahrgenommen. Eine befremdliche Wucherung des weltweiten Gewebes. Ihre Teilnehmer – zumeist männliche, bleiche Sonderlinge mit gestörtem Sozialverhalten. In Bezug auf die zahlreichen Gewaltspiele womöglich sogar potentielle Amokläufer. (…) Doch leider versperrt diese einseitige Sichtweise den Blick auf die tiefgreifenden Veränderungen, die in der Medienlandschaft gerade stattfinden. Die wahren Chancen und Risiken, die die neuartigen digitalen Räume bieten, werden vollkommen außer Acht gelassen. (S. 30)
Ein großes Problem kann darin gesehen werden, dass den meisten Nicht-Spielern der Zugang zu den virtuellen Welten versagt bleibt, weil sie es sich nicht vorstellen können, Zeit mit dem Erforschen einer virtuellen Welt zu verbringen und mit einem virtuellen Schwert gegen virtuelle Kreaturen zu kämpfen. Spiele sind allgemein gesehen zwar Beschäftigungen, die Spaß und Freude für die Spielenden bedeuten und ihn vom alltäglichen Leben ablenken sollen, doch jedes Spiel besitzt eine eigene Ernsthaftigkeit. Spiele geben den Spielern Aufgaben, an deren Lösung ein Spieler auf verschiedene Weisen herangehen kann, doch es wird stets um etwas gespielt und es gibt immer Mitspieler, mit denen sich der Einzelne messen muss, wie auch de Mul (2005) anmerkt:
The lust provided by the computer game is never an end-pleasure but necessarily always remain a fore-pleasure. This is one of the reasons that playing computer games easily leads to addiction. This fore-pleasure is connected with phantoming the rules of the game and improving one’s skills in order to improve the personal record. (S. 260)
Laut de Mul[32] erfüllt ein Spiel auch nur dann seinen Zweck, wenn der Spieler sich selbst darin verliert, sich mit seiner Spielfigur identifiziert und deren Aufgaben als seine eigenen betrachtet. Sie zu erfüllen und ein vom Spiel bestimmtes Ziel zu erreichen, wird zum Teil der Spieler-Identität. Der Spiel-Raum wird so zum Teil des eigenen Lebensraumes, die Spielfigur Teil des Selbst. Deutlich sticht jedoch hervor, dass den Möglichkeiten in MMOGs Grenzen gesetzt sind, die technisch nicht überschritten werden können. Innerhalb dieser ist es für den Nutzer möglich, die eigene Identität in die Spielfigur zu projizieren, doch manchen Spielern ist dieser Grad der Immersion nicht genug. Manche finden sich hingegen in den virtuell konstruierten und genau reglementierten Welten besser zurecht, als im unübersichtlichen Alltag ihres realen Lebens. Die erfolgreiche Entwicklung einer neuen Medienkompetenz zur Handhabung synthetischer Welten ist deshalb erforderlich.
3.3.5 Medienkompetenz zwischen Simulation und Realität
Wie bereits dargestellt, benötigen die Teilnehmer bereits zu Beginn ein gewisses Spektrum an Kompetenzen, um sich als Persönlichkeit im Netz zu artikulieren. Dass technisches Wissen zur Einwahl in das Internet oder zur Partizipation am gewählten Dienst notwendig ist, sei vorausgesetzt. Vielmehr zählen kommunikative und soziale Kompetenz im Umgang mit zunächst anonymen Partnern. Der Umgang mit synthetischen Welten setzt zudem die Bereitschaft voraus, Neues zu lernen und sich auch von anderen Nutzern belehren lassen zu können. Der Lernprozess dient der Schaffung eines Wissensspektrums, das den eigenen Interessen entspricht und so Teil der virtuellen Identität wird. Um erfolgreich lernen zu können, müssen zudem Ablehnung und Angst vor neuen Techniken einer infantilen Neugierde weichen, um unvoreingenommen an die künstlichen Welten herangehen zu können, wie Turkle (1999) beispielsweise über einen jungen Spieler schreibt:
Tim geht mit einer extrem funktionalen Einstellung an das Spiel heran. (…) Bei Videospielen erkenne man sehr bald, daß man, um spielen zu lernen, spielen müsse. Man brauche nicht zuerst die Regeln auswendig zu lernen. (S. 109)
Vor allem im Bereich der Online-Spiele gibt es für einen neuen Nutzer viel zu lernen, denn jedes Spiel besitzt spezifische Merkmale in Bezug auf das System der konstruierten Welt. In IRC-Chats ist es zudem notwendig, spezifische Befehle zu erlernen[33], um erfolgreich kommunizieren zu können. Doch auch im realen Leben werden neue Kompetenzen benötigt, um die Online-Angebote in das eigene Leben zu integrieren. Eltern müssen sich das Wissen über die Medien ihrer Kinder aneignen, um effektiv an der Nutzung teilnehmen und Kinder vor Gefahren beschützen zu können. Jugendliche und Erwachsene müssen für sich selbst Kompetenz und Stärke aufbauen, um den Verlockungen der medialen Angebote nicht zu erliegen, wie auch Turkle (1999) beschreibt:
Das Leben im Cyberspace bietet, wie das Leben überhaupt, nicht allen gleiche Chancen. Die Antwort auf die Frage: „Sind MUDs für das seelische Wachstum förderlich oder abträglich?“ ist so vielschichtig wie das Leben selbst. Wenn man über ein gesundes Selbst verfügt, das sich durch Beziehungen weiterentwickeln kann, dann können MUDs sehr hilfreich sein. Andernfalls drohen einem ernste Schwierigkeiten. (S. 331)
Seelisches Wachstum bedeutet in diesem Fall nicht, dass sich nur das virtuelle Ich weiterentwickelt und die Modi der synthetischen Welten erlernt. Es bedeutet vielmehr, dass sich virtuelles und reales Selbst kongruent entwickeln und dass daraus für den Menschen Nutzen entsteht. Die Immersion in synthetische Welten muss stets in dem Bewusstsein erfolgen, dass virtuelle und reale Identität zwar mit einander verbunden sind, doch dass es das reale Ich ist, das nach dem „Logout“ weiterhin existiert.
4. Identitätsbildung und Selbstinszenierung
Die Konstruktion der eigenen Identität ist aufgrund der vielfältigen Einflüsse von innen und außen ein dynamischer Prozess, der zwischen Selbstinszenierung und der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich oszilliert.
4.1 Identitätsbildung
Die Identitätsbildung im Kontext virtueller Welten basiert auf der Analyse der computervermittelten Einflüsse und deren erfolgreicher Anwendung auf das reale Selbst.
4.1.1 Identität in virtuellen Welten
Es ist ein langwieriger Prozess, die eigene Identität[34] zu strukturieren und jene Aspekte des Selbst auszumachen, die das Individuum von der Masse unterscheiden. Auf der Suche nach dem eigenen Ich werden deshalb im Laufe der Entwicklung verschiedenste Tendenzen und Strömungen in Erwägung gezogen, integriert oder wieder fallen gelassen. Auch die virtuellen Welten bieten dem Suchenden Wege zur Erweiterung der eigenen und zur Ausbildung einer virtuellen Identität an. Dabei sind für das Verständnis von Identität zunächst drei von Döring (2003) genannte Attribute zu berücksichtigen.
Unter Identität im modernen Sinne versteht man das Bewusstsein einer Person, sich von anderen Menschen zu unterscheiden (Individualität) sowie über Zeit (Kontinuität) und über verschiedene Situationen (Konsistenz) hinweg im Kern dieselbe, durch bestimmte Merkmale ausgezeichnete Person zu bleiben: (S.325)
Die unter diesen drei Aspekten erfolgende Entwicklung der eigenen Identität erfolgt zudem stets unter dem Einfluss von äußeren Eindrücken und Wahrnehmungen. Da der Mensch Bezug zur eigenen Umgebung nimmt, in ihr agiert und interagiert, ist es nicht möglich, die eigene Identität zu isolieren und von der Umwelt auszunehmen. Doch nicht nur momentane Ereignisse, sondern auch Vorkommnisse in der Vergangenheit nehmen Einfluss auf die Entwicklung des Selbst und dessen Darstellung. Vergangenes beeinflusst das Denken für die Zukunft und die Einstellung zu kommenden Möglichkeiten. Wie groß der Einfluss vergangener Ereignisse auf die Identitätsbildung sein kann, beschreibt auch eine „Ragnarok Online[35] “-Spielerin:
Jeder RO-Char von mir hat einen eigenen Charakter. So auch meine Assassin. Sie begann als Kind als Einzelgänger, verstoßen von ihrer Familie. Sie taute erst auf, als sie auf den Priest meines Freundes traf, und ja, wir sind inzw auch im richtigen Leben ein Paar. Die Geschichte meines Avatars ähnelt ein wenig meiner eigenen. Ich wuchs als Kind so gut wie ohne Freunde auf. Für 1-2 Jahre hatte ich mal ein paar Freunde, aber auch diese Freundschaft verlor sich wieder. In der Schule ging das Mobbing bis zum Psychoterror und Morddrohungen, was mich letztenendes sehr isoliert hat. Zu Hause hatte ich die volle Unterstützung meiner Mutter, mein Vater hingegen war schlimmer als die Kinder in der Schule. Was im End-effekt bedeutete, dass ich Zuhause die meiste Zeit allein verbrachte. Das Internet hat mir damals zum ersten Mal das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Darüber fand ich Freunde, die mir die Kraft gaben, weiter zu machen. Als ich damals in Ragnarok meinen jetzigen Freund zum ersten Mal traf, bedeutete er mir schon als platonischer Freund viel, er ist inzw auch mein erster richtiger Freund... dementsprechend passt die Geschichte meiner Assassin sehr gut zu mir. [sic][36]
Durch die Ablehnung in ihrem Umfeld ging die Nutzerin davon aus, dass sie auch im virtuellen Raum auf ähnliche Verhaltensmuster stoßen würde. Sie entwickelte ihren Charakter und orientierte deren Lebensgeschichte an ihrer eigenen. Mit Hilfe des virtuellen Stellvertreters gelang es ihr, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten und sich für neue Kontakte zu öffnen. Die positiven Erfahrungen online gaben ihr Selbstsicherheit und auch die Gewissheit, dass sie in anderen Umfeldern durchaus auf positive Gefühle stoßen konnte. Über ihr eigenes Selbst lernte die Nutzerin, dass es sich weiterentwickeln und die Vergangenheit überwinden kann. Über Identität lässt sich somit laut Döring (2003) sagen:
Identitätsmerkmale sind also nicht nur (…) [Daten], die Identifizierbarkeit sicher stellen und in amtlichen Identitätsdokumenten (…) festgehalten werden, sondern auch die Persönlichkeitsattribute, Fähigkeiten, Werte, Ziele usw., mit denen eine Person sich definiert und interpretiert. Diese Selbstinterpretation entwickelt sich in Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungen, Einschätzungen und Reaktionen der Umwelt, wobei es (…) darum geht, die einzelnen Identifikationen (…) schrittweise zu einem stabilen und einheitlichen Ganzen zu integrieren. (S.325)
Die Autorin betont zudem wie auch Turkle[37], dass man das heutige Verständnis die Identität nicht als unitäre, feste Einheit, sondern als „komplexe Struktur (…) aus einer Vielzahl einzelner Elemente[38] “ verstehen muss. Tatsächlich ist es notwendig, sich zunächst von der Vorstellung zu befreien, dass Identität ein in sich geschlossenes Konzept ist. Der schottische Philosoph David Hume[39] verstand die Identität als Zusammenspiel von Sinneseindrücken und Ideen, die in konstanter Wechselwirkung zu einander stehen und als Zustrom zur Identitätsbildung beitragen[40]. Für die virtuelle Identität bedeutet dies, dass auch sie einen Beitrag zum Gesamtkonzept bildet und ein Teil davon wird, von dem das reale Selbst profitieren kann. De Mul (2005) schreibt über die Identitätskonstruktion:
Our identity is not a simple fact, but a continuous task, only ending with our death. In our everyday existence we are always, as we like to say about our websites, “under construction”. (S. 253)
Nur wenn der Mensch sich eingesteht, dass sich die eigene Identität in einem stetigen Lernprozess befindet, entwickelt er die Kompetenz, sich auf neue Sichtweisen und Wahrnehmungen einzulassen. Dieser Grundsatz gilt für alle Bereiche, in denen das Ich sich mit Unbekannten konfrontiert sieht, deren Handhabung erlernt werden muss. Erst im Zuge des Lernprozesses kann der Mensch herausfinden, inwieweit virtuelle Welten für ihn relevant sind. So beschreibt auch Turkle (1999) diesen Prozess:
[...]
[1] http://www.wow-europe.com , http://www.spiegel.de
[2] „als Kraft vorhanden“ bzw. „tüchtig, (gut) beschaffen“
[3] „(Mannes-)Kraft“, „Tugend“, „Fähigkeit“
[4] vgl. Ohly, K. (2003), http://www.vov.de/ueber-uns/virtuell.html
[5] vgl. Poitzmann (2007), S. 45ff
[6] vgl. Döring (2003), S. 45-48
[7] vgl. Pangaro, P. (2006), http://www.pangaro.com/published/cyber-macmillan.html
[8] vgl. Neuhaus W. (2006), http://www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23727/1.html
[9] „kybernetisch“ und „Raum, Weltraum“
[10] Gibson, W. (1997). Chrom brennt. In Gibson, W. (1997). Vernetzt. Johnny Mnemonic und andere Geschichten (S. 204ff). Hamburg: Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins
[11] Gibson, W. (2000). Die Neuromancer-Trilogie. München: Wilhelm Heyne Verlag
[12] Sterling, B. (1994), ftp://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/pub/mirror/ibiblio/gutenberg/etext94/hack12.txt
[13] http://www.aec.at/de/index.asp
[14] vgl. „The Mentor“ (1986), http://www.phrack.org/archives/7/P07-03
[15] vgl. Barlow, John P. (1996), http://www.heise.de/tp/r4/artikel/1/1028/1.html
[16] vgl. prominente Filmbeispiele wie „The Matrix“ (1999), „Vanilla Sky” (2001)
[17] vgl. Döring (2003), S. 48
[18] entnommen aus einem IRC-Chatlog: irc.euIRC.net, #german-bash.org
[19] vgl. http://www.kidsonthenet.com/adventures/nikcyber.jpg , http://www.christianhubert.com/writings/cyberspace1.jpeg , http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php
[20] “Advanced Research Projects Agency”
[21] vgl. Div., http://www.bsi-fuer-buerger.de/internet/index.htm
[22] z.B. http://www.chat4free.de , http://www.chatcity.de
[23] z.B. IRC, „Internet Relay Chat“, siehe auch http://helios-matrix.net/IRCMan/
[24] z.B. https://worldtalk.de/ , oder satirisch: http://das.weltenbuch.de/index.html
[25] MUDs, „Multi User Dungeons“ wurden Ende der 1970er Jahre auf Basis am Computer spielbarer Text-Adventures erschaffen, vgl. Burka, L. (1995), http://www.linnaean.org/~lpb/muddex/mudline.html
[26] Beispiele sind der Bilderdienst „flickr“, http://flickr.com oder das gemeinsame Indexieren von Lesezeichen auf „del.icio.us“, http://del.icio.us
[27] http://wikipedia.org
[28] engl. Wortkreuzung zwischen „World Wide Web“ und „Log“ für Logbuch
[29] z.B. berufsbezogene Netzwerke: http://xing.com , http://linkedin.com ; persönliche Netzwerke: http://myspace.com , http://www.facebook.com , http://studivz.de
[30] „Massively Multiplayer Online (Role-Playing) Games“ – Spiel bzw. Rollenspiel, bei dem sehr viele Spieler zusammen in einer persistenten Welt Abenteuer erleben und interagieren können
[31] Die Suchtgefahr hängt von der Vielfalt der Möglichkeiten in der Welt ebenso wie vom Ausmaß der Selbstinszenierung ab. Kommunikation und kompetitive Aspekte spielen ebenfalls eine große Rolle.
[32] de Mul (2005), S. 262f
[33] im IRC beispielsweise: „/q“ für ein privates Gespräch (Query), „/msg nickserv identify“ zur Identifizierung des eigenen Namens
[34] vom Lateinischen „idem“, derselbe
[35] http://www.euro-ro.net
[36] entnommen aus einer privaten Nachricht einer Nutzerin über ihre Charaktere
[37] vgl. Turkle (1999), S. 289, 375
[38] vgl. Döring (2003), S. 325
[39] David Hume (1711-1776) war Vertreter der philosophischen Strömung des Empirismus
[40] vgl. de Mul (2005), S. 255.
- Citar trabajo
- Simone Lackerbauer (Autor), 2008, Leben im Netz - Philosophie und Realität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133434