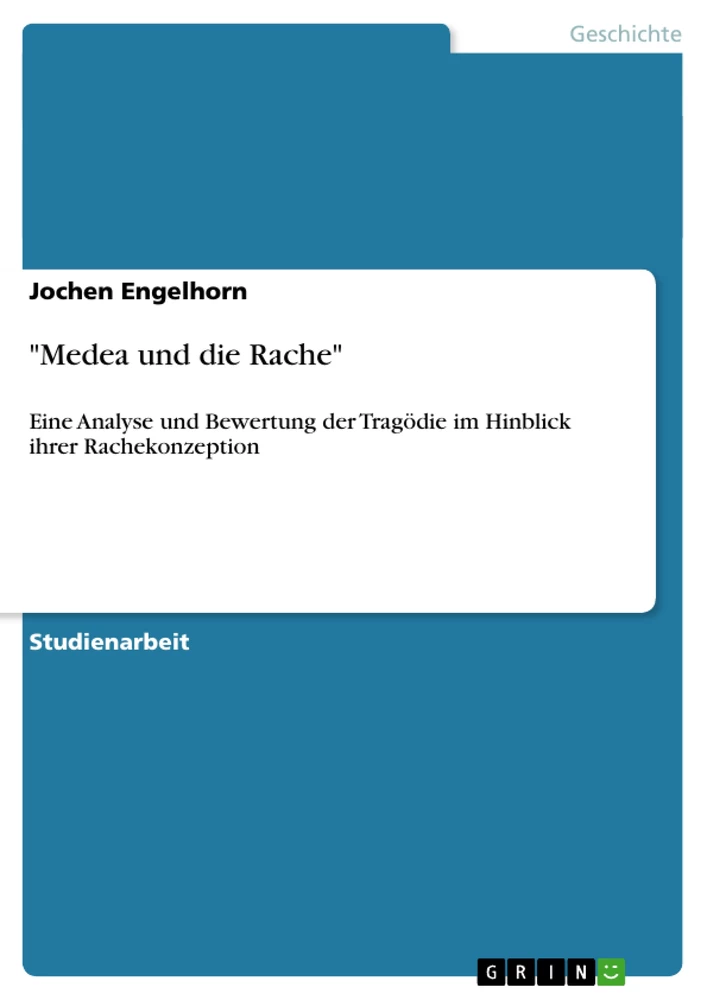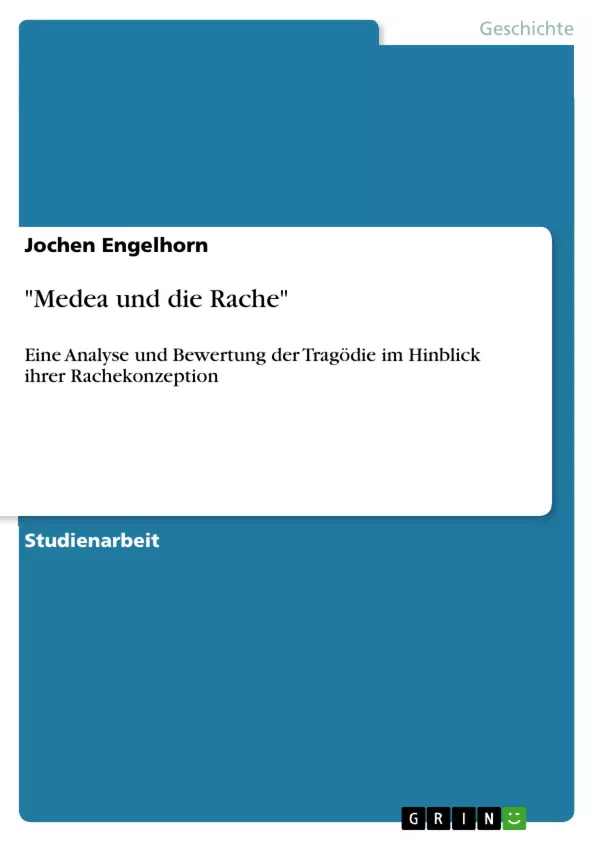„Wer Rache nimmt, ist nicht besser als sein Feind. Verzichtet er aber darauf, dann ist er ihm überlegen.“ (Francis Bacon)
Rache gab es immer schon; Rache wird es immer geben. Francis Bacon vertritt mit seiner Auffassung von Vergeltung die Moralverstellungen unserer heutigen modernen Gesellschaft. Doch wie sieht diese in anderen Gesellschaften aus? Besonders die Antike war von der Vorstellung geprägt, Unrecht durch eigenhändige Vergeltungstaten ausgleichen zu können. Gerechtigkeit durch Rache – man ging geradezu davon aus, den Schaden nur wiedergutmachen zu können, indem man ihn mit geballter Wucht zurückschleuderte. Der Feind sollte seine eigene Tat zu spüren bekommen. Unter den zahlreichen Darstellungen von Rache ist die Medea des Euripides wohl einer der grauenvollsten und zugleich faszinierendsten Persönlichkeiten der antiken Literatur. Die Rache der Medea ist besonders. Sie macht keinen Halt vor einem wehrlosen Opfer, keinen Halt vor den eigenen Kindern. Rache in ihrer grausamsten Form – des Kindermords.
Ausgehend von diesem Bühnenstück sollen in der vorliegenden Arbeit die verschiedenen Aspekte der Rache Medeas analysiert werden, um diese mit der antiken Vorstellung von Rache und Vergeltung zu vergleichen und daraus die mögliche gesellschaftliche Wirkung und Funktion der Tragödie erfassen zu können. Lässt sich die literarische Verarbeitung dieser extremen Form von Rache mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen vergleichen? Welche Wirkung könnte diese Darstellung erzielt haben? Und welche Rolle spielen dabei gesellschaftliche Prozesse und Hintergründe?
Nach einer Betrachtung zum Umgang der Griechen mit Rache und Vergeltung folgt daher eine ausführliche Analyse der Tragödie, die besonderes Augenmerk auf die Merkmale der Rache Medea legt und diese von verschiedenen Blickwinkeln her untersucht. Neben den verschiedenen Ursachen und Konsequenzen dieses Vergeltungsakts wird näher auf die Besonderheiten des Kindermords, die heldenhaften Züge Medeas und die sich daraus ergebende innere Zerrissenheit der Mutter eingegangen und die Rolle des Chors näher betrachtet. Abschließend sollen die Ergebnisse in den zeitgenössischen Kontext eingeordnet werden, um die literarische Darstellung der Rache auf ihre gesellschaftliche Bedeutung zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Rache bei den Griechen
- III. Die Rache der Medea
- a) Die Medea des Euripides
- b) Medeas Rache - Motive und ihre Wirkung
- c) Die Absolutheit der Rache - der Kindermord
- d) Die „Männlichkeit“ der Rache
- e) Die Rolle des Chors
- IV. Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Relevanz
- V. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rachekonzeption in Euripides' Medea-Tragödie im Kontext der antiken griechischen Vorstellung von Rache und Vergeltung. Es wird untersucht, wie Medeas Rache im Vergleich zu den allgemeinen Wertvorstellungen der Zeit steht und welche gesellschaftliche Wirkung und Funktion die Tragödie möglicherweise hatte. Die Analyse betrachtet die Motive und Konsequenzen von Medeas Taten, insbesondere den Kindermord, und beleuchtet die Rolle des Chors.
- Medeas Rachemotive und ihre Darstellung in Euripides' Tragödie
- Der Kindermord als Höhepunkt der Rache und seine gesellschaftliche Bedeutung
- Vergleich von Medeas Rache mit dem antiken Verständnis von Recht und Vergeltung
- Die Rolle des Chors und seine Funktion im Stück
- Gesellschaftliche Kontextualisierung der Tragödie und ihrer Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Rache im antiken Griechenland und in der modernen Gesellschaft ein. Sie stellt Euripides' Medea als Beispiel für eine besonders grausame und faszinierende Rachefigur vor und skizziert die Forschungsfrage: Lässt sich die literarische Verarbeitung dieser extremen Racheform mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen vergleichen? Die Arbeit kündigt die Analyse der Tragödie und die Einordnung der Ergebnisse in den zeitgenössischen Kontext an, um die gesellschaftliche Bedeutung der literarischen Darstellung der Rache zu überprüfen. Die Einleitung erwähnt außerdem relevante wissenschaftliche Arbeiten, die der Autor für seine Analyse heranzieht, mit einem Fokus auf die Einbeziehung zeitgeschichtlicher Umstände.
II. Die Rache bei den Griechen: Dieses Kapitel untersucht den Umgang mit Rache und Vergeltung im antiken Griechenland. Es zeigt, dass Rache ein bedeutender Bestandteil der griechischen Lebenswelt war, in Mythen, Epen und dem attischen Theater gleichermaßen präsent. Der Text analysiert Aspekte wie das Recht auf Rache (eng verknüpft mit Recht und Gerechtigkeit), die Pflicht zur Rache (einschließlich Blutrache und „Racheloyalität“), und die Erwiderungsmoral (die Rache als Akt der Gegenseitigkeit im Freund-Feind-Denken). Das Kapitel legt den Grundstein für den Vergleich mit Medeas spezifischer Rachehandlung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Rachekonzeption in Euripides' Medea
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rachekonzeption in Euripides' Medea-Tragödie. Sie untersucht Medeas Rache im Kontext der antiken griechischen Vorstellung von Rache und Vergeltung und deren gesellschaftliche Wirkung und Funktion. Ein besonderer Fokus liegt auf den Motiven und Konsequenzen von Medeas Taten, insbesondere dem Kindermord, sowie der Rolle des Chors.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Medeas Rachemotive und ihre Darstellung in Euripides' Tragödie; den Kindermord als Höhepunkt der Rache und seine gesellschaftliche Bedeutung; einen Vergleich von Medeas Rache mit dem antiken Verständnis von Recht und Vergeltung; die Rolle des Chors und seine Funktion im Stück; und die gesellschaftliche Kontextualisierung der Tragödie und ihrer Rezeption.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über Rache bei den Griechen allgemein, ein Kapitel über Medeas Rache mit Unterkapiteln zu verschiedenen Aspekten (Medeas Motive, der Kindermord, die „Männlichkeit“ der Rache, die Rolle des Chors), ein Kapitel zu Rahmenbedingungen und gesellschaftlicher Relevanz und eine Schlussbetrachtung.
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung führt in das Thema Rache im antiken Griechenland und in der modernen Gesellschaft ein. Sie stellt Euripides' Medea vor und skizziert die Forschungsfrage, ob sich die literarische Verarbeitung dieser extremen Racheform mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen vergleichen lässt. Sie kündigt die Analyse der Tragödie und die Einordnung der Ergebnisse in den zeitgenössischen Kontext an und erwähnt relevante wissenschaftliche Arbeiten.
Was wird im Kapitel über Rache bei den Griechen behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Umgang mit Rache und Vergeltung im antiken Griechenland. Es zeigt die Bedeutung von Rache in der griechischen Lebenswelt (Mythen, Epen, Theater), analysiert Aspekte wie das Recht auf Rache, die Pflicht zur Rache (Blutrache, „Racheloyalität“) und die Erwiderungsmoral. Es dient als Grundlage für den Vergleich mit Medeas Rache.
Wie wird Medeas Rache analysiert?
Das Kapitel über Medeas Rache analysiert Medeas Motive, die Konsequenzen ihrer Taten (insbesondere den Kindermord), und die Rolle des Chors. Es untersucht auch die Frage nach der „Männlichkeit“ der Rache und vergleicht Medeas Handeln mit dem antiken Verständnis von Recht und Vergeltung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die gesellschaftliche Bedeutung der literarischen Darstellung von Rache in Euripides' Medea im Kontext der antiken griechischen Kultur. (Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist aus dem gegebenen Text nicht detailliert ersichtlich.)
Welche Quellen werden verwendet?
Der Text erwähnt, dass relevante wissenschaftliche Arbeiten herangezogen werden, mit einem Fokus auf die Einbeziehung zeitgeschichtlicher Umstände. Die konkreten Quellen werden jedoch im gegebenen Text nicht genannt.
- Quote paper
- Jochen Engelhorn (Author), 2008, "Medea und die Rache", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133439