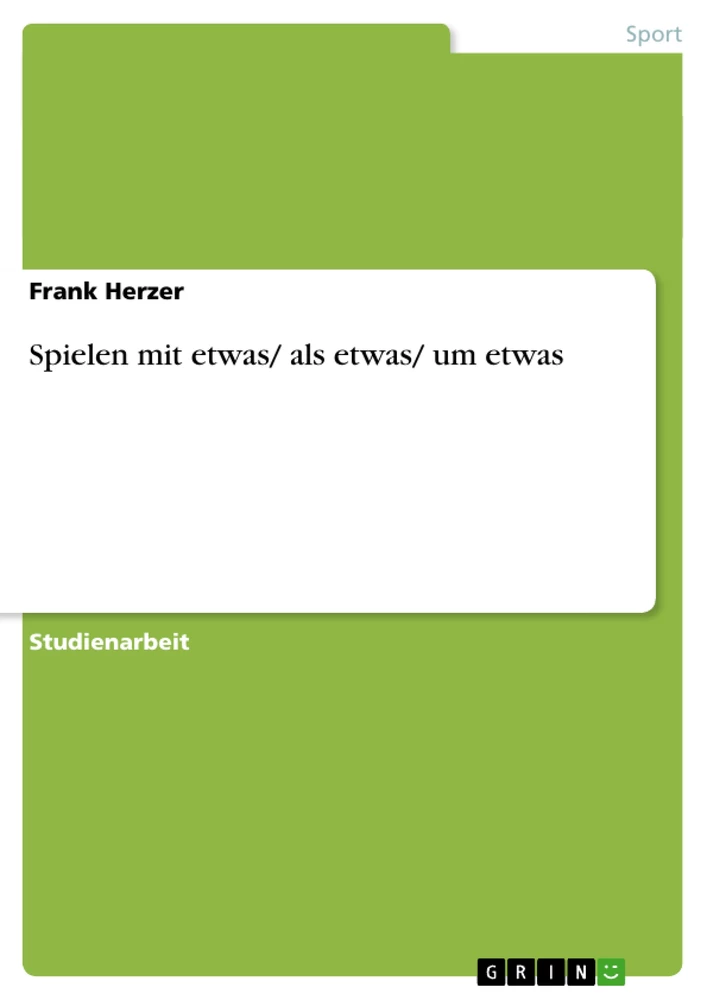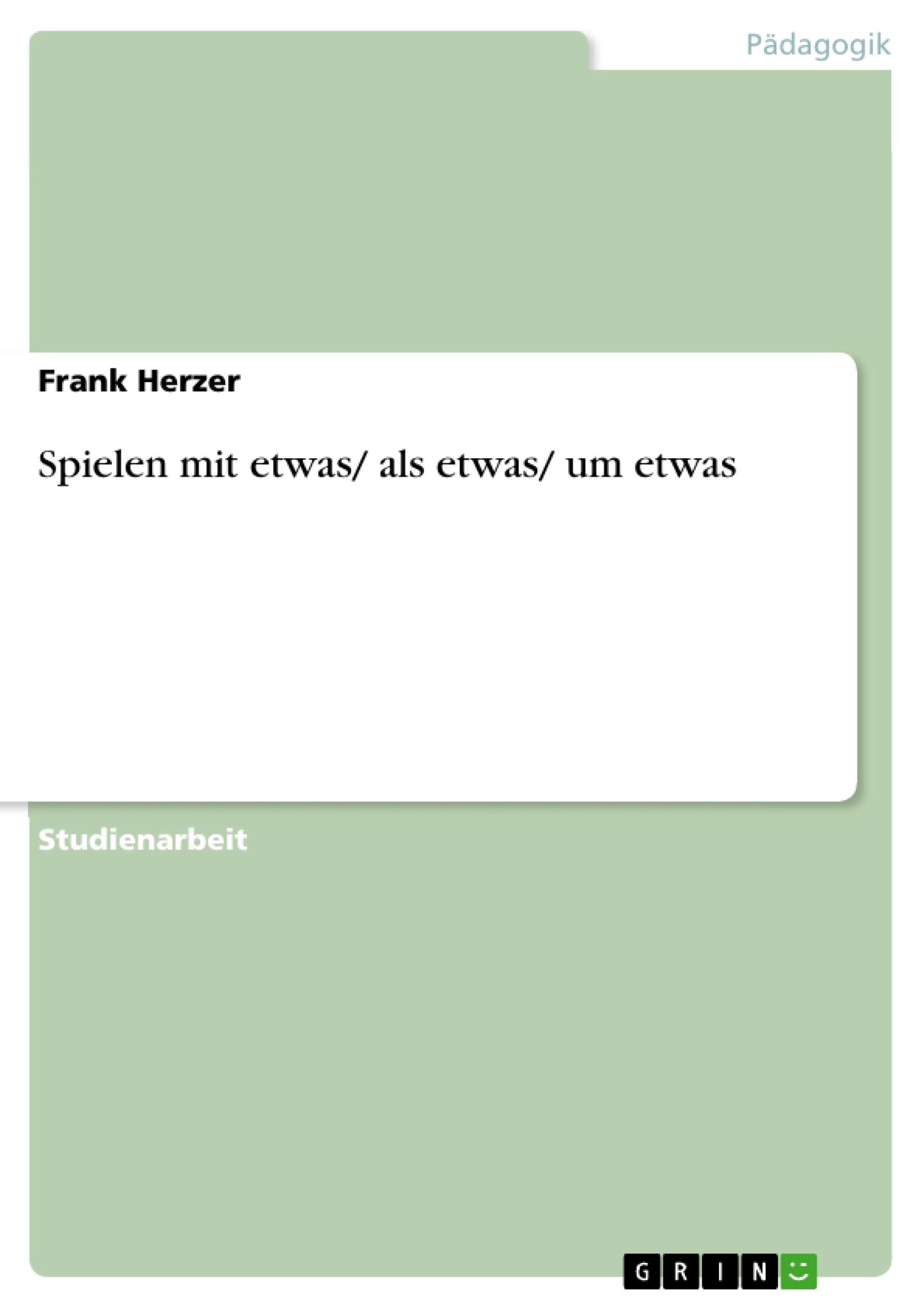Das Spielen mit etwas, als etwas und um etwas und der damit verbundene Bereich der Bewegungsspiele und der Kleinen Spiele, ist ein sehr weit gefächertes Themengebiet. Es gibt dazu schon viele umfangreiche Sammlungen, theoretische Ansätze, Beiträge und Veröffentlichungen.
Diese Spiele sind sehr beliebt und werden in den verschiedensten Bereichen und Altersstufen eingesetzt. Neben dem Freizeit- und Breitensport, in Rehabilitation und Behindertensport, im Training von Leistungssportlern und im Vorschulbereich finden Bewegungsspiele vor allem in der Schule Verwendung (vgl. Döbler, 1998, S. 21 ff.). In ihnen steckt dabei hohes Potential in Bezug auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, welches jedoch nur selten und meist nicht effektiv genug durch die(Sport-)Lehrer genutzt wird.
Ich möchte mich deshalb nun speziell mit folgender Frage beschäftigen: „Wie kann es im Rahmen von Schule und Sportunterricht gelingen, die Potentiale von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen optimal zu nutzen?“
Grund für die Auswahl genau dieser Fragestellung ist sowohl die, in meinen Augen, hohe Bedeutung für die Praxis von Sportlehrern, als auch die wichtige Rolle, die die Spiele in der Entwicklung der Schüler spielen können. Der Wert, den die Bewegungsspiele und Kleinen Spiele besitzen, wird dabei häufig zu gering geschätzt. Die Spiele haben oftmals nur eine Randstellung, werden also als Lückenfüller oder Belohnung am Ende der Stunde gebraucht (vgl. Dietrich, 1980, S. 13). Andererseits findet eine »Verzweckung« statt, das heißt die Kleinen Spiele werden „zielorientiert im Unterrichtsverlauf untergebracht und dort für andere Zwecke funktionalisiert, was ihnen [..] ihren Eigenwert und –sinn nimmt“ (Lange & Sinning, 2008, S. 342).
Im Folgenden werde ich mich der Fragestellung zunächst theoretisch nähern. Nachdem ich kurz auf das Spielen an sich eingehe, möchte ich die Bewegungsspiele und Kleinen Spiele genauer betrachten und systematisieren. Im Anschluss versuche ich darzulegen, welche Potentiale in den Spielen stecken und welche Möglichkeiten es in der Schule gibt, sie zur Entfaltung zu bringen. Im letzten Teil werde ich die gewonnen Ergebnisse in den Schlussbemerkungen noch einmal zusammenfassend darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen des Spiels
- 2.1. Begriffsbestimmungen
- 2.2. Merkmale des Spiels
- 3. Kleine Spiele und Bewegungsspiele
- 3.1. Merkmale der Kleinen Spiele und Bewegungsspiele
- 3.1.1. Merkmale der Kleinen Spiele
- 3.1.2. Merkmale der Bewegungsspiele
- 3.2. Vergleich Kleiner Spiele und Bewegungsspiele
- 3.2.1. Gemeinsamkeiten
- 3.2.2. Unterschiede
- 3.3. Systematisierungen der Bewegungsspiele
- 3.3.1. Systematisierung nach Dietrich
- 3.3.2. Systematisierung nach Landau & Maraun
- 4. Potentiale von Bewegungsspielen
- 4.1. Spielpotentiale
- 4.2. Lernpotentiale im Bereich des Spiele Erfindens
- 4.3. Potentiale in verschiedenen Altersstufen
- 5. Schule und Sportunterricht
- 5.1. Bewegungsspiele im Sportunterricht
- 5.2. Spielen und Lernen
- 5.3. Spielbedingungen
- 6. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Potential von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen im Schul- und Sportunterricht. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie diese Potentiale optimal genutzt werden können, da sie in der Praxis oft unterschätzt oder ineffektiv eingesetzt werden. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Spiele für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
- Begriffsbestimmung und Merkmale von Spielen
- Charakteristika von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen
- Systematisierung von Bewegungsspielen
- Potentiale von Bewegungsspielen in verschiedenen Kontexten
- Optimale Nutzung von Bewegungsspielen im Schul- und Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Spielens mit etwas/als etwas/um etwas ein und benennt die Forschungsfrage: Wie können die Potentiale von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen im Schul- und Sportunterricht optimal genutzt werden? Die hohe Bedeutung dieser Fragestellung für die Praxis von Sportlehrern und die Entwicklung der Schüler wird hervorgehoben. Die unzureichende Nutzung und die „Verzweckung“ von Bewegungsspielen im Unterricht werden kritisch betrachtet. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der sich mit den Grundlagen des Spiels und den Merkmalen von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen beschäftigt, und einen praktischen Teil, der die Potentiale der Spiele und deren Anwendung im Schul- und Sportunterricht untersucht.
2. Grundlagen des Spiels: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Spielbegriff und seine Merkmale. Es werden verschiedene Definitionen des Spiels diskutiert, mit einem Fokus auf die Definition von Johan Huizinga. Die zentralen Merkmale des Spiels wie Zweckfreiheit, Freiwilligkeit, Geschlossenheit, Scheinhaftigkeit, innere Unendlichkeit und Ambivalenz werden erläutert und anhand von Beispielen verdeutlicht. Der Abschnitt betont die Vielschichtigkeit des Spielbegriffs und die unterschiedlichen Interpretationen in der Literatur.
3. Kleine Spiele und Bewegungsspiele: Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung und Systematisierung von Kleinen Spielen und Bewegungsspielen. Es werden die spezifischen Merkmale beider Spielarten herausgearbeitet und im Vergleich dargestellt. Die Kapitel diskutiert verschiedene Systematisierungsansätze, insbesondere die von Dietrich und Landau & Maraun, um ein umfassenderes Verständnis der Struktur und Vielfalt von Bewegungsspielen zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden Spielarten.
4. Potentiale von Bewegungsspielen: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Potentiale von Bewegungsspielen untersucht, sowohl im Hinblick auf das Spielerlebnis als auch auf die Förderung von Lernprozessen. Es wird auf die Potentiale im Bereich des Spieleerfindens und die altersgruppenspezifischen Möglichkeiten eingegangen. Der Abschnitt betont die Bedeutung von Bewegungsspielen für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
5. Schule und Sportunterricht: Der fünfte Abschnitt widmet sich der Bedeutung von Bewegungsspielen im Schul- und Sportunterricht. Er beleuchtet die Rolle von Spielen im Lernprozess und die Gestaltung geeigneter Spielbedingungen. Die Kapitel diskutiert praktische Ansätze zur Integration von Bewegungsspielen in den Unterricht und betont die Notwendigkeit, die Potentiale der Spiele effektiv zu nutzen.
Schlüsselwörter
Bewegungsspiele, Kleine Spiele, Spieltheorie, Spielmerkmale, Schul- und Sportunterricht, Lernpotentiale, Spielpädagogik, Entwicklungsförderung, Didaktik, Systematisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Bewegungsspiele und Kleine Spiele im Schul- und Sportunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Potential von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen im Schul- und Sportunterricht. Ziel ist es aufzuzeigen, wie diese Potentiale optimal genutzt werden können, da sie in der Praxis oft unterschätzt oder ineffektiv eingesetzt werden. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Spiele für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Begriffsbestimmung und Merkmale von Spielen; Charakteristika von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen; Systematisierung von Bewegungsspielen; Potentiale von Bewegungsspielen in verschiedenen Kontexten; Optimale Nutzung von Bewegungsspielen im Schul- und Sportunterricht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Grundlagen des Spiels, Kleinen Spielen und Bewegungsspielen, den Potentialen von Bewegungsspielen und deren Einsatz im Schul- und Sportunterricht, sowie Schlussbemerkungen. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Spielarten werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Kleinen Spielen und Bewegungsspielen. Es werden die spezifischen Merkmale beider Spielarten herausgearbeitet und im Vergleich dargestellt, inklusive Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Wie werden Bewegungsspiele systematisiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Systematisierungsansätze von Bewegungsspielen, insbesondere die von Dietrich und Landau & Maraun, um ein umfassenderes Verständnis der Struktur und Vielfalt von Bewegungsspielen zu schaffen.
Welche Potentiale von Bewegungsspielen werden beleuchtet?
Die Arbeit untersucht die verschiedenen Potentiale von Bewegungsspielen, sowohl im Hinblick auf das Spielerlebnis als auch auf die Förderung von Lernprozessen. Es wird auf die Potentiale im Bereich des Spieleerfindens und die altersgruppenspezifischen Möglichkeiten eingegangen.
Wie können Bewegungsspiele im Unterricht optimal eingesetzt werden?
Der Abschnitt "Schule und Sportunterricht" widmet sich der Bedeutung von Bewegungsspielen im Schul- und Sportunterricht. Er beleuchtet die Rolle von Spielen im Lernprozess und die Gestaltung geeigneter Spielbedingungen. Es werden praktische Ansätze zur Integration von Bewegungsspielen in den Unterricht diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bewegungsspiele, Kleine Spiele, Spieltheorie, Spielmerkmale, Schul- und Sportunterricht, Lernpotentiale, Spielpädagogik, Entwicklungsförderung, Didaktik, Systematisierung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie können die Potentiale von Bewegungsspielen und Kleinen Spielen im Schul- und Sportunterricht optimal genutzt werden?
Welche Definition des Spiels wird verwendet?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen des Spiels, mit einem Fokus auf die Definition von Johan Huizinga. Zentrale Merkmale des Spiels wie Zweckfreiheit, Freiwilligkeit, Geschlossenheit, Scheinhaftigkeit, innere Unendlichkeit und Ambivalenz werden erläutert.
- Citar trabajo
- Frank Herzer (Autor), 2009, Spielen mit etwas/ als etwas/ um etwas, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133926