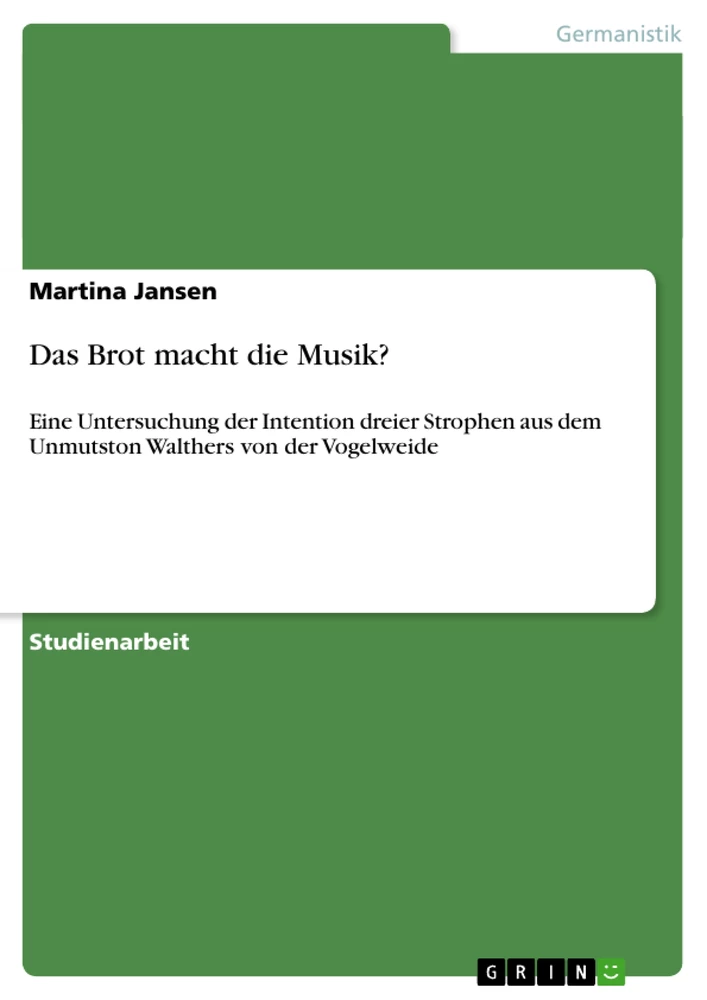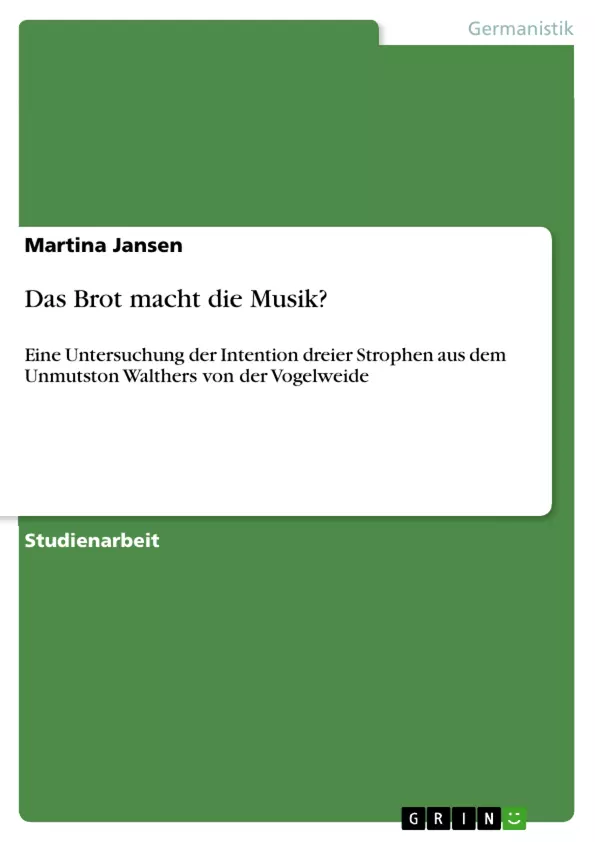Wer kennt ihn nicht –Walther von der Vogelweide.
Wer sich mit Sangspruchdichtung auseinandersetzt, wird erst recht nicht an Walther vorbeikommen. Zwar ist er der Allgemeinheit als Minnesänger bekannt, aber er hat ebenfalls zahlreiche Sangsprüche verfasst, deren Interpretation nicht minder interessant ist. Das heißt Walther von der Vogelweide war beides zugleich: Minnesänger und Sangspruchdichter, was nicht selbstverständlich ist, für Mediävisten aber eine große Bandbreite an Kunst des Dichters bietet. Es bietet uns ebenso eine Menge an Quellen, die uns Hinweise über die Biographie Walthers und die Geschehnisse zu seiner Zeit geben. Dieser große Gehalt der Minnelieder und Sangsprüche ist das, war ihre Interpretation so interessant macht. Man kann sie deshalb in vielerlei Hinsicht auf ihre Intention und Bedeutung hinterfragen. Besonders in Walthers Strophen finden sich vielerlei Themengebiete, die auf sehr unterschiedliche Weise in Erscheinung treten und die immer wieder zu der Frage anregen, inwiefern hier bloße künstlerische Fiktion oder persönliche Reflexionen des Autors vorliegen. Gerade wenn in Walthers Strophen ein Ich spricht, was nicht selten vorkommt, möchte man nur allzu gern glauben Walther spräche von sich und seinen Lebenserfahrungen. Doch damit kommt noch eine weitere Frage ins Spiel: Inwiefern sind diese Strophen dann als Auftragsdichtung zu verstehen; konnte der Dichter mit ihnen sein Geld verdienen?
Wahrscheinlich wird man nie hinreichende Antworten auf diese Fragen finden, da wir zu wenig über die Dichter des Mittelalters wissen und nur aus ihren Liedern und Strophen lesen können. Dennoch kann die sinnvolle Analyse der Werke uns helfen ein Stück weiter in das Mittelalter und seine Sangeskunst einzutauchen.
Diese Arbeit soll deshalb versuchen anhand der näheren Betrachtungen dreier Strophen aus dem Unmutston Walthers von der Vogelweide den leitenden Fragen näher zu kommen und eine Einordnung dieser Strophen zu schaffen. Dabei soll immer der Blick auf den Autor und seine Lebensumstände gerichtet bleiben, damit der Inhalt der Strophen erschlossen werden kann. Es sollen hier deshalb zunächst Leben und Werk Walthers grob skizziert werden, bevor eine eingehende Betrachtung der Strophen stattfindet. Schließlich soll zum Schluss der Versuch gewagt werden Walthers Intentionen und die Rolle seines lyrischen Ichs zu ergründen sowie der Frage nach der Eigenschaft der Strophen als Auftragskunst nachzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Walther von der Vogelweide als Sangspruchdichter
- Sangspruchdichtung
- Walther —Person und Werk
- Der Unmutston
- Ausgewählte Strophen: L 31,13; L 32,7; L 34,34
- Interpretationsmöglichkeiten der Strophen
- L 31,13 -Gut und Ehre
- L 32,7 - Kunstklage
- L 34,34 - Drei-Fürsten-Preis
- Intention Walthers
- Rolle des lyrischen Ichs
- Können wir die Strophen als Auftragsdichtung verstehen?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Interpretation dreier Strophen aus dem Unmutston Walthers von der Vogelweide. Ziel ist es, die Intention des Dichters hinter diesen Strophen zu ergründen und eine Einordnung in den Kontext seiner Lebensumstände und des zeitgenössischen Geschehens zu schaffen.
- Die Rolle des lyrischen Ichs in Walthers Strophen
- Die Frage nach der Auftragskunst in der Sangspruchdichtung
- Die Kritik an der höfischen Gesellschaft und den Werten des Adels
- Die Rolle des fahrenden Sängers und die Abhängigkeit von Gönnern
- Die Bedeutung der Sangspruchdichtung als Kunstform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt Walther von der Vogelweide als bedeutenden Lyriker des Mittelalters vor. Sie erläutert die Besonderheiten der Sangspruchdichtung und die Bedeutung der Biographie des Autors für die Interpretation seiner Werke.
Das Kapitel ,Walther von der Vogelweide als Sangspruchdichter' erklärt die Merkmale der Sangspruchdichtung und unterscheidet sie vom Minnesang. Es beleuchtet die Themenvielfalt der Sangsprüche und die Bedeutung der Melodie für die Aufführungssituation. Des Weiteren wird die Person Walthers von der Vogelweide vorgestellt und sein Schaffen als Minnesänger und Sangspruchdichter beleuchtet. Dabei wird auch auf die Rolle des fahrenden Sängers und die Abhängigkeit von Gönnern eingegangen.
Das Kapitel ,Der Unmutston' beschreibt die Entstehung und die Struktur des Unmutstons, einem Ton Walthers von der Vogelweide, der durch seine große Anzahl an Strophen und seine thematische Vielfalt auffällt.
Das Kapitel ,Interpretationsmöglichkeiten der Strophen' analysiert drei ausgewählte Strophen aus dem Unmutston: ,L 31,13 -Gut und Ehre', ,L 32,7 - Kunstklage' und ,L 34,34 - Drei-Fürsten-Preis'. Es werden die Inhalte der Strophen beleuchtet und die möglichen Intentionen Walthers hinter diesen Versen diskutiert. Dabei wird auch auf die Rolle des lyrischen Ichs und die Frage nach der Auftragsdichtung eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sangspruchdichtung, Walther von der Vogelweide, den Unmutston, die Rolle des lyrischen Ichs, die Auftragsdichtung, die höfische Gesellschaft, der Adel, der fahrende Sänger, die Abhängigkeit von Gönnern und die Bedeutung der Kunst.
Häufig gestellte Fragen
War Walther von der Vogelweide nur ein Minnesänger?
Nein, er war zugleich ein bedeutender Sangspruchdichter, was ihm ermöglichte, auch politische und gesellschaftliche Themen seiner Zeit zu kommentieren.
Was versteht man unter dem „Unmutston“?
Der Unmutston ist eine Gruppe von Strophen Walthers, die durch thematische Vielfalt und Kritik an der höfischen Gesellschaft sowie den herrschenden Zuständen geprägt sind.
Sind seine Lieder als reine Fiktion oder persönliche Reflexion zu verstehen?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen künstlerischer Fiktion und persönlichen Erfahrungen, die durch das lyrische Ich ausgedrückt werden.
Was bedeutet „Auftragsdichtung“ im Kontext des Mittelalters?
Es bezeichnet Werke, die im Auftrag eines Gönners oder Fürsten entstanden sind, um deren Lob zu verbreiten oder politische Interessen zu unterstützen.
Warum war Walther von Gönnern abhängig?
Als fahrender Sänger besaß er kein festes Einkommen und war auf die materielle Unterstützung (das „Brot“) adliger Gönner angewiesen, um seine Kunst auszuüben.
- Citar trabajo
- Martina Jansen (Autor), 2009, Das Brot macht die Musik? , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134097