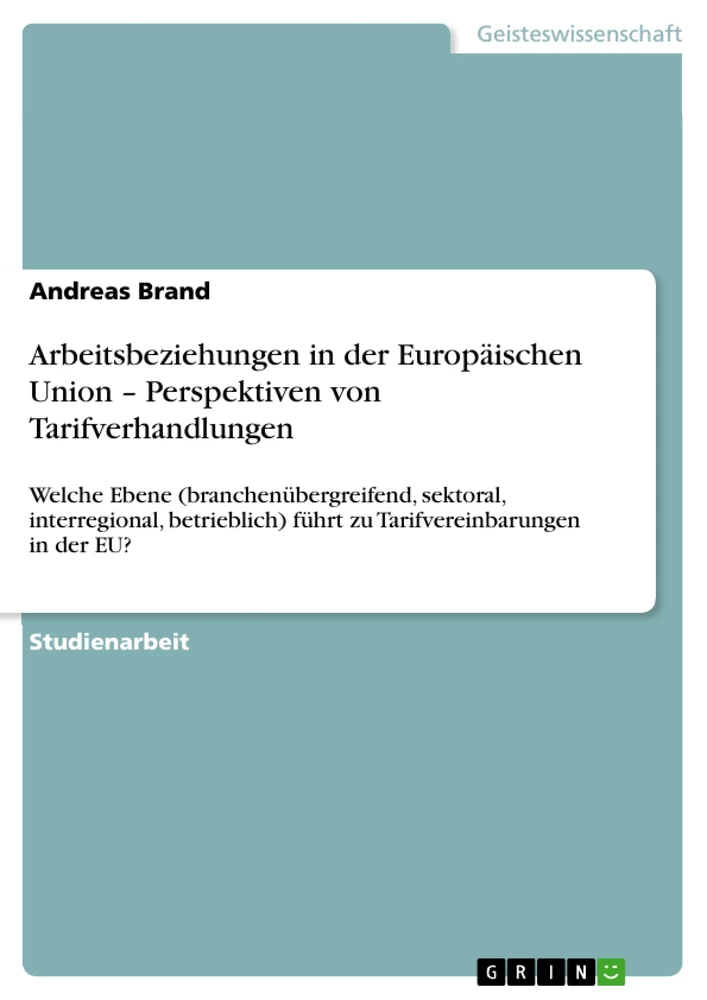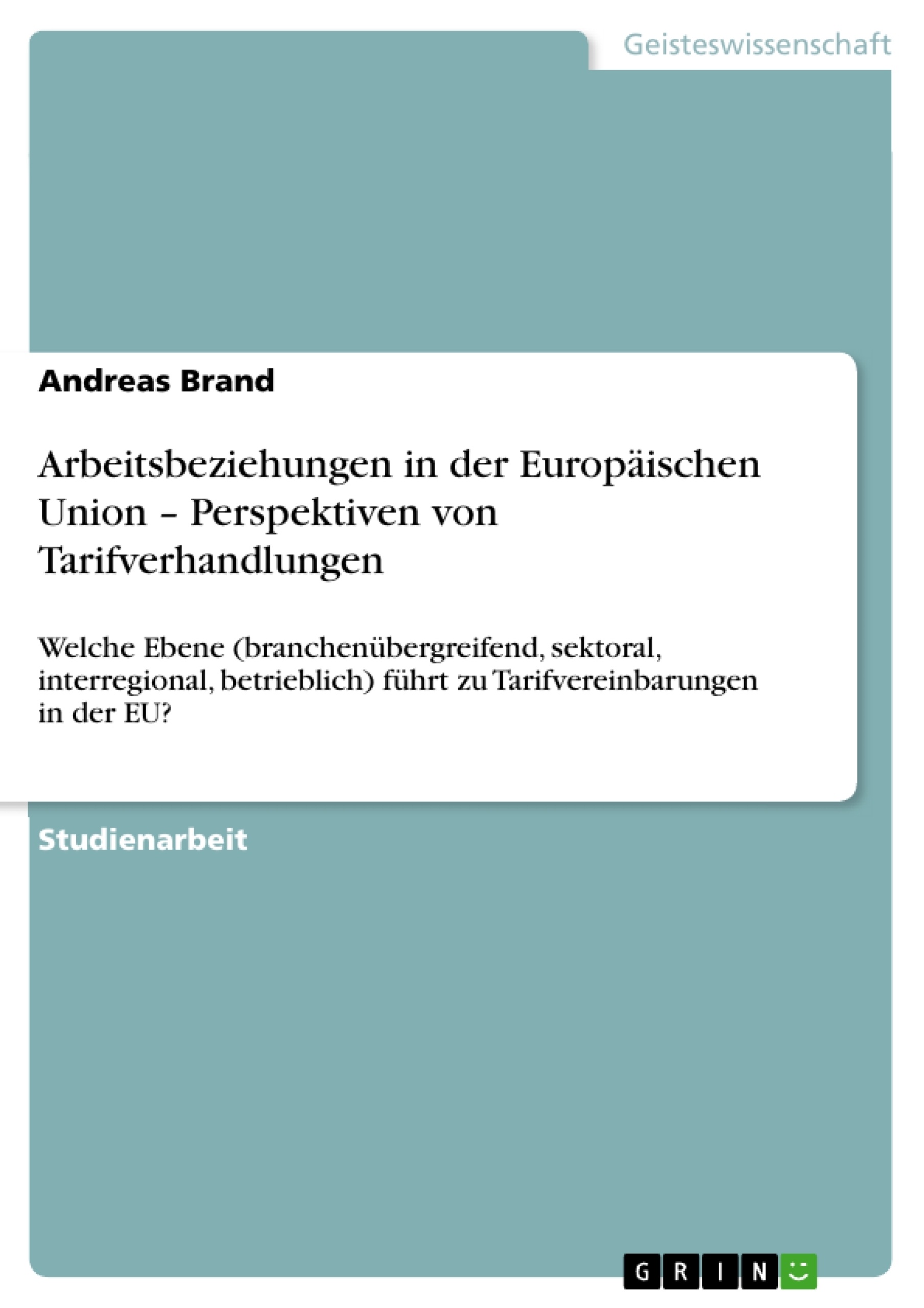Das Zusammenwachsen der verschiedenen europäischen Länder zu einer Europäischen Union mit Blick auf die Globalisierung ist ein einzigartiger Vorgang in der Geschichte. Dabei werden die entwickelten Arbeitsbeziehungssysteme der EU-Staaten beeinflußt und die Gewerkschaften somit gezwungen, ihre Arbeitsbeziehungen auf die europäische Ebene auszuweiten.
Es existieren vier Ebenen der europäischen Arbeitsbeziehungen, die zentrale, sektorale, interregionale und die betriebliche Ebene, in denen Gewerkschafts- und Ar-beitgeberverbände in Beziehung treten oder treten können.
In dieser Arbeit werden zwei Fragen bezüglich der Ebenen verfolgt. Die erste Frage behandelt den Unterschied und die Sinnhaftigkeit von Sozialdialogen oder Kollektivverhandlungen. Die zweite Frage untersucht die Ebenen auf ihre Chancen, daß zukünftig Kollektivverhandlungen ausgebildet werden.
Diese Ebenen sind neu eingerichtet worden bzw. haben einen großen Impuls in den 90er Jahren bekommen. Trotzdem bestehen verschiedene Handlungsblockaden und Probleme. Aus diesem Grund werden die verschiedenen Ebenen nacheinander vorgestellt, wobei der zentralen als der wichtigsten und am weitesten entwickelten Ebene breiter Raum gewidmet wird. In diesem branchenübergreifenden Bereich werden am Anfang die europäischen Akteure mit großem Einfluß auf die europäischen Arbeitsbeziehungen dargestellt. Danach folgt die Beschreibung des Sozialdialogs mit der Darstellung seiner Probleme.
Danach werden die anderen Ebenen nach vorhandenen und möglichen Sozialdialogen und Kollektivverhandlungen sowie nach Hindernissen untersucht. Am Ende dieses Textes werden dann die oben genannten Fragen mit Bezug zu den vorigen Kapiteln beantwortet. Im Anhang werden zusätzliche Informationen zur Geschichte und Struktur der EU sowie der europäischen Verbände gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE VIER EBENEN
- DER SOZIALE DIALOG DER EUROPÄISCHEN EBENE
- Die Akteure auf europäischer Ebene
- Die europäischen Institutionen und die Struktur der Europäischen Union (EU)
- Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) oder European Trade Union Confederation (ETUC)
- Die europäischen Arbeitgeberverbände UNICE und CEEP
- Der Soziale Dialog
- Geschichte
- Die Struktur des „neuen" Sozialdialogverfahrens
- Bisherige Versuche des Sozialdialogs
- Restriktionen und Perspektiven des Sozialdialogs
- DER SEKTOR-LIE SOZIALE DIALOG
- INTERREGIONALE DIALOGE ZWISCHEN INTERREGIONALEN (IGR) LÄNDERN UND REGIONALEN ARBEITGEBERVERBÄNDEN
- DER DIALOG ZWISCHEN EUROPÄISCHEN BETRIEBSRÄTEN (EBR) UND MULTINATIONALEN UNTERNEHMEN
- DIE VIER EBENEN UND IHRE ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNGEN
- WELCHE ARBEITSBEZIEHUNG IST SINNVOLLER AUF DER EUROPÄISCHEN EBENE? DER SOZIALDIALOG ODER DIE KOLLEKTIVVERHANDLUNG?
- AUF WELCHER DER VIER EBENEN WERDEN ZUKÜNFTIG KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN ENTSTEHEN?
- ANHANG
- A 1 : DIE GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (EU)
- A2: ORGANISATIONSSTRUKTUR DES EGB (BREISIG, 1993, S.255)
- A3: ORGANISATIONSSTRUKTUR VON UNICE (BREISIG, 1993, S'82F.)
- A4: ORGANISATIONSSTRUKTUR VON CEEP (CEEP: 1999; JACOBI/KELLEN 1997 , S.65)
- ANHANG B
- ABB. 1 : DAS SYSTEM DER EG-INSTITUTIONEN (STRUKTUR IST DIE GLEICHE WIE IN DER EU)
- ABB. 2: STRUKTUR DES SOZIALDIALOGS NACH DEM SOZLUBKOMMEN
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die verschiedenen Ebenen der europäischen Arbeitsbeziehungen, die sich im Kontext der europäischen Integration und Globalisierung herausgebildet haben. Sie analysiert, wie Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbände auf diesen Ebenen miteinander interagieren und welche Möglichkeiten und Herausforderungen die jeweiligen Ebenen für die Gestaltung von Arbeitsbeziehungen bieten.
- Die verschiedenen Ebenen der europäischen Arbeitsbeziehungen (zentrale, sektorale, interregionale und betriebliche Ebene)
- Die Rolle des Sozialdialogs und der Kollektivverhandlungen auf den verschiedenen Ebenen
- Die Akteure auf europäischer Ebene (EU-Institutionen, Gewerkschaftsverbände, Arbeitgeberverbände)
- Die Herausforderungen und Chancen der europäischen Arbeitsbeziehungen im Kontext der europäischen Integration und Globalisierung
- Die zukünftige Entwicklung der europäischen Arbeitsbeziehungen und die Frage, welche Ebene für Kollektivverhandlungen am geeignetsten ist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der europäischen Arbeitsbeziehungen ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
Das Kapitel „Die vier Ebenen" beschreibt die verschiedenen Ebenen der europäischen Arbeitsbeziehungen im Detail. Es werden die Akteure auf jeder Ebene vorgestellt, die Strukturen der Sozialdialoge und Kollektivverhandlungen erläutert und die jeweiligen Chancen und Herausforderungen beleuchtet.
Das Kapitel „Der Soziale Dialog auf der europäischen Ebene" analysiert den Sozialdialog zwischen den europäischen Gewerkschaftsverbänden (EGB) und den Arbeitgeberverbänden (UNICE und CEEP). Es werden die Geschichte, Struktur und Funktionsweise des Sozialdialogs sowie die bisherige Praxis der Verhandlungen und die damit verbundenen Probleme dargestellt.
Das Kapitel „Der sektorale Soziale Dialog" befasst sich mit dem Sozialdialog auf Branchenebene. Es werden die verschiedenen Formen des sektoralen Sozialdialogs beschrieben, die Akteure und ihre Interessen sowie die bestehenden Probleme und Perspektiven für die Zukunft beleuchtet.
Das Kapitel „Interregionale Dialoge zwischen Intereqionalen Gewerkschaftsräten (IGR) und regionalen Arbeitgeberverbänden" untersucht die Rolle der regionalen Ebene in den europäischen Arbeitsbeziehungen. Es werden die Entstehung und Entwicklung der IGR, ihre Strukturen und Aufgaben sowie die Chancen und Herausforderungen für die Gestaltung von Sozialdialogen und Kollektivverhandlungen auf regionaler Ebene analysiert.
Das Kapitel „Der Dialog zwischen Europäischen Betriebsräten (EBR) und Multinationalen Unternehmen (MNU)" befasst sich mit der betrieblichen Ebene der europäischen Arbeitsbeziehungen. Es werden die Einführung und Funktionsweise der EBR, ihre Rolle im Kontext des Sozialdialogs und der Kollektivverhandlungen sowie die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Arbeitsbeziehungen auf betrieblicher Ebene untersucht.
Das Kapitel „Die vier Ebenen und ihre zukünftigen Entwicklungen" befasst sich mit der Frage, welche Ebene für die Gestaltung von Kollektivverhandlungen am geeignetsten ist. Es werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ebenen analysiert und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten der europäischen Arbeitsbeziehungen im Kontext der europäischen Integration und Globalisierung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die europäischen Arbeitsbeziehungen, den Sozialdialog, die Kollektivverhandlung, die verschiedenen Ebenen der Arbeitsbeziehungen (zentrale, sektorale, interregionale und betriebliche Ebene), die europäischen Institutionen, die Gewerkschaftsverbände (EGB), die Arbeitgeberverbände (UNICE, CEEP), die Europäische Union (EU), die Europäische Integration, die Globalisierung, die Herausforderungen und Chancen der europäischen Arbeitsbeziehungen, die zukünftige Entwicklung der europäischen Arbeitsbeziehungen und die Frage, welche Ebene für Kollektivverhandlungen am geeignetsten ist.
Häufig gestellte Fragen
Welche vier Ebenen der europäischen Arbeitsbeziehungen gibt es?
Es wird zwischen der zentralen, sektoralen, interregionalen und der betrieblichen Ebene unterschieden.
Was ist der Unterschied zwischen Sozialdialog und Kollektivverhandlung?
Der Sozialdialog ist ein Austausch zwischen den Sozialpartnern, während Kollektivverhandlungen auf verbindliche Tarifverträge abzielen.
Wer sind die wichtigsten Akteure auf europäischer Ebene?
Wichtige Akteure sind der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) sowie die Arbeitgeberverbände UNICE (heute BusinessEurope) und CEEP.
Welche Rolle spielen Europäische Betriebsräte (EBR)?
EBR dienen dem Dialog zwischen Arbeitnehmervertretern und dem Management in multinationalen Unternehmen auf betrieblicher Ebene.
Auf welcher Ebene werden zukünftig am ehesten Kollektivverhandlungen erwartet?
Die Arbeit untersucht die Chancen der verschiedenen Ebenen, wobei die sektorale Ebene oft als potenzialreich gilt, aber auch viele Hindernisse bestehen.
- Citation du texte
- Andreas Brand (Auteur), 1999, Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union – Perspektiven von Tarifverhandlungen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134179