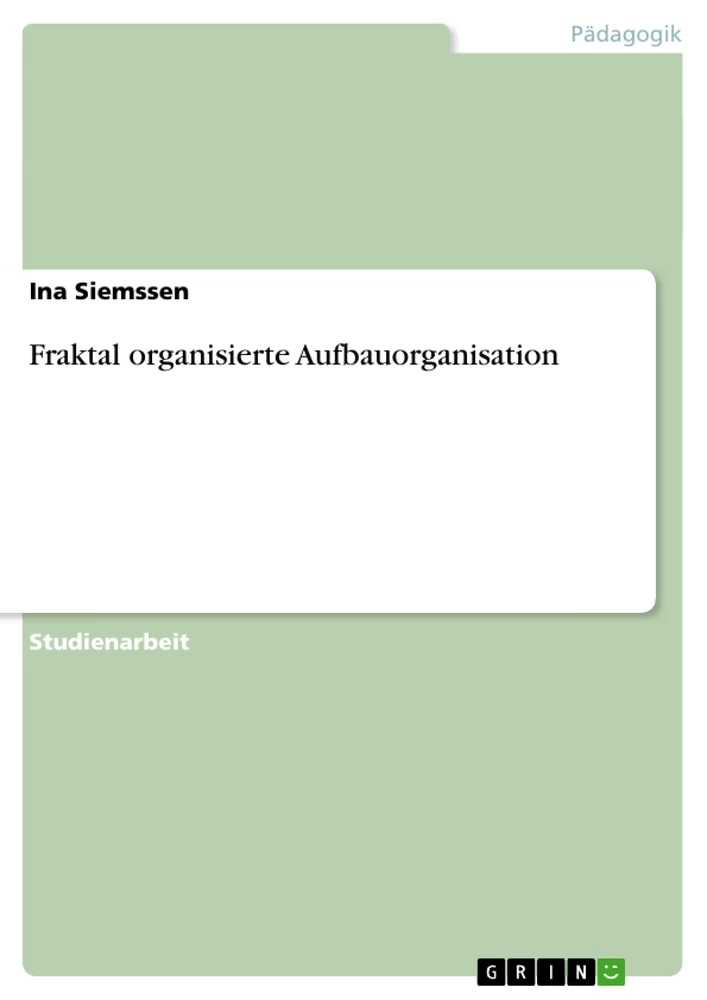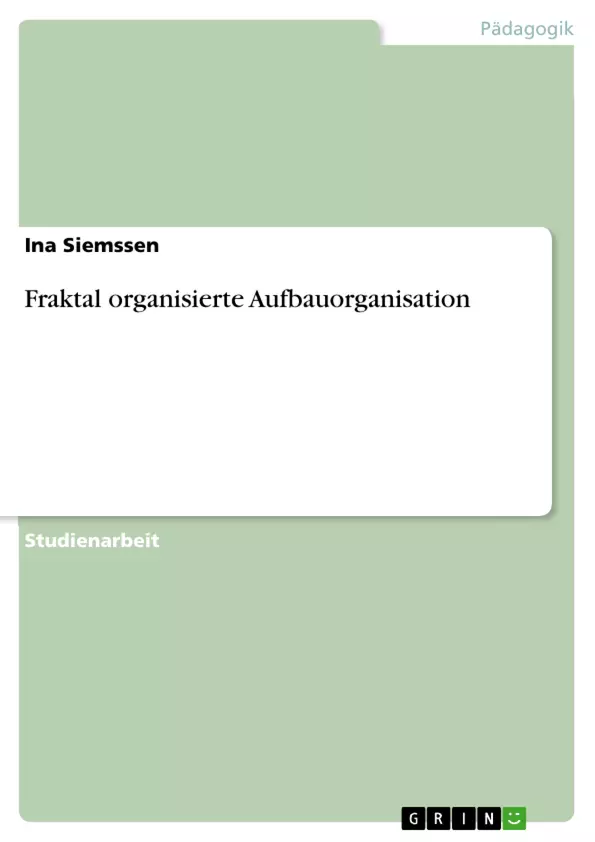Die Anforderungen an Unternehmen und Einrichtungen wachsen stetig in einer Zeit, in der sich Wissen exponentiell vergrößert und deshalb schnell bezüglich seiner Aktualität in Frage gestellt wird.
Neues Wissen, Innovationen und Wettbewerb, wie auch die Berücksichtigung sozial-politischer Modalitäten bedingen dabei Dynamik, die zunächst nicht ohne Weiteres zu durchblicken ist. Sie wird immer komplexer und dadurch immer weniger überschaubar, gestaltbar und steuerbar.
Diese Komplexitätserhöhung, erfordert ein Umdenken darin, wie ein modernes Unternehmen oder eine Einrichtung zu führen ist um wettbewerbsfähig, flexibel und innovativ zu bleiben.
Aus diesen Tatsachen lassen sich Fragen darüber ableiten, wie diese Komplexität zu durchdringen ist, wie sie in einsehbare Strukturen überführt werden kann.
Daraus ergeben sich wieder verschiedene Aufgabenstellungen die zunächst erkannt werden müssen, um schließlich effektiv bearbeitet werden zu können.
Voraussetzungen dafür sind die Qualifikationen der darin eingebundenen Akteure.
Neben fundierten Fachkenntnissen und Kenntnissen in Bereich neuer Technologien von der Marktseite aus, sind überdies auch personale und soziale Kompetenzen, wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Fähigkeit zur Teamarbeit unabdingbar.
Um diese neuen Aufgaben bewältigen und die Ergebnisse auch umsetzen zu können, ist Weiterbildung unerlässlich und bekommt einen immer höheren Stellenwert.
So ist ein Unternehmen als Markt zu verstehen, der einerseits nach diesen Qualifikationen fragt, aber auch als Anbieter von Lehrinhalten zur Erlangung bestimmter Kompetenzen.
Aus dieser Tatsache resultiert ein Anwachsen der Komplexität, die sich insgesamt auf verschiedene Ebenen verteilt.
Um die Strukturen die sich aus allem ergeben anzulegen, sichtbar zu machen und zu organisieren, müssen Aufgaben innerhalb der einzelnen Ebenen sinnvoll ge- und verteilt werden.
In Fraktal organisierte Aufbauorganisationen geschieht das durch „Dezentralisation“ oder „Teambildung“.
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der Fraktalen Aufbauorganisation näher erklärt und seine Relevanz für die Berufsbildenden Schulen am Beispiel einer Schule im Niedersächsischen Schulversuch „ProReKo“ dargestellt.
Im Wesentlichen liegt der folgenden Arbeit das Buch „Die fraktale Fabrik“ von Hans-Jürgen Warnecke, erschienen 1992 im Springer Verlag, zugrunde.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Fraktal organisierte Aufbauorganisation
- 1. Einleitung
- 2. Fraktale Organisation
- 2.1 Definition des Begriffes „Fraktal“
- 2.2 Das Prinzip der Fraktalität als ordnende Einheit
- 2.3 Kriterien einer Fraktalen Organisation
- 3. Fraktale Organisation im Schulversuch „ProReKo“
- 3.1 Relevanz für die Umsetzung der schulischen Selbststeuerung
- 3.2 Kleinsteinflüsse und ihre Bedeutung für die Arbeit in den Teams
- 4. Resümee
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der fraktalen Aufbauorganisation und seine Relevanz für berufsbildende Schulen, insbesondere im Kontext des niedersächsischen Schulversuchs „ProReKo“. Die Zielsetzung besteht darin, das Prinzip der Fraktalität zu erläutern und seine Anwendung in einem praktischen Beispiel darzustellen.
- Definition und Erläuterung des Begriffs „Fraktal“
- Das Prinzip der Selbstähnlichkeit und Ordnung in fraktalen Strukturen
- Die Bedeutung von Kleinsteinflüssen und ihre Auswirkungen auf fraktale Systeme
- Anwendungsbeispiel: Fraktale Organisation im Schulversuch „ProReKo“
- Relevanz für die schulische Selbststeuerung und Teamarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Fraktal organisierte Aufbauorganisation: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den wachsenden Komplexitätsgrad in Unternehmen und Einrichtungen und die Notwendigkeit neuer Organisationsstrukturen, um Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Es stellt die zentralen Fragen nach dem Umgang mit Komplexität und der Entwicklung geeigneter Strukturen und Qualifikationen der Akteure in den Mittelpunkt.
2 Fraktale Organisation: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Fraktal“ und erläutert das Prinzip der Fraktalität als ordnende Einheit. Es beschreibt die Selbstähnlichkeit in fraktalen Strukturen, die sowohl in der Natur als auch in mathematischen Modellen zu finden ist. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bifurkationen und die Auswirkungen von Kleinsteinflüssen auf das Gesamtsystem, unter Bezugnahme auf Beispiele aus der Meteorologie (Schmetterlingseffekt).
3 Fraktale Organisation im Schulversuch „ProReKo“: Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung des Konzepts der fraktalen Organisation im Kontext des Schulversuchs „ProReKo“. Der Fokus liegt auf der Relevanz dieser Organisationsform für die Umsetzung schulischer Selbststeuerung und der Bedeutung von Kleinsteinflüssen für die Teamarbeit. Es werden die Auswirkungen von kleinen Veränderungen auf das Gesamtsystem im schulischen Kontext erörtert.
Schlüsselwörter
Fraktale Organisation, Selbstähnlichkeit, Komplexität, Selbststeuerung, Teamarbeit, Schulversuch ProReKo, Kleinsteinflüsse, Bifurkation, Chaostheorie, Dezentralisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Fraktal organisierte Aufbauorganisation"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff der fraktalen Aufbauorganisation und seine Relevanz für berufsbildende Schulen, insbesondere im Kontext des niedersächsischen Schulversuchs „ProReKo“. Sie erläutert das Prinzip der Fraktalität und zeigt dessen Anwendung in einem praktischen Beispiel.
Was wird unter dem Begriff "Fraktal" verstanden?
Die Arbeit definiert den Begriff „Fraktal“ und erklärt das Prinzip der Fraktalität als ordnende Einheit. Es wird die Selbstähnlichkeit in fraktalen Strukturen beschrieben, die sowohl in der Natur als auch in mathematischen Modellen zu finden ist. Die Bedeutung von Bifurkationen und die Auswirkungen von Kleinsteinflüssen auf das Gesamtsystem werden beleuchtet.
Welche Rolle spielen Kleinsteinflüsse in fraktalen Systemen?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Kleinsteinflüssen und deren Auswirkungen auf fraktale Systeme. Es wird der Einfluss kleiner Veränderungen auf das Gesamtsystem sowohl im theoretischen Kontext (z.B. Schmetterlingseffekt) als auch im praktischen Beispiel des Schulversuchs „ProReKo“ erörtert.
Wie wird das Konzept der Fraktalen Organisation im Schulversuch "ProReKo" angewendet?
Die Arbeit beschreibt die Anwendung des Konzepts der fraktalen Organisation im Schulversuch „ProReKo“. Der Fokus liegt auf der Relevanz dieser Organisationsform für die Umsetzung schulischer Selbststeuerung und die Bedeutung von Kleinsteinflüssen für die Teamarbeit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Fraktale Organisation, Selbstähnlichkeit, Komplexität, Selbststeuerung, Teamarbeit, Schulversuch ProReKo, Kleinsteinflüsse, Bifurkation, Chaostheorie, Dezentralisation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung und stellt die Thematik vor. Kapitel 2 definiert den Begriff „Fraktal“ und erläutert das Prinzip der Fraktalität. Kapitel 3 beschreibt die Anwendung der fraktalen Organisation im Schulversuch „ProReKo“. Zusätzlich gibt es ein Resümee und ein Literaturverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, das Prinzip der Fraktalität zu erläutern und seine Anwendung in einem praktischen Beispiel (dem Schulversuch „ProReKo“) darzustellen. Es geht darum, die Relevanz der fraktalen Organisation für berufsbildende Schulen aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Ina Siemssen (Autor), 2008, Fraktal organisierte Aufbauorganisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134202