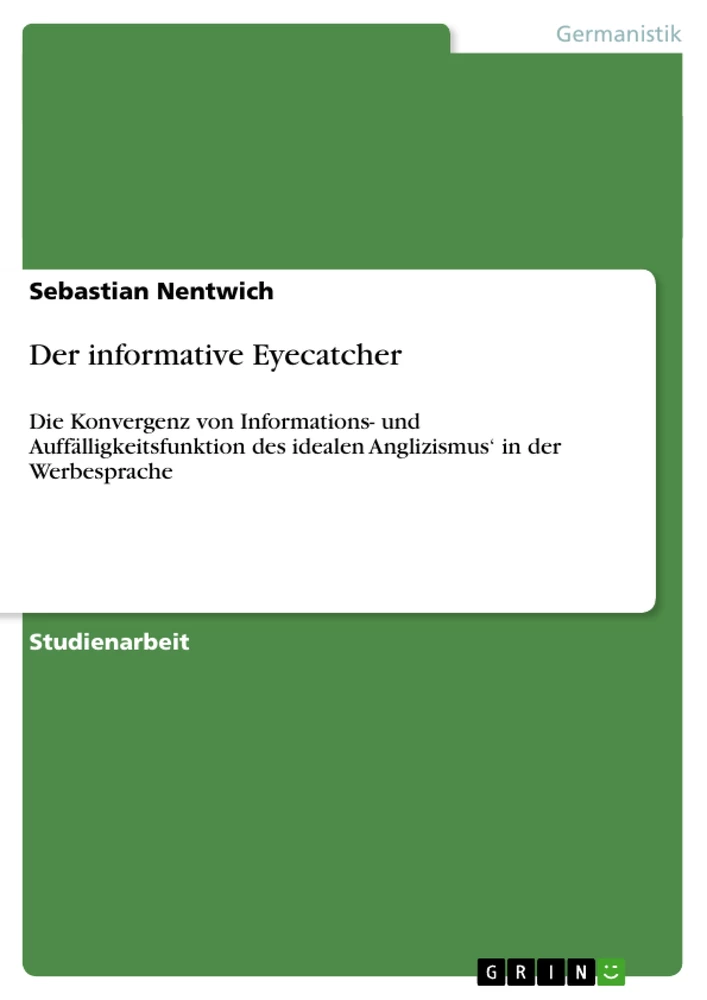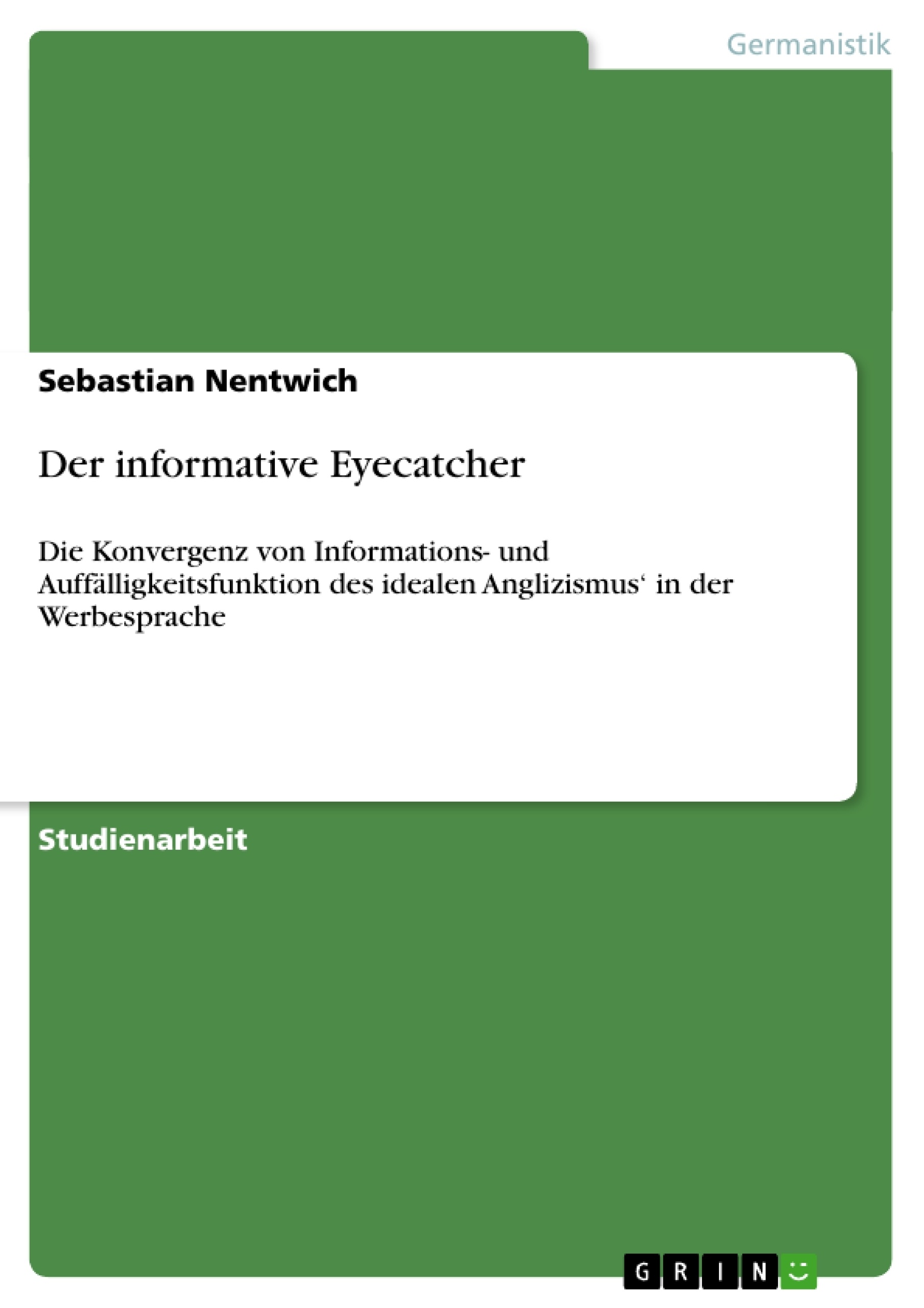Deutschsprachige Konsumenten im 21. Jahrhundert haben es nicht immer leicht, insbesondere jene, welche ihr Kaufverhalten bewusst oder unbewusst dem Einfluss der Werbung unterziehen. Bereits bei der Wahl des Internet- und Telefonbetreibers ergeben sich Schwierigkeiten, da die klassischen Telekommunikationsanschlüsse nur noch als Chiffren in der Werbung existieren: Statt eines Internet- oder Telefonanschlusses des 1&1- oder Telekomkonzerns, bleibt lediglich die Wahl zwischen einer „internet & telefon flat“ im „All-exclusive-Paket“ oder den „Call and Surf Comfort“ bestehen. Anglizismen sind ein beständiger Begleiter der Werbesprache, insbesondere für Slogans und Ökonyme, geworden. Sie sollen durch Auffälligkeit und Innovation den Rezipienten ansprechen - doch wie viel ist ein Anglizismus wert, welcher durch Auffälligkeit besticht, aber keine informationsrelevanten Assoziationen erzeugt?
In der vorliegenden Arbeit wird diskutiert, inwiefern sich Auffälligkeits- und Informationsfunktion von Anglizismen in der Werbesprache gegenseitig beschränken oder ergänzen. Es soll festgesellt werden, ob ein Widerspruch beider Funktionen
existiert und inwieweit dieser vermeintliche Widerspruch umgangen werden kann. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob es einen idealtypischen Anglizismus gibt, welcher beide Funktionen in sich vereint und somit der Werbesprache höchst dienlich sein kann.
Inhalt
1. Einleitung
2. Vorbemerkungen zur Terminologie
3. Anglizismen in der Werbesprache
3.1 Motive zur Anglizismenverwendung
3.2 Funktionen von Anglizismen
3.2.1 Die Auffälligkeitsfunktion
3.2.2 Die Informationsfunktion
4. Der informative Eyecatcher
5. Schluss
6. Bibliografie
1. Einleitung
Deutschsprachige Konsumenten im 21. Jahrhundert haben es nicht immer leicht, insbesondere jene, welche ihr Kaufverhalten bewusst oder unbewusst dem Einfluss der Werbung unterziehen. Bereits bei der Wahl des Internet- und Telefonbetreibers ergeben sich Schwierigkeiten, da die klassischen Telekommunikationsanschlüsse nur noch als Chiffren in der Werbung existieren: Statt eines Internet- oder Telefonanschlusses des 1&1- oder Telekomkonzerns, bleibt lediglich die Wahl zwischen einer „internet & telefon flat“ im „All-exclusive-Paket“ oder den „Call and Surf Comfort“ bestehen. Anglizismen sind ein beständiger Begleiter der Werbesprache, insbesondere für Slogans und Ökonyme, geworden. Sie sollen durch Auffälligkeit und Innovation den Rezipienten ansprechen - doch wie viel ist ein Anglizismus wert, welcher durch Auffälligkeit besticht, aber keine informationsrelevanten Assoziationen erzeugt?
In der vorliegenden Arbeit wird diskutiert, inwiefern sich Auffälligkeits- und Informationsfunktion von Anglizismen in der Werbesprache gegenseitig beschränken oder ergänzen. Es soll festgesellt werden, ob ein Widerspruch beider Funktionen existiert und inwieweit dieser vermeintliche Widerspruch umgangen werden kann. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob es einen idealtypischen Anglizismus gibt, welcher beide Funktionen in sich vereint und somit der Werbesprache höchst dienlich sein kann.
Nach theoretischen Vorüberlegungen, wie dem Terminigebrauch zur Lehnwortproblematik, wird reflektiert, warum explizit Anglizismen in der Werbesprache verwendet werden. Anschließend werden die Auffälligkeits- und die Informationsfunktion, zwei ausgewählte elementare Funktionen von Anglizismen, erörtert. Im weiteren Verlauf wird die Hauptthese der (Un-)vereinbarkeit beider Funktionen empirisch untersucht. Dabei werden Beispiele von Anglizismen aus der Werbesprache stichprobenartig aus dem Internet, diversen Zeitungen, Zeitschriften und Werbeprospekten entnommen. Der Verzicht auf einen eigenen Korpus ist nicht nur in den kleinen Umfang dieser Untersuchung begründet. Der Hauptgrund liegt darin, dass eine Analyse mit stichprobenhaften Material eher die reale Situation des Werberezipienten darstellt, da dieser in den seltensten Fällen tagtäglich mit einem umfassenden Korpus der Werbesprachenanglizismen konfrontiert ist.
2. Vorbemerkungen zur Terminologie
In der Fachliteratur existieren mehrere heterogene Ansichten zum Gebrauch und zur Abgrenzung der Termini Lehn- und Fremdwort. So lehnt POLENZ beispielsweise den Begriff „Fremdwort“ kategorisch ab und bezeichnet ihn als „sprachwissenschaftlich unbrauchbar“1. Dennoch präferiere ich für eine Anglizismenanalyse in der Werbesprache eine Abgrenzung vom Fremd- zum Lehnwort. Diese Abgrenzung ist insoweit sinnvoll, da sie Endpunkte der Integrationsskala anzeigt und dadurch die Termini Fremd- und Lehnwort idealtypisch definiert werden können. Nach BUSSMANN ist das typische Fremdwort „nach Lautung, Schreibung und Flexion (noch) nicht in das Sprachsystem integriert“2. Das Lehnwort hingegen ist ein ursprüngliches Fremdwort, welches nahezu vollständig assimiliert ist3. Trotz der Terminiabgrenzung handelt es sich nicht um konträre Begriffe, da „die Grenze zwischen den beiden Entlehnungsstufen [Fremdwort und Lehnwort, S.N.] fließend“4 ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein Fremdwort mit zunehmender Integration in der Nehmersprache zum Lehnwort wird. Die Skala der Integration lässt sich mit Hilfe von POLENZ auf sechs Sprachebenen feststellen: der phonetischen, graphematischen, flexivischen, wortbildungstechnischen, semantischen und sprachsoziologischen Sprachebene5.
Bei der Entlehnung eines Anglizismus‘ handelt es sich in erster Hinsicht immer um ein Fremdwort. Mit zunehmender Integration innerhalb der sechs Sprachebenen wird der Begriff des Lehnworts für einen Anglizismus immer angebrachter. So ist beispielsweise der Anglizismus „Internet“ aufgrund seiner nahezu vollständigen phonetischen, graphematischen und sprachsoziologischen Assimilation sehr stark in die deutsche Sprache integriert. Weiterführend ist festzuhalten, dass der Integrationsgrad maßgeblich die Erfüllung der Auffälligkeits- und Informationsfunktion von Anglizismen in der Werbesprache bestimmt.
3. Anglizismen in der Werbesprache
3.1 Motive zur Anglizismenverwendung
Dass eine Entlehnung im Bereich der Werbung stärker als ein eigensprachliches Lexem mit einer gewissen Reizwortfunktion korreliert, ist durchaus offensichtlich. Dass Anderes, Fremdes, Ungewohntes und Neues bereits das Prädikat des Auffälligen besitzt, ist eine triviale, aber fundamentale Tatsache. Dennoch ist danach zu fragen, warum hauptsächlich Material der englischen Sprache, statt beispielsweise der französischen oder italienischen Sprache entlehnt wird6.
Die Motivation der Anglizismenverwendung lässt sich mit LAGNER ohne Detaillierungen explizit auf dem Punkt bringen: „Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß ‚the American way of life‘ auf viele Sprachteilhaber eine Faszination ausübt [...]. Englisch ist zweifellos ‚in‘“7. Es ist ersichtlich, dass Fortschritts- und Modernitätsgedanken stets in der Werbung und somit auch in der Werbesprache verankert sind. Dementsprechend ist als Hauptverwendungsgrund anzugeben, dass Entlehnungen aus der englischen Sprache sich bestens in dem Punkt etabliert haben, moderne und innovative Assoziationen beim Rezipienten hervorzurufen. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur die bereits genannten Assoziationen den Anglizismen eigen sind. KUPPER fasst das Assoziationsspektrum sehr prägnant zusammen: Anglizismen besitzen einerseits symbolische, anderseits hedonistische Werte8. Die erstgenannten Werte, aufgelistet von ANDROUTSOPOULOS ET AL., sind vor allem „Fortschritt, Internationalität, Innovation und Weltoffenheit“9. Diese Werte besitzen einen eher objektiven, allgemeinen, sachlichen und überpersonalen Charakter, während die hedonistischen Werte persönliche, subjektive und einzelperspektivische Nuancierungen enthalten: Individualität, Freizeitgenuss, Modernität, Erfolg, Lifestyle und Trendbewusstsein.10 Dieses breite Assoziationsspektrum findet nicht nur hohe Beachtung bei den Werbeproduzenten, sondern motiviert auch die Anglizismenverwendung in der Werbesprache, da diese ein Erfolgsgarant positiver Werbewirksamkeit zu sein scheint.
3.2 Funktionen von Anglizismen
3.2.1 Die Auffälligkeitsfunktion
Werbung soll „die Blicke auf sich ziehen“ oder den Rezipienten „ins Auge stechen“, bevor dieser sich mit dem geworbenen Inhalt auseinandersetzt. In dieser Art und Weise ließe sich eine Maxime für eine zu gestaltende Werbung formulieren: Werbung soll auffallen! Wie bereits im Punkt 3.111 erläutert wurde, ist es eine soziologische und psychologische Tatsache, dass Ungewohntes und Neues immer das Prädikat der Auffälligkeit besitzt. Kombiniert man diesen Sachverhalt mit dem besprochenen positiven Aspekt des breiten Assoziationsspektrums englischsprachiger Entlehnungen, so ergibt sich, dass Anglizismen gewissermaßen prädestiniert sind für die maßgebliche Erfüllung der Auffälligkeitsfunktion in der Werbesprache. JANICH stellt fest, dass besonders in Slogans und Schlagzeilen „Anglizismen statt einer solchen Bezeichnungs- oder Darstellungsfunktion [wie in Fließtexten] eher den Zweck [haben], Modernität und Internationalität zu demonstrieren und überraschend zu wirken.“12 Für diesen Überraschungseffekt kann jedoch nicht der Anglizismus garantieren. Die Integration eines Anglizismus‘ in den eigensprachlichen Wortschatz verhält sich umgekehrt proportional zu dem Sinn und Zweck des Auffallens und Überraschens: Mit der zunehmenden Integration ergibt sich eine abfallende Auffälligkeit beziehungsweise eine Unreizbarkeit und Gleichgültigkeit des Rezipienten gegenüber den Anglizismus. Der Übergang des Fremden zum Eigenen ist auch gewissermaßen der zunehmende Verlust des Auffälligkeitsmerkmals. In dieser Hinsicht zieht KUPPER folgendes Fazit:
„Wären die vorkommenden Anglizismen integriert, würden diese (vermutlich) ihre erhoffte Wirkung nicht erzielen können, da der „Überraschungseffekt“, der normalerweise durch die Neuartigkeit des verwendeten Anglizismus die Aufmerksamkeit der Rezipienten erhöhen soll, gemindert werden würde.“13
[...]
1 Polenz (1991:47)
2 Bußmann (2002:226)
3 vgl. Bußmann (2002:398)
4 vgl. Bußmann (2002:226 f.)
5 Polenz (1991:45 f.)
6 Dabei ist die Werbesprache im allgemeinen Sinne gemeint. Auf Einzelbereiche, wie die Parfümwerbung, wird nicht eingegangen, da sich bei dieser speziell ein hoher Entlehungsgrad französischen Materials vermuten lässt.
7 Lagner (1995:41)
8 Kupper (2007:267)
9 Androutsopoulos et al. (2004:3)
10 vgl. Schütte (1996:357)
11 siehe 3.1 Motive zur Anglizismenverwendung
12 Janich (1999:107, Hinzufügung S.N.)
13 Kupper (2007:268)
- Citar trabajo
- Sebastian Nentwich (Autor), 2009, Der informative Eyecatcher, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134762