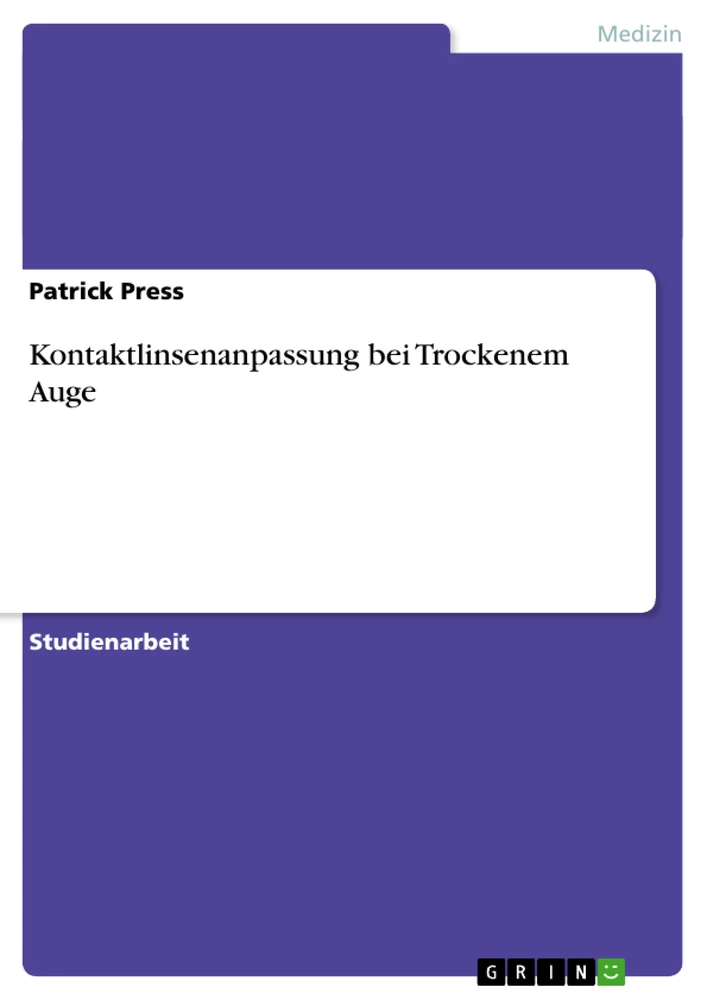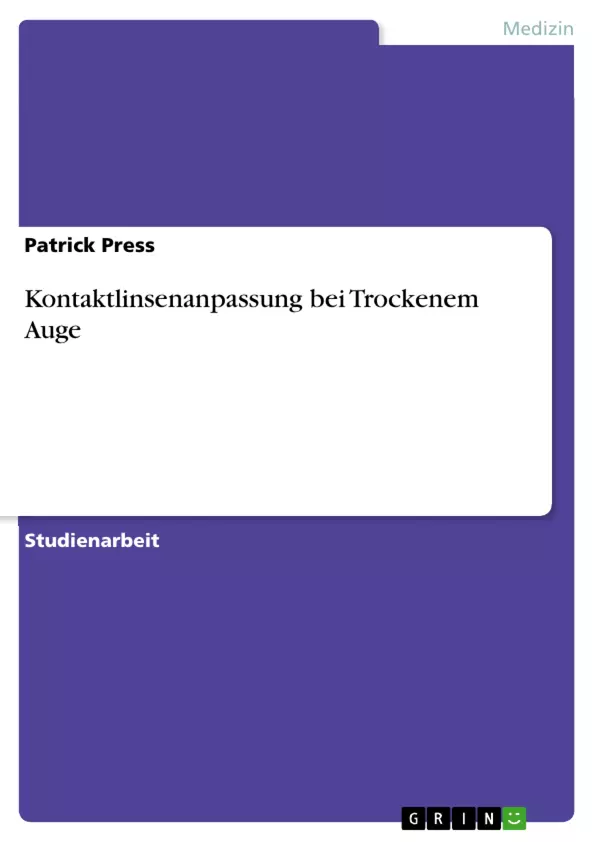Um Kontaktlinsen beschwerdefrei tragen zu können, müssen das Auge gesund und der Tränenfilm intakt sein. Jedes Jahr beenden jedoch fünf bis zehn Prozent aller Kontaktlinsenträger das Tragen von Kontaktlinsen. Begley et al. stellten anhand der Auswertung von Symptom-Fragebögen fest, dass ca. 50% der Kontaktlinsenträger unter Symptomen eines Trockenen Auges leiden. Eine weitere Versorgung dieser Risikogruppe mit Kontaktlinsen, die auf das weitere Tragen der Kontaktlinsen unter Umständen ganz verzichten könnte, war in der Vergangenheit schwierig. An eine Versorgung von Kunden, die bereits unter einem Trockenen Auge leiden, war bisher erst recht nicht zu denken. Heutzutage kann der Augenarzt bzw. Kontaktlinsenanpasser jedoch „mit einer individuellen Strategie, speziell auf das Auge und die Art der Störung abgestimmt,“ diesen Kunden helfen. Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, inwiefern eine Kontaktlinsenversorgung bei Trockenem Auge möglich ist, wie sie durchgeführt wird und welche Kontaktlinsenmaterialien geeignet sind. Außerdem wird zum besseren Verständnis das Krankheitsbild des Trockenen Auges mit seinen vielfältigen Ursachen und Symptomen beschrieben, Diagnoseverfahren genannt und Therapieansätze aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2 Das Trockene Auge
- 2.1 Definition
- 2.2 Symptome
- 2.3 Epidemiologie
- 2.4 Ätiopathogene Klassifikation des Trockenen Auges
- 2.5 Dry Eye/CLIDE
- 2.6 Pathogenese des Trockenen Auges durch das Kontaktlinsentragen
- 2.6.1 Beeinflussung des Tränenfilms durch das Kontaktlinsentragen
- 2.6.2 Einflussfaktoren auf das Trockene Auge
- 3 Diagnostik
- 3.1 Anamnese
- 3.2 Objektive Messverfahren zur Diagnostik des Trockenen Auges
- 3.2.1 Untersuchung mit der Spaltlampe
- 3.2.2 Tränenfilmaufreißzeit (FBUT)
- 3.2.3 Nichtinvasive Tränenfilmaufreißzeit (NIBUT)
- 3.2.4 Schirmer-Test
- 3.2.5 Vitalfärbungen mit Fluoreszein und Lissamingrün
- 3.2.6 Lidkantenparalle Conjunctivalfalten (LIPCOF)
- 3.2.7 Farnkrauttest
- 4 Therapie
- 4.1 Etablierte Therapien
- 4.1.1 Entzündungshemmende Medikamente
- 4.1.2 Nachbenetzungslösungen
- 4.1.3 Verschluss des Tränenpünktchens
- 4.1.4 Therapeutische Kontaktlinsen
- 4.1.5 Feuchtigkeitserhaltende Brillen
- 4.2 Alternative und zukünftige Therapien
- 4.2.1 Eigenserumtherapie
- 4.2.2 Androgene
- 4.2.3 Sekretagogika
- 4.2.4 Cholinergika
- 5 Kontaktlinsenanpassung bei Trockenem Auge
- 5.1 Anpassung formstabiler Kontaktlinsen
- 5.2 Anpassung weicher Kontaktlinsen
- 5.3 Auswahl des Kontaktlinsenmaterials
- 5.4 Ablagerungen auf Kontaktlinsen
- 5.5 Kontaktlinsenpflegemittel bei Trockenem Auge
- 5.6 Tragezeiten
- 5.7 Lidschlagverhalten
- 5.8 Lidhygiene
- 5.9 Ernährung
- 5.10 Flussdiagramm für die Anpassung von Kontaktlinsen bei Trockenem Auge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Kontaktlinsenversorgung bei Patienten mit trockenem Auge. Ziel ist es, geeignete Verfahren und Materialien zu identifizieren und das Krankheitsbild des trockenen Auges umfassend zu beschreiben. Die Arbeit beleuchtet Diagnosemethoden und Therapieansätze.
- Das Krankheitsbild des trockenen Auges: Definition, Symptome und Ursachen
- Diagnosemethoden für trockenes Auge
- Therapieoptionen für trockenes Auge
- Anpassung von Kontaktlinsen bei trockenem Auge
- Geeignete Kontaktlinsenmaterialien und Pflegemittel
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Kontaktlinsenanpassung bei trockenem Auge ein. Es wird die Problematik des hohen Anteils an Kontaktlinsenträgern mit trockenem Auge aufgezeigt und die Schwierigkeit der bisherigen Versorgung dieser Patientengruppe beschrieben. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Möglichkeiten einer erfolgreichen Kontaktlinsenversorgung trotz trockenem Auge aufzuzeigen.
2 Das Trockene Auge: Dieses Kapitel definiert das trockene Auge, beschreibt seine Symptome und Epidemiologie. Es erläutert die ätiopathogene Klassifikation, differenziert zwischen kontaktlinseninduziertem und nicht-kontaktlinseninduziertem trockenem Auge und beschreibt detailliert die Pathogenese des durch Kontaktlinsen verursachten trockenen Auges. Die Beeinflussung des Tränenfilms durch Kontaktlinsen und diverse Einflussfaktoren auf das Auftreten von trockenem Auge werden ausführlich behandelt.
3 Diagnostik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen diagnostischen Verfahren zur Erkennung von trockenem Auge. Es werden sowohl die Anamnese als auch objektive Messverfahren wie die Spaltlampenuntersuchung, die Bestimmung der Tränenfilmaufreißzeit (FBUT und NIBUT), der Schirmer-Test, Vitalfärbungen und die Beurteilung von Lidkantenparalle Conjunctivalfalten (LIPCOF) sowie der Farnkrauttest detailliert beschrieben und ihre Bedeutung im diagnostischen Prozess erklärt.
4 Therapie: Dieses Kapitel befasst sich mit etablierten und alternativen Therapieansätzen für das trockene Auge. Etablierte Therapien wie entzündungshemmende Medikamente, Nachbenetzungslösungen, Verschluss des Tränenpünktchens, therapeutische Kontaktlinsen und feuchtigkeitserhaltende Brillen werden erklärt. Darüber hinaus werden alternative und zukünftige Therapien wie die Eigenserumtherapie, die Anwendung von Androgenen, Sekretagogika und Cholinergika vorgestellt und diskutiert.
5 Kontaktlinsenanpassung bei Trockenem Auge: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anpassung von Kontaktlinsen bei Patienten mit trockenem Auge. Es beschreibt die Besonderheiten bei der Anpassung von formstabilen und weichen Kontaktlinsen, die Auswahl geeigneter Materialien, Maßnahmen zur Vermeidung von Ablagerungen, die Auswahl geeigneter Pflegemittel, die Festlegung optimaler Tragezeiten sowie die Bedeutung des Lidschlags, der Lidhygiene und der Ernährung. Ein Flussdiagramm veranschaulicht die einzelnen Schritte der Anpassung.
Schlüsselwörter
Trockene Auge, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenanpassung, Tränenfilm, Diagnostik, Therapie, Kontaktlinsenmaterialien, Pflegemittel, Pathogenese, Epidemiologie, Anamnese, Spaltlampe, Tränenfilmaufreißzeit (FBUT, NIBUT), Schirmer-Test, Vitalfärbung, LIPCOF.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Kontaktlinsenanpassung bei trockenem Auge"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Kontaktlinsenanpassung bei Patienten mit trockenem Auge. Sie untersucht geeignete Verfahren und Materialien und beschreibt das Krankheitsbild des trockenen Auges detailliert, inklusive Diagnosemethoden und Therapieansätzen.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Identifizierung geeigneter Verfahren und Materialien für die Kontaktlinsenversorgung bei Patienten mit trockenem Auge. Weiterhin soll das Krankheitsbild des trockenen Auges umfassend beschrieben werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Krankheitsbild des trockenen Auges (Definition, Symptome, Ursachen), Diagnosemethoden für trockenes Auge, Therapieoptionen für trockenes Auge, Anpassung von Kontaktlinsen bei trockenem Auge und geeignete Kontaktlinsenmaterialien und Pflegemittel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Das Trockene Auge, Diagnostik, Therapie und Kontaktlinsenanpassung bei Trockenem Auge. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Was wird im Kapitel "Das Trockene Auge" behandelt?
Dieses Kapitel definiert das trockene Auge, beschreibt seine Symptome und Epidemiologie. Es erläutert die ätiopathogene Klassifikation, differenziert zwischen kontaktlinseninduziertem und nicht-kontaktlinseninduziertem trockenem Auge und beschreibt detailliert die Pathogenese des durch Kontaktlinsen verursachten trockenen Auges. Die Beeinflussung des Tränenfilms durch Kontaktlinsen und diverse Einflussfaktoren werden ausführlich behandelt.
Welche Diagnosemethoden werden beschrieben?
Das Kapitel "Diagnostik" beschreibt verschiedene Verfahren zur Erkennung von trockenem Auge, darunter Anamnese, Spaltlampenuntersuchung, Bestimmung der Tränenfilmaufreißzeit (FBUT und NIBUT), Schirmer-Test, Vitalfärbungen, Beurteilung von LIPCOF und der Farnkrauttest.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Das Kapitel "Therapie" behandelt etablierte Therapien (entzündungshemmende Medikamente, Nachbenetzungslösungen, Tränenpünktchenverschluss, therapeutische Kontaktlinsen, feuchtigkeitserhaltende Brillen) und alternative/zukünftige Therapien (Eigenserumtherapie, Androgene, Sekretagogika, Cholinergika).
Wie wird die Kontaktlinsenanpassung bei trockenem Auge beschrieben?
Das Kapitel "Kontaktlinsenanpassung bei Trockenem Auge" beschreibt die Anpassung von formstabilen und weichen Kontaktlinsen, die Auswahl geeigneter Materialien und Pflegemittel, optimale Tragezeiten, die Bedeutung von Lidschlag, Lidhygiene und Ernährung. Ein Flussdiagramm veranschaulicht die Anpassungsschritte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Trockene Auge, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenanpassung, Tränenfilm, Diagnostik, Therapie, Kontaktlinsenmaterialien, Pflegemittel, Pathogenese, Epidemiologie, Anamnese, Spaltlampe, Tränenfilmaufreißzeit (FBUT, NIBUT), Schirmer-Test, Vitalfärbung, LIPCOF.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bieten eine Zusammenfassung der Arbeit. Für detaillierte Informationen wird auf den vollständigen Text verwiesen.
- Citation du texte
- Diplomkaufmann (MBA) Patrick Press (Auteur), 2009, Kontaktlinsenanpassung bei Trockenem Auge , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135066