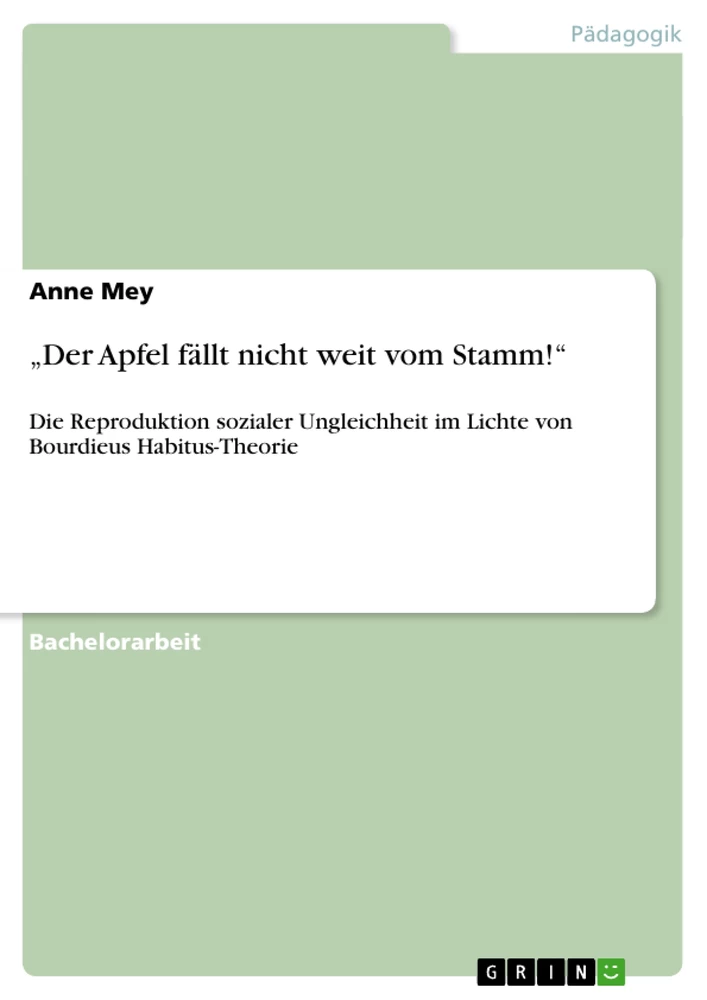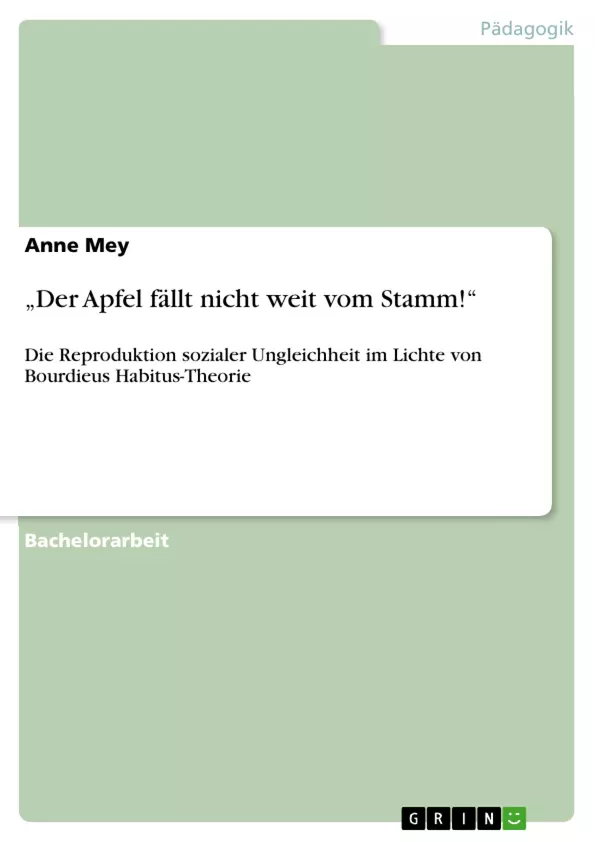Pierre Félix Bourdieu wurde am 1. August 1930 in Denguin geboren und starb am 23. Januar 2002 in Paris. Er war ein französischer Philosoph und Soziologe. Eines seiner Hauptwerke ist das Buch „Die feinen Unterschiede“ aus dem Jahre 1979. In diesem Werk bezeichnet er die französische Gesellschaft als Klassengesellschaft und macht klar, dass dies auch für alle anderen westlichen Industriegesellschaften der Fall ist. Im Grunde ist Bourdieus Theorie „eine Weiterführung der Theorien sozialer Ungleichheit“.
Wäre das gesellschaftliche Leben mit einem Glücksspiel vergleichbar, so hätte jeder Mensch jederzeit die Chance, einen neuen, höheren Status innerhalb kürzester Zeit zu erlangen. Oder anders gesagt, es bestünde auch immer die Gefahr, von einem sehr hohen Status in einen sehr niedrigen zu fallen. Das Glücksspiel ist zufällig und absolut unabhängig von der Vergangenheit, ein Paradebeispiel an Chancengleichheit. Keiner hätte einen Vorteil durch seine Eltern und ihre Arbeit, ebenso wenig hätte keiner einen Nachteil aus seiner Herkunft zu befürchten. Dies ist aber in unserer Gesellschaft nicht der Fall.
PISA und andere Studien zeigen, dass in Deutschland keine Chancengleichheit, sondern soziale Ungleichheit herrscht. Bourdieu hat mit seiner Theorie die Mechanismen der Reproduktion von sozialer Ungleichheit aufgedeckt. Daher wird diese Arbeit zunächst seine Habitus-Theorie aufgreifen und die wesentlichen Begriffe erklären. Was ist die Kapitaltheorie? Wie äußert sich der Habitus und was sind die verschiedenen Geschmäcker, die Bourdieu beschreibt? Diese Fragen werden in den Mittelpunkt des größeren, theoretischen Teils gerückt. Als Einstieg dient zunächst eine kurze Explikation des Begriffes „soziale Ungleichheit“. Im zweiten Teil soll Bezug auf die aktuelle Lage in Deutschland und die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem genommen werden. Im Mittelpunkt werden dabei die Bildungsexpansion und ihre Folgen für die Reproduktionsmechanismen, der durch das Elternhaus bestimmte Schul- und Universitätserfolg und die Einflussnahme des Habitus bei der Vergabe von Spitzenpositionen im Beruf stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was verbirgt sich hinter dem Begriff „soziale Ungleichheit“? – Begriffsexplikation
- 3 Die Kapitaltheorie
- 3.1 Ökonomisches Kapital
- 3.2 Kulturelles Kapital
- 3.2.1 Inkorporiertes Kulturkapital
- 3.2.2 Objektiviertes Kulturkapital
- 3.2.3 Institutionalisiertes Kulturkapital
- 3.3 Soziales Kapital
- 3.4 Symbolisches Kapital
- 3.5 Transformation des Kapitals
- 4 Habitus, Klassen und Geschmack
- 4.1 Der Habitus
- 4.2 Die Geschmackssorten
- 4.2.1 Der legitime Geschmack
- 4.2.2 Der mittlere Geschmack
- 4.2.3 Der populäre Geschmack
- 5 Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem
- 5.1 Die Bildungsexpansion - Weg zur Chancengleichheit!?
- 5.1.1 Überblick der Bildungsexpansion
- 5.1.2 Fazit der Bildungsexpansion: Veränderte Reproduktionsstrategien
- 5.2 Pisa und Co. Oder wie der Habitus die Schulkarriere bestimmt
- 5.3 Die Erben - Studenten und der Habitus
- 5.4 Der Habitus als Karrierekiller: Wer die Wahl hat…..Nimmt den, der ihm am ähnlichsten ist!
- 5.1 Die Bildungsexpansion - Weg zur Chancengleichheit!?
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Kontext von Bourdieus Habitus-Theorie. Sie zielt darauf ab, die zentralen Konzepte Bourdieus zu erläutern und deren Relevanz für das deutsche Bildungssystem aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie soziale Ungleichheit durch Bildungsprozesse reproduziert wird und welche Rolle der Habitus dabei spielt.
- Begriffserklärung „Soziale Ungleichheit“ und Bourdieus Kapitaltheorie
- Der Habitus als zentraler Begriff und seine Auswirkungen auf Geschmack und Lebensführung
- Die Rolle des Bildungssystems in der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Der Einfluss der Bildungsexpansion auf Reproduktionsmechanismen
- Die Auswirkungen des Habitus auf die Schul- und Universitätskarriere sowie beruflichen Erfolg
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt die zentralen Fragestellungen vor. Sie benennt Pierre Bourdieu als zentralen Bezugspunkt und sein Werk „Die feinen Unterschiede“ als Grundlage der Analyse. Es wird die These aufgestellt, dass soziale Ungleichheit nicht zufällig verteilt ist, sondern durch bestimmte Mechanismen reproduziert wird, die Bourdieu aufgedeckt hat. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der die Kapitaltheorie und den Habitus erläutert, und einen empirischen Teil, der die Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem analysiert.
2 Was verbirgt sich hinter dem Begriff „soziale Ungleichheit“? - Begriffsexplikation: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von sozialer Ungleichheit. Es wird zwischen absoluter und relativer Ungleichheit unterschieden und erläutert, dass soziale Ungleichheit die ungleiche Verteilung wertvoller Güter in einer Gesellschaft impliziert. Der Fokus liegt dabei auf regelmäßig auftretenden Ungleichheiten, die mit bestimmten Positionen in gesellschaftlichen Strukturen verbunden sind, wie beispielsweise Einkommens- und Machtunterschiede. Das Kapitel betont, dass soziale Ungleichheit nicht automatisch mit Ungerechtigkeit gleichgesetzt werden muss.
3 Die Kapitaltheorie: Dieses Kapitel beschreibt Bourdieus Kapitaltheorie. Es werden die verschiedenen Kapitalarten – ökonomisches, kulturelles (inkorporiert, objektiviert, institutionalisiert), und soziales Kapital – detailliert erläutert und ihre Interdependenzen aufgezeigt. Der Abschnitt verdeutlicht, wie diese verschiedenen Kapitalformen ineinander übergehen und sich gegenseitig beeinflussen können. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis des Habitus, indem es die Ressourcen aufzeigt, die diesen prägen.
4 Habitus, Klassen und Geschmack: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den zentralen Begriff des Habitus in Bourdieus Theorie. Der Habitus wird als ein System von Dispositionen beschrieben, welches das Denken, Handeln und Fühlen prägt und durch die Sozialisation erworben wird. Es wird gezeigt, wie der Habitus die Wahrnehmung und den Geschmack beeinflusst und sich in unterschiedlichen „Geschmackssorten“ (legitimer, mittlerer, populärer Geschmack) manifestiert. Diese Geschmäcker sind eng mit den verschiedenen Kapitalformen verbunden und spiegeln die soziale Position wider.
5 Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem: Dieses Kapitel analysiert, wie das Bildungssystem zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beiträgt. Es untersucht die Bildungsexpansion und ihre Auswirkungen auf die Reproduktionsmechanismen. Der Einfluss von PISA-Studien und die Rolle des Habitus bei der Wahl von Bildungswegen und der Erlangung von Spitzenpositionen im Beruf werden untersucht. Die Kapitel analysiert, wie der Habitus die Schulkarriere und letztendlich den beruflichen Erfolg beeinflusst und Ungleichheiten fortbestehen lässt.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bourdieu, Habitus, Kapitaltheorie (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital), Geschmack, Bildungssystem, Bildungsexpansion, Reproduktion sozialer Ungleichheit, Chancengleichheit, PISA.
Häufig gestellte Fragen zu: Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem im Kontext von Pierre Bourdieus Habitus-Theorie. Sie erläutert Bourdieus zentrale Konzepte und deren Relevanz für das deutsche Bildungssystem. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse, wie soziale Ungleichheit durch Bildungsprozesse reproduziert wird und welche Rolle der Habitus dabei spielt.
Welche zentralen Konzepte von Bourdieu werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Bourdieus Kapitaltheorie (ökonomisches, kulturelles – inkorporiert, objektiviert, institutionalisiert – und soziales Kapital) und den Begriff des Habitus ausführlich. Es wird gezeigt, wie verschiedene Kapitalformen ineinander übergehen und den Habitus prägen. Der Habitus wird als System von Dispositionen beschrieben, welches Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst und sich in unterschiedlichen Geschmackssorten (legitimer, mittlerer, populärer Geschmack) manifestiert.
Wie wird soziale Ungleichheit definiert?
Soziale Ungleichheit wird als ungleiche Verteilung wertvoller Güter in einer Gesellschaft definiert. Es wird zwischen absoluter und relativer Ungleichheit unterschieden. Der Fokus liegt auf regelmäßig auftretenden Ungleichheiten, die mit bestimmten Positionen in gesellschaftlichen Strukturen verbunden sind (z.B. Einkommens- und Machtunterschiede).
Welche Rolle spielt das Bildungssystem in der Reproduktion sozialer Ungleichheit?
Die Arbeit analysiert, wie das Bildungssystem zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beiträgt. Die Bildungsexpansion und ihre Auswirkungen auf Reproduktionsmechanismen werden untersucht. Es wird der Einfluss von PISA-Studien und die Rolle des Habitus bei der Wahl von Bildungswegen und der Erlangung von Spitzenpositionen im Beruf beleuchtet. Der Habitus wird als ein Faktor identifiziert, der die Schulkarriere und den beruflichen Erfolg beeinflusst und Ungleichheiten fortbestehen lässt.
Welche Auswirkungen hat der Habitus auf den Bildungsverlauf und den beruflichen Erfolg?
Der Habitus beeinflusst die Wahrnehmung, den Geschmack und die Entscheidungen im Bildungsverlauf (Schulwahl, Studienwahl). Er prägt die Strategien zur Erlangung von Kapital und wirkt sich somit auf die berufliche Karriere und den Erfolg aus. Die Arbeit argumentiert, dass der Habitus dazu beiträgt, dass ähnliche Menschen ähnliche Positionen besetzen, was die Reproduktion sozialer Ungleichheit verstärkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsexplikation „Soziale Ungleichheit“, Bourdieus Kapitaltheorie, Habitus, Klassen und Geschmack, Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem, Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Thematik, beginnend mit der Definition sozialer Ungleichheit und der Vorstellung von Bourdieus Theorie, bis hin zur Analyse der Rolle des Bildungssystems in der Reproduktion von Ungleichheit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Bourdieu, Habitus, Kapitaltheorie (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital), Geschmack, Bildungssystem, Bildungsexpansion, Reproduktion sozialer Ungleichheit, Chancengleichheit, PISA.
- Quote paper
- Anne Mey (Author), 2009, „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135111