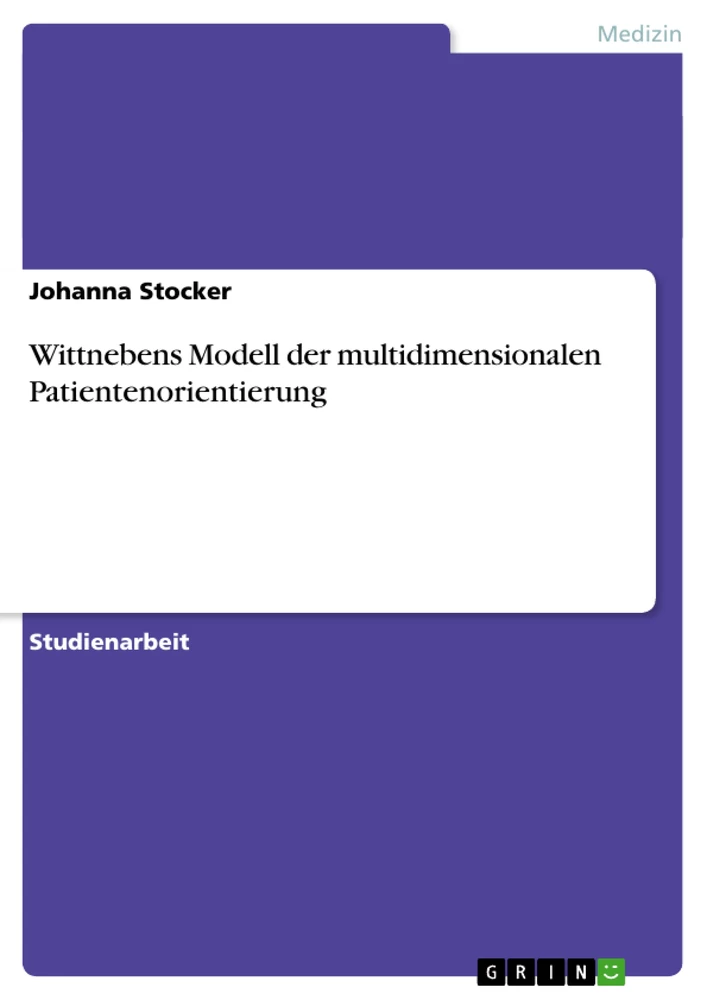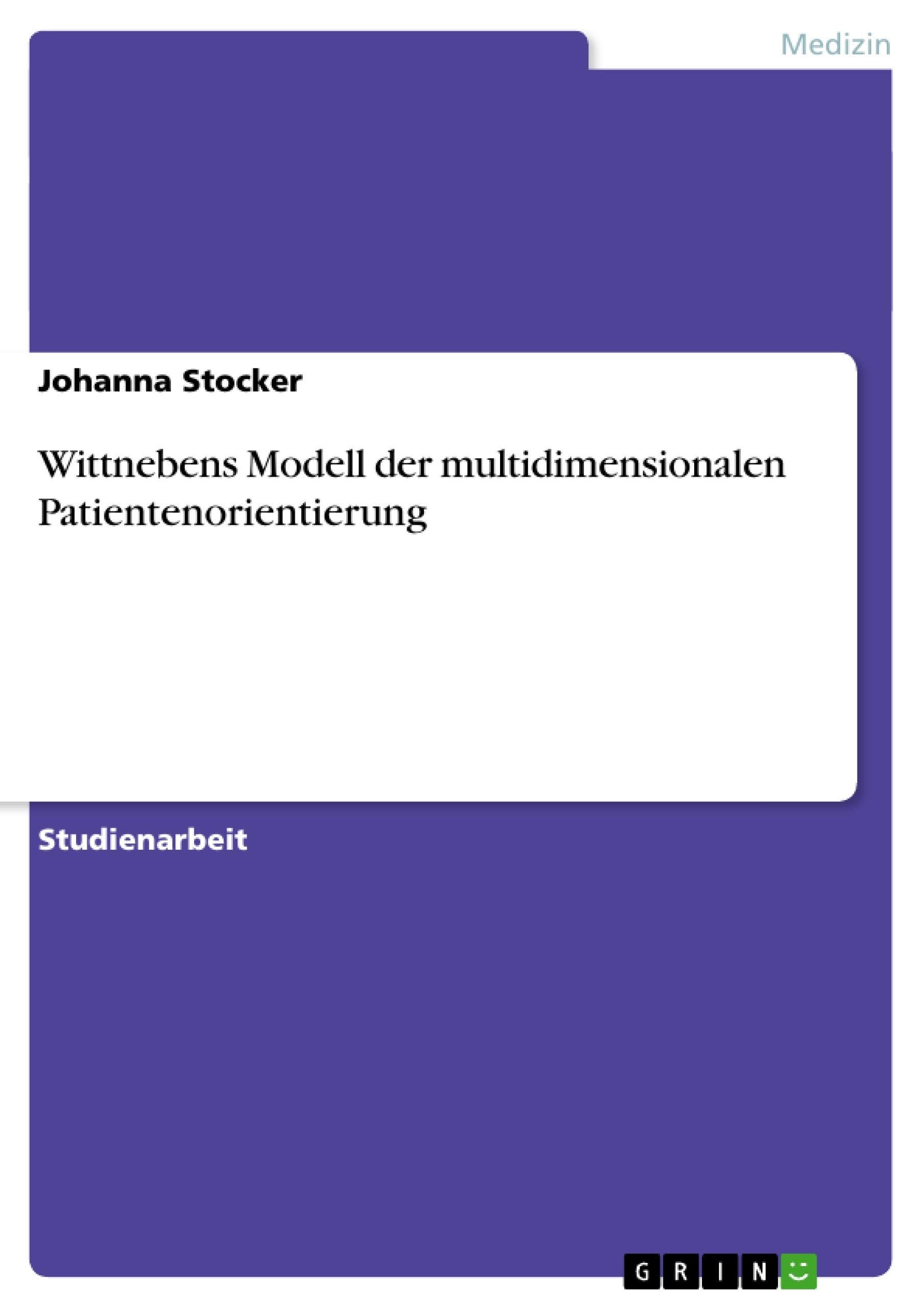Die Pflege in heutiger Zeit wird häufig auf Grund der Problemstellungen des Personalmangels,
der Arbeitsüberlastung und einer nicht angemessenen Vergütung diskutiert.
Weitere Mängel wie eine unzureichende Aus- und Weiterbildung stehen nur selten im
Fokus der Öffentlichkeit. Um diesen Unzulänglichkeiten entgegenzuwirken, sind Modelle
notwendig, welche sich intensiv mit dieser Problematik auseinandersetzen und entsprechende
Maßnahmen stützen können. Die Mehrzahl der Pflegemodelle und
-theorien stammt aus den Vereinigten Staaten. Infolge der verspäteten Etablierung der
Pflegewissenschaft in Deutschland weist die deutschsprachige Theoriebildung einen im
internationalen Vergleich noch geringen Stellenwert auf. Dennoch gibt es in Deutschland
einige bedeutsamen Pflegemodelle. Einen hohen Bekanntheitsgrad hat das von
Karin Wittneben in ihrer 1991 veröffentlichten Dissertation entwickelte Modell der multidimensionalen
Patientenorientierung erlangt.
Vor diesem Hintergrund soll dem interessierten Leser ein Einblick in das Stufenmodell
der multidimensionalen Patientenorientierung gewährt werden. Er soll deren Aufbau sowie
den Bezug zur Pflegedidaktik erkennen. Die Zielsetzung besteht zudem darin, Anwendungsmöglichkeiten
für die Umsetzung in der Praxis zu schaffen. Durch kritische
Ansätze im weiteren Verlauf der Arbeit möchte die Verfasserin aufzeigen, dass es keinesfalls
ein standardisiertes Modell für die Anwendung in der Praxis gibt. Vielmehr soll
deutlich gemacht werden, dass eine individuelle Anpassung an die jeweilige Situation
und zeitlich bedingte Veränderungen notwendig sind.
Um dies zu erreichen, beschreibt der erste Teil der Arbeit zunächst den Lebensweg
Wittnebens und die Entwicklung des Modells. Im weiteren Verlauf werden dann
Schwerpunkte sowie die einzelnen Ebenen dargelegt. Nach diesem Überblick werden
pflegedidaktische Ansätze vorgestellt, um so das Verständnis von Patientenorientierung
bestmöglich zu vermitteln. Der Fokus liegt hierbei zum einen auf der Patientenorientierung
und zum anderen auf der schülerorientierten Umsetzungsstrategie in der Ausbildung.
Das Verständnis des Menschenbildes nach Wittneben sowie das Ordnungsmuster
der verschiedenen Stufen bilden den Hauptansatz der kritischen Betrachtung. Das
abschließende Resümee bietet dem Leser Denkanstöße sowie einen kurzen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Biographischer Hintergrund Wittnebens und Ursprünge des Modells
3 Modell multidimensionaler Patientenorientierung
3.1 Schwerpunkte und besondere Ansätze des Modells
3.2 Deskription des Modells
3.2.1 Der Begriff "Patientenorientierung"
3.2.2 Ablauforientierung
3.2.3 Verrichtungsorientierung
3.2.4 Symptomorientierung
3.2.5 Krankheitsorientierung
3.2.6 Verhaltensorientierung
3.2.7 Handlungsorientierung
3.2.8 Kommunikations- und Interaktionsorientierung
4 Vermittlung von Patientenorientierung in der theoretischen Ausbildung
4.1 Pflegedidaktische Ansätze
4.2 Pflegedidaktik in Anlehnung an Klafki
4.3 Erforderliche Kompetenzen und Schülerorientierung
4.4 Schwerpunktsetzung in der theoretischen Ausbildung
5 Kritische Ansätze
5.1 Das Menschenbild nach Wittneben
5.2 Stufenaufbau des Modells
6 Schlussbetrachtung
Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ursprüngliches heuristisches Modell der multidimensionalen Patientenorientierung.
Abbildung 2: Modifiziertes Modell der multidimensionalen Patientenorientierung.
1 Einleitung
Die Pflege in heutiger Zeit wird häufig auf Grund der Problemstellungen des Personal-mangels, der Arbeitsüberlastung und einer nicht angemessenen Vergütung diskutiert. Weitere Mängel wie eine unzureichende Aus- und Weiterbildung stehen nur selten im Fokus der Öffentlichkeit. Um diesen Unzulänglichkeiten entgegenzuwirken, sind Model-le notwendig, welche sich intensiv mit dieser Problematik auseinandersetzen und ent-sprechende Maßnahmen stützen können. Die Mehrzahl der Pflegemodelle und -theorien stammt aus den Vereinigten Staaten. Infolge der verspäteten Etablierung der Pflegewissenschaft in Deutschland weist die deutschsprachige Theoriebildung einen im internationalen Vergleich noch geringen Stellenwert auf. Dennoch gibt es in Deutschland einige bedeutsamen Pflegemodelle. Einen hohen Bekanntheitsgrad hat das von Karin Wittneben in ihrer 1991 veröffentlichten Dissertation entwickelte Modell der multi-dimensionalen Patientenorientierung erlangt. Vor diesem Hintergrund soll dem interessierten Leser ein Einblick in das Stufenmodell der multidimensionalen Patientenorientierung gewährt werden. Er soll deren Aufbau so-wie den Bezug zur Pflegedidaktik erkennen. Die Zielsetzung besteht zudem darin, An-wendungsmöglichkeiten für die Umsetzung in der Praxis zu schaffen. Durch kritische Ansätze im weiteren Verlauf der Arbeit möchte die Verfasserin aufzeigen, dass es kei-nesfalls ein standardisiertes Modell für die Anwendung in der Praxis gibt. Vielmehr soll deutlich gemacht werden, dass eine individuelle Anpassung an die jeweilige Situation und zeitlich bedingte Veränderungen notwendig sind.
Um dies zu erreichen, beschreibt der erste Teil der Arbeit zunächst den Lebensweg Wittnebens und die Entwicklung des Modells. Im weiteren Verlauf werden dann Schwerpunkte sowie die einzelnen Ebenen dargelegt. Nach diesem Überblick werden pflegedidaktische Ansätze vorgestellt, um so das Verständnis von Patientenorientierung bestmöglich zu vermitteln. Der Fokus liegt hierbei zum einen auf der Patientenorientie-rung und zum anderen auf der schülerorientierten Umsetzungsstrategie in der Ausbil-dung. Das Verständnis des Menschenbildes nach Wittneben sowie das Ordnungsmus-ter der verschiedenen Stufen bilden den Hauptansatz der kritischen Betrachtung. Das abschließende Resümee bietet dem Leser Denkanstöße sowie einen kurzen Ausblick. Es wurde in der vorliegenden Hausarbeit auf Grund des begrenzten Umfanges bewusst darauf verzichtet, einen Bezug zur praktischen Ausbildung herzustellen und alle aufge- führten Kompetenzen zu erläutern. Um der besseren Lesbarkeit willen wird in diesem Text für Personenbezeichnungen überwiegend die männliche Form gewählt.
2 Biographischer Hintergrund Wittnebens und Ursprünge des Modells
Prof. Dr. phil. Karin Wittneben, M. A., absolvierte ihre Ausbildung zur Krankenschwester sowohl in Deutschland (Hamburg) als auch in England (London). Dadurch wurde sie frühzeitig mit der Pflegewissenschaft im anglophonen Raum konfrontiert und setzte sich mit ihr auseinander. Es schlossen sich Tätigkeiten als Kranken-, Stabs- und Ober-schwester in deutschen und englischen Krankenhäusern an. Nach Abschluss einer Wei-terbildung zur Lehrerin für Pflegeberufe in Heidelberg übernahm Wittneben über einen längeren Zeitraum die Lehrtätigkeit an einer Krankenpflegeschule. Ihren Erfahrungsho-rizont erweiterte sie im Anschluss mit einem Studium der Erziehungswissenschaft, So-ziologie, Psychologie und Pflegewissenschaft an den Universitäten Hannover und Wisconsin-Madison, USA (M. A.). Wittneben legte ihre Promotion zur Dr. phil. an der Universität in Hannover ab und engagierte sich ab 1993 als Professorin für Erzie-hungswissenschaft an der Universität Hamburg. Hierbei nahm die Berufspädagogik mit Schwerpunkt Didaktik der beruflichen Fachrichtung Gesundheit eine zentrale Stellung ein. Im selben Jahr beschäftigte sie sich noch mit der Planung eines Lehrstudiengangs. Seit ihrer Emeritierung im Jahre 2000 nutzt Wittneben ihre Zeit, um sich didaktischen Fragen der Pflegebildung zu widmen (vgl. Stemmer 2003, S. 6).
Wittnebens Zielsetzung im Rahmen ihrer Dissertation lag bei der Entwicklung einer Pflegedidaktik, welche die Ansprüche einer patientenorientierten Pflegewissenschaft und einer schülerorientierten Unterrichtswissenschaft beinhalten soll. Entsprechend suchte sie nach einem wissenschaftsorientierten Pflegebegriff und entwickelte, aus ei-ner fachdidaktischen Sichtweise heraus, das Modell der multidimensionalen Patienten-orientierung, welches nicht nur der Umsetzung einer patientenorientierten Pflege dienen soll, sondern ebenso einer schülerorientierten beruflichen Ausbildung und einer Persön-lichkeitsentwicklung künftiger Fachkräfte der Krankenpflege (vgl. Wittneben 1994, S. 25 f.). Wittneben möchte mit ihrem Modell einen Beitrag zur Humanisierung der Gesell-schaft leisten, da dieser Prozess mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Krankenpflege fest verflochten ist (vgl. Wittneben 2003, S. 1). Überdies besteht auch das Interesse der Pflegetheoretikerin in der Entwicklung einer eigenständigen Position der Pflege, um unabhängig von der Medizin eine Professionalisierung der Pflege vor-antreiben zu können.
3 Modell multidimensionaler Patientenorientierung
3.1 Schwerpunkte und besondere Ansätze des Modells
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Ursprüngliches heuristisches Modell der multidimensionalen Patientenorientierung
(Quelle: Wittneben 2003, S. 103)
Das Hauptziel des Modells der multidimensionalen Patientenorientierung besteht in der Darlegung und Ordnung des Begriffes der Patientenorientierung. Um dieses zu errei-chen, werden in dem von Wittneben selbst als heuristisch betitelten Modell unterschied-liche pflegerische Ausrichtungen mit dem Ausmaß an Patientenorientierung bzw. Pa-tientenignorierung in Beziehung gesetzt. Laut Wittneben werden alle für die Patientenorientierung bedeutsamen Gesichtspunkte in ihrem Modell aufgenommen (vgl. Stemmer 2003, S. 8).
Wittneben kritisiert die Gegenüberstellung von Patientenorientierung versus Krank-heitsorientierung. Es sei nicht möglich, eine Krankheit ohne Ansehen des Patienten zu betrachten, und umgekehrt gelte dies ebenso. Krankheitsorientierung befindet sich so-mit immer in einem gewissen Zusammenhang mit der Patientenorientierung. Es steht Wittnebens Modell der multidimensionalen Patientenorientierung 3
demnach nicht nur eine einzelne Perspektive im Mittelpunkt, sondern das Problem des Umfangs und der Qualität der Patientenorientierung. Die Theoretikerin stellt deshalb in ihrem Modell die Begriffe Patientenorientierung und Patientenignorierung gegenüber. Auf die Krankheitsorientierung, welche sie in der Pflegewirklichkeit als notwendig erach-tet, möchte sie aber nicht völlig verzichten, sondern integriert diese als eine Dimension in ihr Stufenmodell (vgl. Wittneben 2003 S. 14).
Aus Abb. 2 geht hervor, dass die Ablauforientierung in dem von Wittneben modifizierten heuristischen Modell aus dem Jahre 1998 als unterste Stufe dargestellt wird. Von dieser gehen alle weiteren Stufen in aufsteigender Richtung aus und werden als Verrichtungs-, Symptom-, Krankheits-, Verhaltens- und Handlungsorientierung bezeichnet. Die Ebenen höherer Stufen beinhalten jeweils alle unter ihnen angeordneten Ebenen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Modifiziertes Modell der multidimensionalen Patientenorientierung (Quelle: Wittneben 2003, S. 107)
Wittneben geht davon aus, dass die Patientenorientierung in aufsteigender Richtung zunimmt. Ihr Gedanke war anfangs, dass der gegenübergestellte Begriff Patientenigno-rierung in aufsteigender Richtung an Bedeutung verliert. Diese Überlegung korrigiert sie jedoch, indem sie darauf hinweist, dass auf den verschiedenen Ebenen zwischen den Polen Patientenorientierung und Patientenignorierung gedacht und gehandelt werden kann (vgl. Wittneben 1994, S. 26).
[...]
- Arbeit zitieren
- Johanna Stocker (Autor:in), 2009, Wittnebens Modell der multidimensionalen Patientenorientierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135318