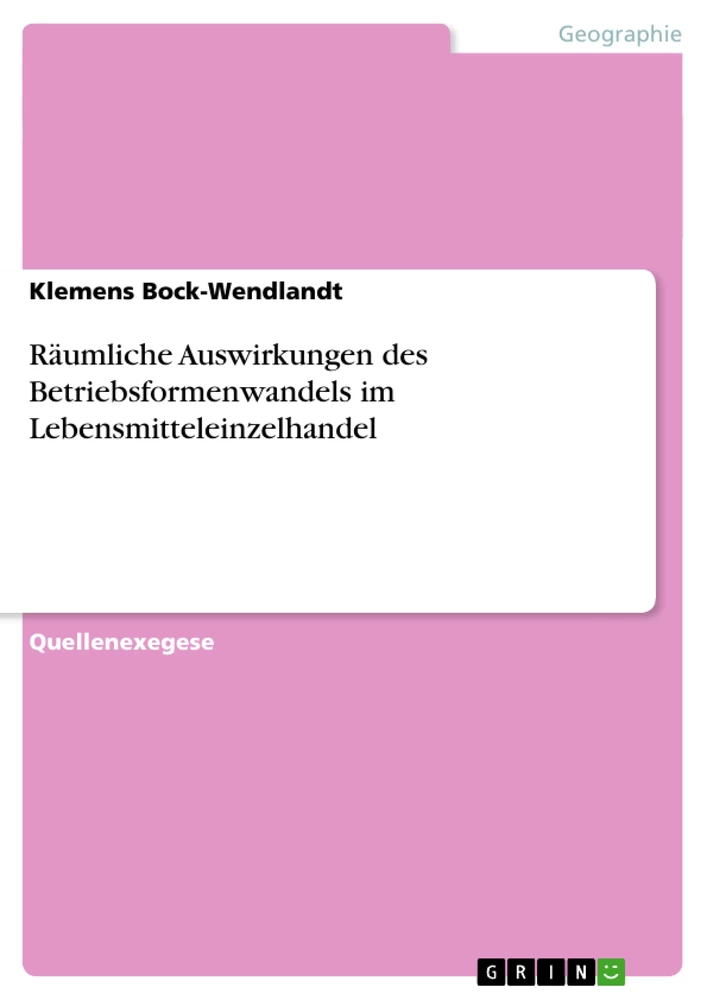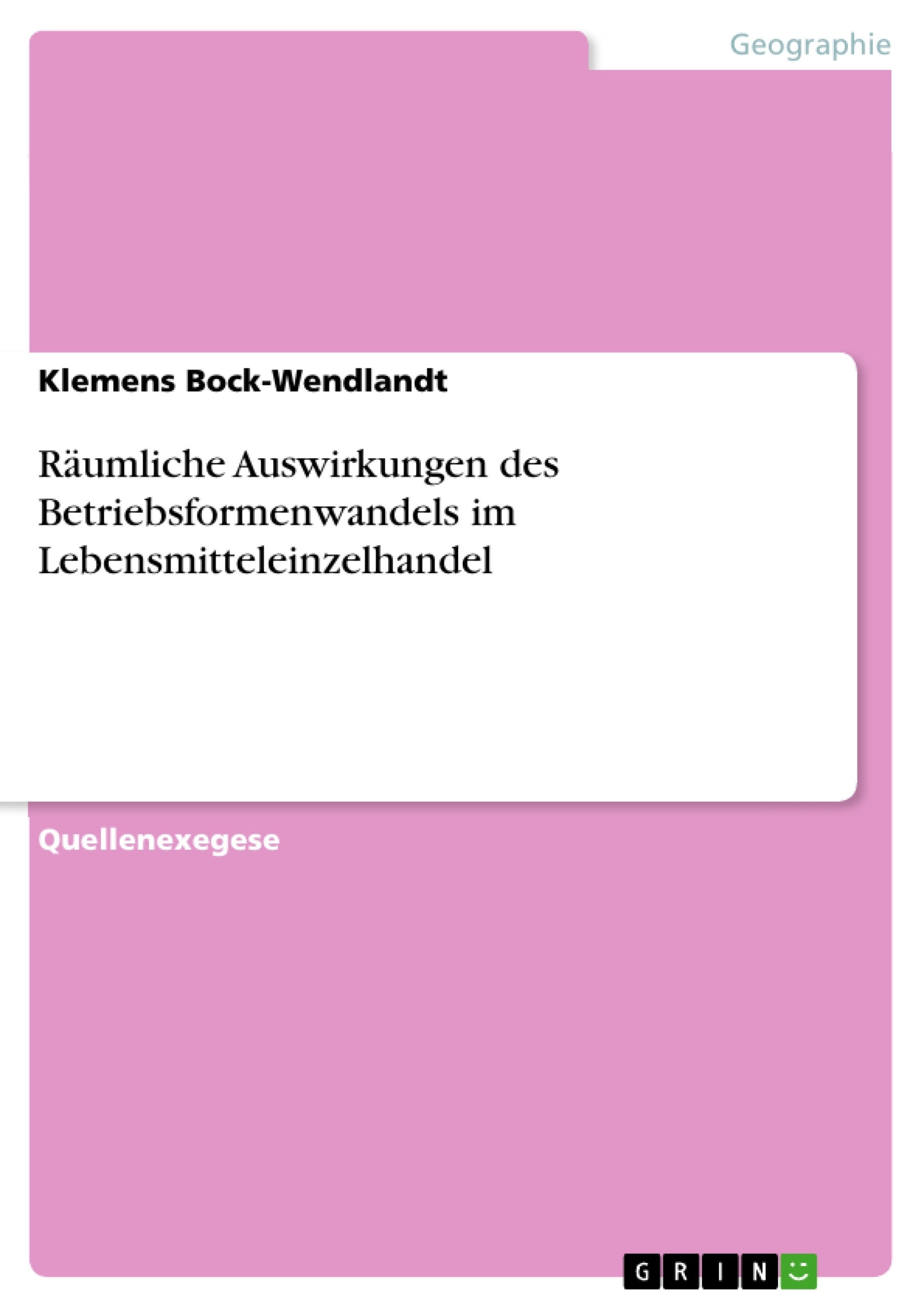Im Lebensmitteleinzelhandel lassen sich insbesondere seit den 1980er Jahren verstärkt Veränderungen der Standortstrukturen beobachten. Neben dem traditionellen primären Versorgungsnetz ist durch den Betriebsformenwandel mit dem Aufkommen von SB-Warenhäusern und Discountern ein sekundäres Versorgungsnetz entstanden, dessen Standorte vorwiegend in autoorientierten Lagen liegen. Die Nähe zu Wohngebieten ist nicht mehr das wichtigste Kriterium zur Ansiedlung. Weitere Merkmale der Umstrukturierung sind die Zunahme der Verkaufsflächen bei insgesamt sinkenden Geschäftszahlen als Zeichen eines fortschreitenden Konzentrationsprozesses. Das ehemals dichte Netz an Lebensmittelgeschäften ist ausgedünnt. Insbesondere in Nebenzentren, Streulagen in Wohngebieten und ländlichen Gebieten nahm die Zahl der Lebensmittelgeschäfte deutlich ab, was sich negativ auf die Nahversorgung der Bevölkerung ausgewirkt hat. Während diese Netzausdünnung im ländlichen Raum vornehmlich in kleineren Ortschaften schon lange zu beobachten ist, gewann das Thema der Versorgungssicherheit in Städten erst in jüngerer Vergangenheit an Relevanz.
Auch die Zentrenstruktur wird durch die veränderten Standortstrukturen des Lebensmitteleinzelhandels beeinflusst, da die Ansiedlung von neuen Verkaufsstellen an Pkw-orientierten Standorten oftmals mit der Schließung zentral gelegener Geschäfte einhergeht. Damit gehen den Zentren wichtige Magnetbetriebe verloren. Gleichzeitig erhöht sich die Wettbewerbsintensität für die verbleibenden zentralen Lebensmittelgeschäfte. Von diesem Entwicklungstrend sind insbesondere städtische Nebenzentren betroffen, die sich ohnehin schon in einer prekären Wettbewerbsposition befinden und somit weiter geschwächt werden. Gleichzeitig gewinnen nicht integrierte Einzelhandelsagglomerationen sowie teilweise Grund- und Mittelzentren einen Bedeutungszuwachs.
Ermöglicht und beschleunigt wurden die Umstrukturierungsprozesse im Einzelhandel durch Veränderungen auf der Konsumentenseite. Wichtige Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten sind ein höheres verfügbares Einkommen, mehr Freizeit, eine erhöhte Mobilität durch die zunehmende Pkw-Orientierung sowie die Individualisierung und Pluralisierung innerhalb der Gesellschaft, wodurch neue Konsummuster entstanden sind, die durch Wahlmöglichkeiten und Mehrfachorientierungen gekennzeichnet sind.
Die planungsrechtlichen Vorschriften konnten zudem die Ausbreitung von zentrenschädigenden Einzelhandelsansiedlungen nicht verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien zur Erklärung des Betriebformenwandels im Einzelhandel
- 2.1 Umwelttheorien
- 2.2 Zyklische Theorien
- 2.3 Konflikttheorien
- 3. Betriebsformenwandel und weitere Merkmale des Strukturwandels im Lebensmitteleinzelhandel
- 3.1 Betriebsformenwandel im Lebensmitteleinzelhandel
- 3.1.1 Kleine Lebensmittelgeschäfte
- 3.1.2 Supermärkte
- 3.1.3 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte
- 3.1.4 Discounter
- 3.2 Sinkende Betriebszahlen und Verkaufsflächenexpansion
- 3.3 Konzentration und Internationalisierung
- 3.3.1 Konzentrationsprozesse
- 3.3.2 Internationalisierung
- 3.4 Handelsexogene Faktoren
- 3.4.1 Konsumenten
- 3.4.1.1 Einkommen
- 3.4.1.2 Bevölkerungsentwicklung
- 3.4.1.3 Altersstruktur
- 3.4.1.4 Erwerbstätigkeit und Bildungsstand
- 3.4.1.5 Anzahl und Größe der Privathaushalte und Familienstrukturen
- 3.4.1.6 Werte, Einstellungen und Einkaufsmotive
- 3.4.1.7 Prägung des Einkaufverhaltens durch technischen Fortschritt, höhere Mobilität und veränderte Siedlungstrukturen
- 3.4.2 Planung
- 3.4.2.1 Planungsrechtliche Einflussmöglichkeiten der Gemeinden
- 3.4.2.2 Planungsrechtliche Einflussmöglichkeiten übergeordneter Ebenen
- 4. Auswirkungen des Betriebsformenwandels auf die Standortstrukturen des Lebensmitteleinzelhandels, das Zentrensystem und die Versorgungssituation der Bevölkerung
- 4.1 Veränderungen der Standortstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel
- 4.1.1 Standortstrukturen im (Lebensmittel-)Einzelhandel bis in die 1960er Jahre
- 4.1.2 Standortstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel seit den 1960ern
- 4.1.3 Standortstrukturen in Ostdeutschland
- 4.2 Räumliche Auswirkungen auf das Zentrensystem
- 4.2.1 City/Innenstadt
- 4.2.2 Sub- und Nebenzentren
- 4.2.3 Nicht integrierte Lagen
- 4.2.4 Ländlicher Raum
- 4.3 Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs
- 4.3.1 Auswirkungen auf die Versorgungssituation in den Städten
- 4.3.2 Auswirkungen auf die Versorgungssituation im ländlichen Raum
- 4.3.3 Sicherung und Verbesserung der Nahversorgung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Strukturwandel im deutschen Lebensmitteleinzelhandel seit den 1960er Jahren und dessen räumliche Auswirkungen. Die Zielsetzung besteht darin, die theoretischen Grundlagen des Betriebsformenwandels zu beleuchten und die Veränderungen in den Standortstrukturen, im Zentrensystem und in der Versorgungssituation der Bevölkerung zu analysieren.
- Theorien des Betriebsformenwandels im Einzelhandel
- Veränderungen der Betriebsformen im Lebensmitteleinzelhandel
- Räumliche Auswirkungen auf die Standortstrukturen
- Einfluss auf das Zentrensystem
- Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den tiefgreifenden Strukturwandel im deutschen Einzelhandel seit den 1960er Jahren, der zu einer Verlagerung von Verkaufsstätten in verkehrsgünstige Lagen außerhalb der Zentren geführt hat. Der Fokus liegt auf dem Lebensmitteleinzelhandel, charakterisiert durch das Aufkommen neuer, großflächiger Betriebsformen, Verkaufsflächenausweitung bei gleichzeitigem Rückgang der Verkaufsstellen und Konzentrationsprozessen. Der Betriebsformenwandel wird als Motor dieser Entwicklung identifiziert, und die Arbeit kündigt die Betrachtung theoretischer Konzepte, handelsendogener und -exogener Einflüsse (Konsumentenverhalten und planungsrechtliche Vorgaben) an, sowie die Analyse der räumlichen Auswirkungen auf Standortstrukturen, Zentrensystem und die Versorgungssituation.
2. Theorien zur Erklärung des Betriebformenwandels im Einzelhandel: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung des Betriebsformenwandels, eingeteilt in Umwelttheorien, zyklische Theorien und Konflikttheorien. Umwelttheorien betonen den Einfluss handelsexogener Faktoren und die Anpassungsfähigkeit des Einzelhandels an diese. Zyklische Theorien fokussieren auf Entwicklungszyklen von Betriebsformen, während Konflikttheorien auf die Konkurrenz und den Kampf um Marktanteile eingehen. Das Kapitel analysiert Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze.
3. Betriebsformenwandel und weitere Merkmale des Strukturwandels im Lebensmitteleinzelhandel: Dieses Kapitel detailliert den Betriebsformenwandel im Lebensmitteleinzelhandel, untersucht den Rückgang kleiner Geschäfte und die Expansion von Supermärkten, SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten und Discountern. Es analysiert den Zusammenhang zwischen sinkenden Betriebszahlen und Verkaufsflächenexpansion sowie die zunehmende Konzentration und Internationalisierung im Sektor. Handelsexogene Faktoren wie Konsumentenverhalten (Einkommen, demografische Entwicklung, Werte, Einstellungen) und planungsrechtliche Vorgaben werden ebenfalls berücksichtigt.
4. Auswirkungen des Betriebsformenwandels auf die Standortstrukturen des Lebensmitteleinzelhandels, das Zentrensystem und die Versorgungssituation der Bevölkerung: Dieses Kapitel befasst sich mit den räumlichen Folgen des Strukturwandels. Es untersucht die Veränderungen der Standortstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel, beginnend mit den Verhältnissen bis in die 1960er Jahre und deren Entwicklung danach, einschließlich der Betrachtung Ostdeutschlands. Der Einfluss auf das Zentrensystem (City, Subzentren, nicht integrierte Lagen, ländlicher Raum) und die Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Bevölkerung in städtischen und ländlichen Gebieten werden analysiert. Die Sicherung und Verbesserung der Nahversorgung wird als entscheidender Aspekt hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Betriebsformenwandel, Lebensmitteleinzelhandel, Standortstrukturen, Zentrensystem, Versorgungssituation, Umwelttheorien, Zyklische Theorien, Konzentration, Internationalisierung, Konsumentenverhalten, Planungsrecht.
FAQ: Strukturwandel im deutschen Lebensmitteleinzelhandel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Strukturwandel im deutschen Lebensmitteleinzelhandel seit den 1960er Jahren und dessen räumliche Auswirkungen auf Standortstrukturen, Zentrensystem und die Versorgungssituation der Bevölkerung. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Betriebsformenwandels und analysiert die Veränderungen in diesen Bereichen.
Welche Theorien werden zur Erklärung des Betriebsformenwandels behandelt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene theoretische Ansätze, darunter Umwelttheorien (Einfluss externer Faktoren und Anpassungsfähigkeit), zyklische Theorien (Entwicklungszyklen von Betriebsformen) und Konflikttheorien (Konkurrenz und Kampf um Marktanteile). Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze werden analysiert.
Welche Veränderungen im Lebensmitteleinzelhandel werden beschrieben?
Die Arbeit detailliert den Rückgang kleiner Lebensmittelgeschäfte und die Expansion von Supermärkten, SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten und Discountern. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen sinkenden Betriebszahlen und Verkaufsflächenexpansion sowie die zunehmende Konzentration und Internationalisierung im Sektor.
Welche Rolle spielen handelsexogene Faktoren?
Handelsexogene Faktoren wie Konsumentenverhalten (Einkommen, demografische Entwicklung, Werte, Einstellungen, Einkaufsmotive, technischer Fortschritt, Mobilität, Siedlungsstrukturen) und planungsrechtliche Vorgaben (Einflussmöglichkeiten von Gemeinden und übergeordneten Ebenen) werden als wichtige Einflussfaktoren auf den Strukturwandel betrachtet.
Welche räumlichen Auswirkungen des Strukturwandels werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Veränderungen der Standortstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel von den 1960er Jahren bis heute, einschließlich Ostdeutschlands. Der Einfluss auf das Zentrensystem (City, Subzentren, nicht integrierte Lagen, ländlicher Raum) und die Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Bevölkerung in städtischen und ländlichen Gebieten werden analysiert. Die Sicherung und Verbesserung der Nahversorgung wird als entscheidender Aspekt hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theorien zur Erklärung des Betriebformenwandels, Betriebsformenwandel und weitere Merkmale des Strukturwandels im Lebensmitteleinzelhandel, Auswirkungen des Betriebsformenwandels auf Standortstrukturen, Zentrensystem und Versorgungssituation, und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Betriebsformenwandel, Lebensmitteleinzelhandel, Standortstrukturen, Zentrensystem, Versorgungssituation, Umwelttheorien, Zyklische Theorien, Konzentration, Internationalisierung, Konsumentenverhalten, Planungsrecht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die theoretischen Grundlagen des Betriebsformenwandels zu beleuchten und die Veränderungen in den Standortstrukturen, im Zentrensystem und in der Versorgungssituation der Bevölkerung zu analysieren.
- Quote paper
- Klemens Bock-Wendlandt (Author), 2009, Räumliche Auswirkungen des Betriebsformenwandels im Lebensmitteleinzelhandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135539