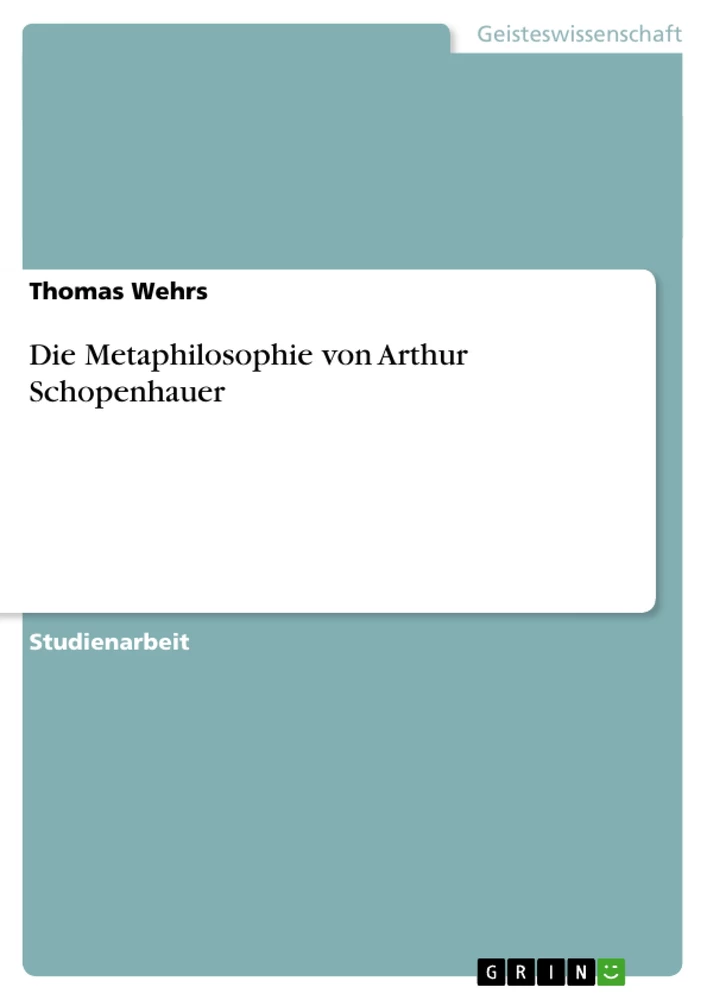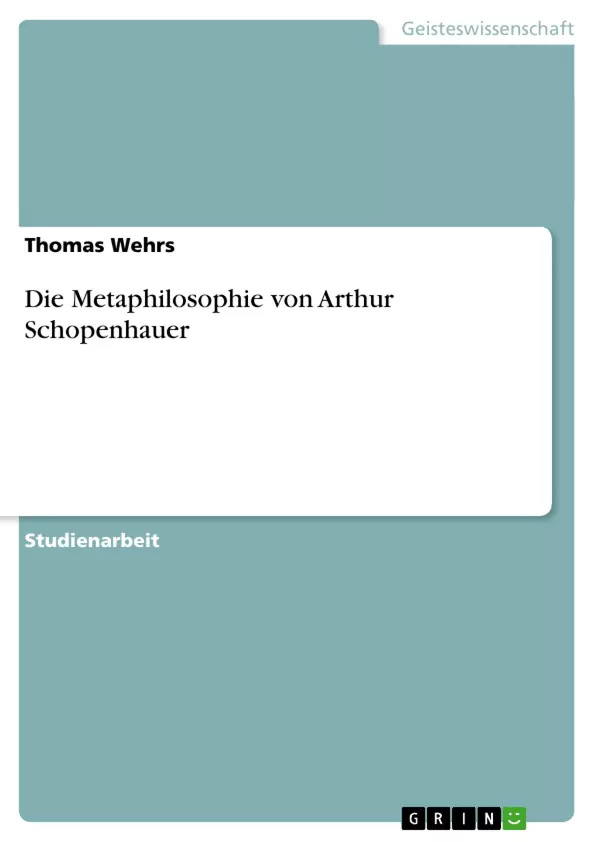Im vierten Buch seines Hauptwerks „Die Welt als Wille und Vorstellung“ beschreibt Arthur Schopenhauer „den Idealzustand der menschlichen Existenz als Schmerzlosigkeit und Seelenruhe.“ In dem Willen, der die Menschen in Unruhe versetzt, sieht Schopenhauer allerdings eine gewichtige Hürde zu diesem Daseinszustand. „Dieser Wille will nichts Bestimmtes. Er hat kein Ziel und soll nicht mit dem Willensakt verwechselt werden. Erst durch den individuellen Willensakt wird dieser ziellose Wille im Nachhinein auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet.“ Durch das Wollen wird der Mensch verletzbar und neigt dazu, andere zu verletzen. Nach Schopenhauers Meinung sind Ermahnungen und Vorschriften dagegen machtlos. Aus diesem Grund fordert er die Moralphilosophen auf keine Anweisungen des Handelns anzuordnen:
„Meiner Meinung nach aber ist alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesentlich ist, sich, was auch immer der nächste Gegenstand der Untersuchung sei, stets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. Hingegen praktisch zu werden, das Handeln zu leiten, den Charakter umzuschaffen sind alte Ansprüche, die sie bei gereifter Einsicht endlich aufgeben sollte.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Ein neuer Ansatz für die Philosophie
2. Philosophie zwischen Wissenschaft und Kunst
2.1 Das Was der Erscheinungen
2.2 Der Wille als Ding an sich
2.3 Der Wille als >Wille zum Leben<
2.4 Tod und Trauer
3. Die eigentliche Aufgabe der Philosophie
4. Literaturverzeichnis:
1. Ein neuer Ansatz für die Philosophie
Im vierten Buch seines Hauptwerks „Die Welt als Wille und Vorstellung“ beschreibt Arthur Schopenhauer „den Idealzustand der menschlichen Existenz als Schmerzlosigkeit und Seelenruhe.“[1]
In dem Willen, der die Menschen in Unruhe versetzt, sieht Schopenhauer allerdings eine gewichtige Hürde zu diesem Daseinszustand.
„Dieser Wille will nichts Bestimmtes. Er hat kein Ziel und soll nicht mit dem Willensakt verwechselt werden. Erst durch den individuellen Willensakt wird dieser ziellose Wille im Nachhinein auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet.“[2]
Durch das Wollen wird der Mensch verletzbar und neigt dazu, andere zu verletzen. Nach Schopenhauers Meinung sind Ermahnungen und Vorschriften dagegen machtlos. Aus diesem Grund fordert er die Moralphilosophen auf keine Anweisungen des Handelns anzuordnen:
„Meiner Meinung nach aber ist alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesentlich ist, sich, was auch immer der nächste Gegenstand der Untersuchung sei, stets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. Hingegen praktisch zu werden, das Handeln zu leiten, den Charakter umzuschaffen sind alte Ansprüche, die sie bei gereifter Einsicht endlich aufgeben sollte.“[3]
Nach Schopenhauers Ansicht kann der Sinn philosophischer Aussagen außerdem in keinen gehaltlosen Spekulationen über das Metaphysische liegen. In der folgenden Äußerung ist deutlich zu erkennen, wie sehr er gegen diese Art des Philosophierens, basierend auf substanzlosen Annahmen, protestiert:
„… so werden wir nichts weniger nötig haben, als zu inhaltsleeren, negativen Begriffen unsere Zuflucht zu nehmen und dann etwan gar uns selbst glauben zu machen, wir sagten etwas, wenn wir mit hohen Augenbrauen vom >Absoluten<, vom >Unendlichen< vom >Übersinnlichen< und was dergleichen bloße Negation mehr sind, statt deren man kürzer Wolkenkuckucksheim sagen könnte, redeten: zugedeckte, leere Schüsseln dieser Art werden wir nicht aufzutischen brauchen.“[4]
Schopenhauer argumentiert für einen neuen Ansatz des Philosophierens. Diese Hausarbeit legt diesen neuen Ansatz der Philosophie von Schopenhauer über die Philosophie dar.
2. Philosophie zwischen Wissenschaft und Kunst
2.1 Das Was der Erscheinungen
Dieter Birnbacher zeigt in seinem Essay „Wille und Weltverneinigung“ auf, dass Schopenhauers
„…Auffassung von Philosophie ist, sich nicht in abstrakte Spekulationen über Gott und die Welt zu ergehen, sondern die konkrete und höchstpersönliche Erfahrung des Menschen mit der Welt, in die er hineingeboren wird, auf den Begriff zu bringen.“[5]
Wirklich sinnvoll ist somit die Philosophie und sogar in gewisser Weise erforderlich, wenn sie Erkenntnisse und Erfahrungen dem Menschen näher bringt, die er zum Verstehen des eigenen Daseins und dessen Eigenschaften benötigt.
Schopenhauers neuer Sinn für Philosophie legt den Schwerpunkt darauf, dem Menschen gerade die Erkenntnisse zu vermitteln, die zum Verstehen seiner eigenen Existenz und deren Form notwendig ist. Den Ausdruck „praktische Philosophie“ weist er hierfür entschieden zurück, da der Ausdruck den gleichen Widerspruch in sich enthält wie der Ausdruck „hölzernes Eisen.“[6]
Die bis dahin bekannten Systeme der Philosophie versuchten die Welt aufgrund außerhalb der Erfahrung liegenden Prämissen zu erklären,
„…aus denen sich Existenz, Struktur und Erkennbarkeit der Erscheinungswelt herleiten.“[7]
Schopenhauer widerspricht diesem Ansatz und fordert als Gegenmodell eine Philosophie, die uns die Welt verständlich macht, wie sie uns erscheint und sie soll ihre bedeutsamsten Grundzüge beschreiben.
„Auf diese Weise wird die Philosophie zwischen Wissenschaft und Kunst angesiedelt. Von der Wissenschaft unterscheidet sie sich dadurch, dass sie nicht nach dem Warum (den Ursachen), sondern nach dem Was (dem Gehalt) der Erscheinungen fragt.“[8]
Sie zeigt nicht, was sein muss, sondern was ist. Auf andere Art als die Wissenschaft bezieht sie damit die inneren Erfahrungen, die subjektiv gefärbte Gefühlswelt und das Verständnis für den eigenen Körper mit ein.
Das menschliche Handeln kommt für Schopenhauer direkt aus dem inneren Wesen des Menschen und kann nicht von außen gelehrt werden, indem durch gefühlslose Argumentationen dem menschlichen Handeln seine Ziele vorgegeben werden, oder ihm vorschreiben, was er >wollen soll<.
„Die Philosophie kann nirgends mehr tun als das Vorhandene zu deuten und erklären, das Wesen der Welt, welches in concreto, d.h. als Gefühl, jedem verständlich sich ausspricht, zur deutlichen, abstrakten Erkenntnis der Vernunft bringen, dieses aber in jeder möglichen Beziehung und von jedem Gesichtspunkt aus.“[9]
„Die echte philosophische Betrachtungsweise der Welt, d.h. diejenige, welche uns ihr inneres Wesen erkennen lehrt und so über die Erscheinung hinausführt, ist gerade die, welche nicht nach dem Woher und Wohin und Warum, sondern immer und überall nur nach dem Was der Welt frägt,…“[10]
Aus dem Ansatz seiner Philosophie ist eindeutig die Aufforderung nach Selbstverantwortlichkeit, der Nichtachtung von Autoritäten und verstaubten Tatsachen zu lesen. Besonders ersichtlich ist die Einstellung der Abschätzigkeit in der Kritik an verbreiteten Leerformeln, etwa des von Kant ausgestatteten Begriffs der „Würde des Menschen“ oder des Menschen als „Zweck in sich“. Schopenhauers Maßstäbe für alle Philosophen sieht Birnbacher in seinem Aufsatz im „Selbstdenken und der intellektuellen Redlichkeit“[11]
„Mit Schopenhauer treten die irrationalen und abgründigen Seiten des Menschen aus dem Dunkel heraus ins helle Licht der Philosophie.“[12]
Für Schopenhauer ist jedes Ausweichen in metaphysische oder sogar in mystische Bereiche unnötig, weil eben die Frage nach der Quelle und dem Verständnis der Welt nicht im Interesse der Philosophie liegt. Es ist für den Theoretiker jedoch leicht auf diese Fragen auszuweichen, wenn er zum Beispiel ein Wesen charakterisieren will, welches die Welt erschaffen oder erzeugt hat.
2.2 Der Wille als Ding an sich
Das für Schopenhauer Schmerzhafte und Peinigende des Willens als Ding an sich hat in dieser gefühlten Spannung den Ursprung in seiner biographischen Geschichte. Schon als Kind war sein Verständnis für das, insbesondere sinnlose, Leiden durch eigene Erfahrungen durchdrungen. Das Elend des Daseins in Form von Krankheit oder Tod hatten schon früh eine starke Anziehungskraft auf ihn. Die Verantwortung am Selbstmord seines Vaters sieht Schopenhauer in der Lieblosigkeit seiner Mutter. Schopenhauer versuchte daher seine Mutter durch Eifersucht und Moralisieren in ihrem Innersten zu treffen und zu verwunden.[13]
[...]
[1] Fellmann, S. 283
[2] Birnbacher, S. 132
[3] Schopenhauer, S. 375
[4] Schopenhauer, S. 377/378
[5] Birnbacher S. 125
[6] Schopenhauer, S. 377
[7] Birnbacher, S. 127
[8] Birnbacher, S. 127
[9] Schopenhauer, S. 376
[10] Schopenhauer, S. 379
[11] Birnbacher, S. 125
[12] Birnbacher, S. 125
[13] vgl. Birnbacher, S. 124
Häufig gestellte Fragen
Was ist laut Schopenhauer die eigentliche Aufgabe der Philosophie?
Für Schopenhauer ist Philosophie rein theoretisch. Ihre Aufgabe ist es, das Wesen der Welt zu forschen und zu deuten, nicht jedoch Handlungsanweisungen zu geben oder den Charakter umzuschaffen.
Warum lehnt Schopenhauer „praktische Philosophie“ ab?
Er betrachtet den Begriff als Widerspruch in sich (wie „hölzernes Eisen“), da Philosophie für ihn stets betrachtend und forschend sein muss, statt vorzuschreiben.
Wie grenzt Schopenhauer Philosophie von der Wissenschaft ab?
Während die Wissenschaft nach dem „Warum“ (den Ursachen) fragt, sucht die Philosophie nach dem „Was“ (dem Gehalt und Wesen) der Erscheinungen.
Was versteht Schopenhauer unter dem „Willen“?
Der Wille ist ein zielloser Drang, der den Menschen in Unruhe versetzt. Er ist das „Ding an sich“ und das innerste Wesen der Welt, das erst durch individuelle Akte auf Objekte gerichtet wird.
Was kritisiert Schopenhauer an metaphysischen Spekulationen?
Er verspottet inhaltsleere Begriffe wie das „Absolute“ oder „Übersinnliche“ als „Wolkenkuckucksheim“ und fordert stattdessen eine Philosophie, die auf konkreter Erfahrung basiert.
Welchen Idealzustand der menschlichen Existenz beschreibt er?
Schopenhauer bezeichnet die Schmerzlosigkeit und Seelenruhe als den Idealzustand, dem jedoch der unruhige Wille oft im Weg steht.
- Citar trabajo
- Thomas Wehrs (Autor), 2007, Die Metaphilosophie von Arthur Schopenhauer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135677