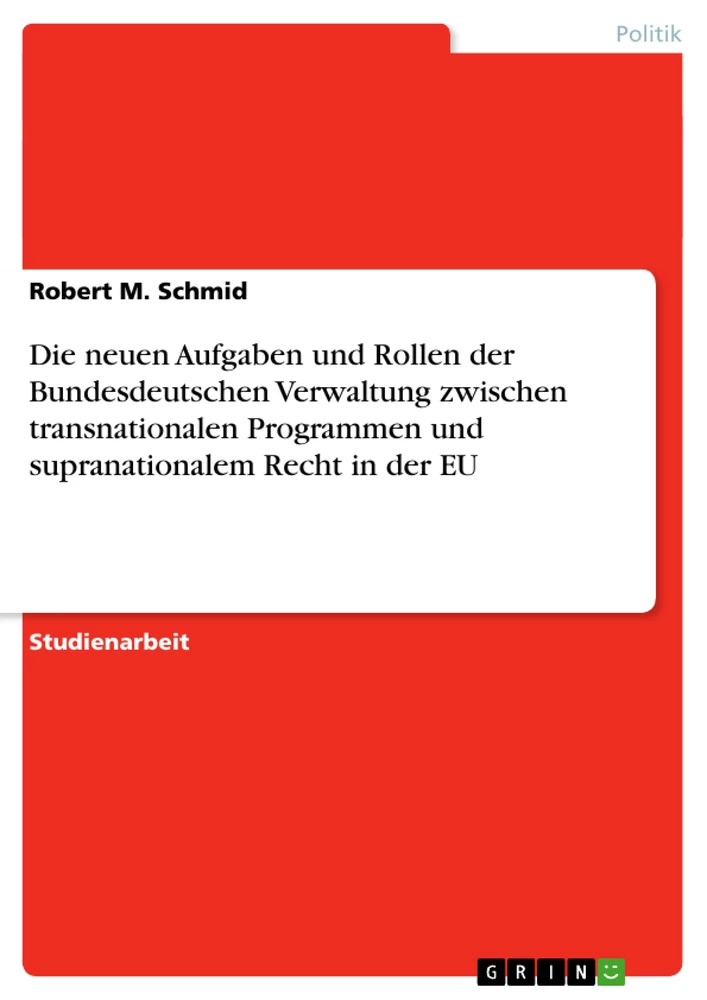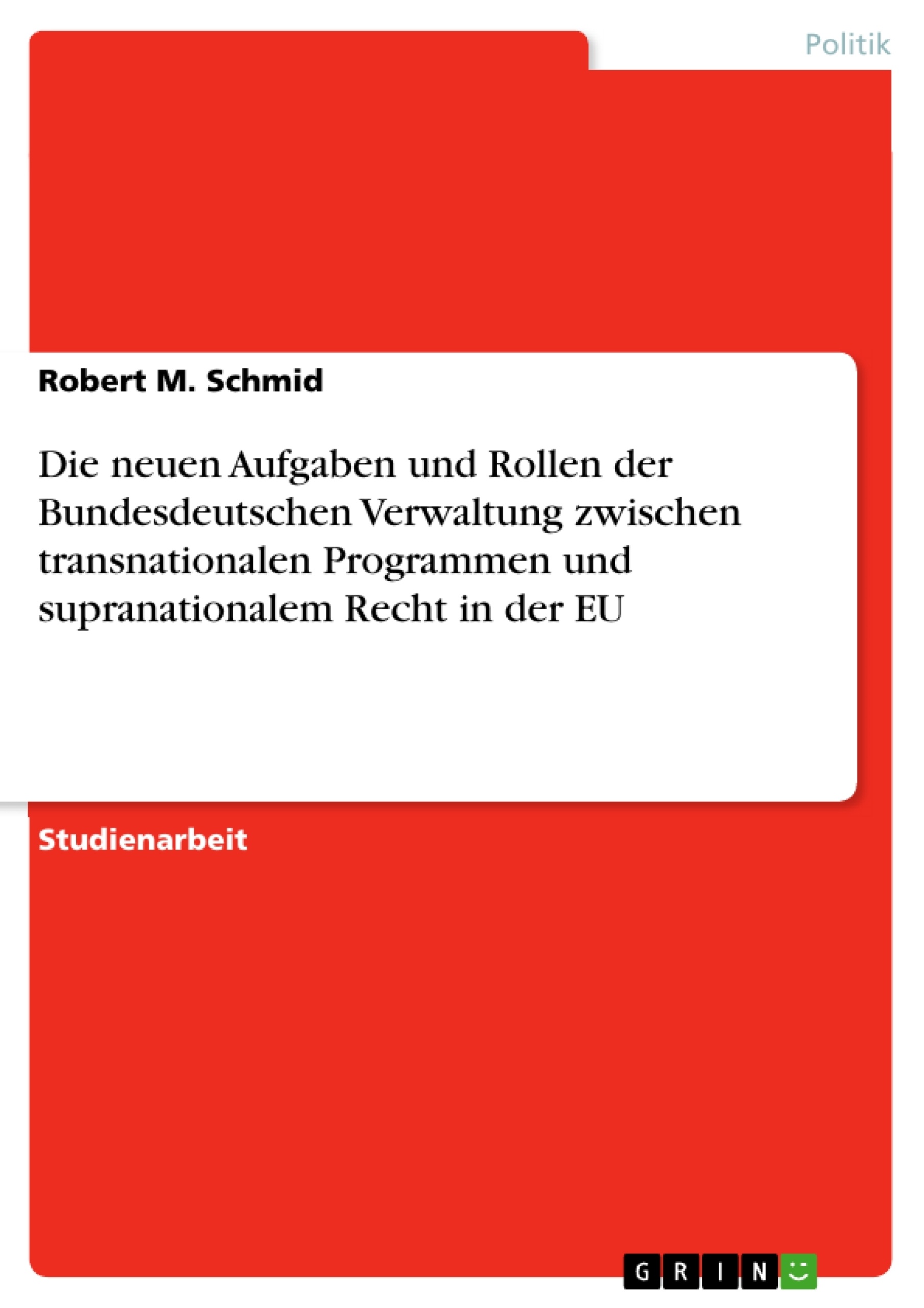Seit ihren Anfängen auf Basis des Schumannplans zur EGKS hat die Europäische Union viele Schritte absolviert, um an ihren jetzigen Punkt anzugelangen. Anfänglich eine reine Gemeinschaft der schwerindustriellen Branchen zur Kontrolle der kriegsrelevanten Industrien (EGKS) musterte sie sich Schritt auf Schritt weiter in Richtung umfassender europäischer Wirtschaftsgemeinschaft, die eine Vielzahl von Themen behandelt und regelt, von Agrarwirtschaft über Finanzsysteme zur Zollunion, und in viele andere Politikbereiche hinein. Hierfür waren die römischen Verträge 1955 von entscheidender Bedeutung. Darin strebten die damals 6 Gründungsmitglieder eine Schaffung eines gemeinsamen Marktes mit freiem Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die dafür notwendige Koordinierung und Harmonisierung unterschiedlicher Politiken an. Diese Grundidee ist mit den Maastrichter Verträgen, zum Beschluss der gemeinsamen Währungsreform, und dem Schengener Abkommen 1993, das nationale Grenzöffnungen zu einem europäischen Binnenraum vorsah, entscheidend vorangekommen, und hat die Situation der benachbarten Staaten in Europa deutlich verändert.
Der freie Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr ist eingerichtet, und nationale Sicherheitskontrollen wurden von den Grenzstationen abgezogen. Das bedeutet aber für Grenzregionen mehr, als nur einen Umbau der Sicherheits- und Kontrollmechanismen, es bedeutet auch, dass neue Aufgaben entstehen, die weder in territorialen noch in national-administrativen Grenzen zu lösen sind. Wirtschaftlich beispielsweise konkurrieren im weltweiten oder mindestens im innereuropäischen Wettbewerb um Wirtschaftsstandorte nicht mehr nur die Nationalstaaten, sondern auch innerstaatliche und kommunale Untergliederungen wie Länder, Provinzen, Regionen oder Städte. Die daraus entstehenden Verwaltungsanforderungen bzgl. Umweltschutz, Infrastruktur, etc. machen grenzüberschreitende Zusammenarbeit erforderlich und zunehmend relevant. Wo vor der Grenzöffnung die Nationalstaaten mit ihren Verwaltungen selbst international agierten, entstehen seit der Grenzöffnung verstärkt transnationale Kooperationen mit veränderten Akteuren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Internationalität, Transnationalität, Supranationalität
- 2. Die transnationale Kooperation
- 2.1 Ein europäisches Phänomen?
- 2.2 Länder, Gemeinden und Gebietskörperschaften als neue Akteure auf EU-Ebene
- 2.2.1 Das Interreg III – Programm der EU
- 2.2.2 Von der transnationalen Kooperation zum transnationalem Recht – die Karlsruher Übereinkünfte 1997
- 2.3 Zwischenergebnis
- 3. Die EU - eine supranationale Rechtsgemeinschaft
- 3.1 Die Beteiligung der mitgliedstaatlichen Verwaltungen an der Gemeinschaftsrechtsetzung
- 3.2 Vorverhandlungen und Gemeinschaftsrechtsetzung
- 3.3 Umsetzung von Gemeinschaftsrecht
- 3.3.1 Transformation in nationales Recht
- 3.3.2 Der verwaltungsmäßige Vollzug von Gemeinschaftsrecht
- 3.4 Zwischenergebnis
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Aufgaben und Rollen der Bundesdeutschen Verwaltung im Kontext der transnationalen Programme und des supranationalen Rechts in der EU. Sie analysiert, wie sich die Integrationsprozesse in Europa auf die Kompetenzen und den Einflussbereich der Bundesverwaltung auswirken und welche neuen Herausforderungen sich aus transnationalen Kooperationen und der Gesetzgebung der EU ergeben.
- Die Auswirkungen von transnationalen Kooperationen auf nationale Verwaltungen
- Die Rolle der Bundesverwaltung im Kontext transnationaler Programme
- Die Beziehung zwischen der Bundesverwaltung und supranationalem Recht
- Die Bedeutung der EU-Gesetzgebung für die nationale Verwaltung
- Die Zukunft der Bundesverwaltung im Kontext der europäischen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entwicklung der Europäischen Union von ihren Anfängen bis zum heutigen Tag dar und zeigt die Veränderungen in den Aufgaben und Kompetenzen der Bundesverwaltung auf. Sie beleuchtet die Entstehung neuer transnationaler Akteure und die damit verbundenen Herausforderungen für die Bundesverwaltung.
Das erste Kapitel behandelt die transnationale Kooperation. Es untersucht die Entstehung dieser Kooperationen, ihre rechtliche Situation und ihre Akteure. Es wird analysiert, welche Konsequenzen sich aus der transnationalen Kooperation für nationale Verwaltungen ergeben.
Das zweite Kapitel widmet sich der Supranationalität der EU. Es analysiert die Entstehung der EU-Institutionen und ihre Kompetenzen, insbesondere im Hinblick auf die Gesetzgebungsmacht. Es untersucht die Beteiligung der nationalen Verwaltungen an der Gemeinschaftsrechtsetzung und die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in nationales Recht.
Schlüsselwörter
Transnationale Kooperation, Supranationalität, EU-Recht, Gemeinschaftsrecht, Bundesverwaltung, Kompetenzen, Aufgaben, Rollen, Integration, Europäische Union, Nationalstaaten, Grenzregionen, Interreg III, Karlsruher Übereinkünfte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Rolle der deutschen Verwaltung durch die EU verändert?
Die Verwaltung agiert heute in einem Spannungsfeld zwischen nationalen Aufgaben, transnationalen Programmen und der Umsetzung von supranationalem EU-Recht.
Was sind die „Karlsruher Übereinkünfte“ von 1997?
Dies ist ein Abkommen, das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften (wie Ländern und Gemeinden) rechtlich absichert und den Weg von loser Kooperation zu transnationalem Recht ebnete.
Was ist das Interreg III-Programm?
Interreg III ist ein EU-Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit, das neue Anforderungen an die lokale Verwaltung stellt.
Wie wird EU-Gemeinschaftsrecht in Deutschland umgesetzt?
Die Arbeit analysiert die Transformation von EU-Vorgaben in nationales Recht sowie den verwaltungsmäßigen Vollzug dieses Rechts durch deutsche Behörden.
Was bedeutet Supranationalität für die Gesetzgebung?
Es bedeutet, dass die EU-Institutionen übergeordnete Rechtsetzungsmacht besitzen, an deren Vorverhandlungen nationale Verwaltungen jedoch oft beteiligt sind.
Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit heute so wichtig?
Da Probleme wie Umweltschutz oder Infrastruktur nicht mehr an nationalen Grenzen enden, konkurrieren Regionen und Städte heute im EU-Binnenraum direkt miteinander.
- Citation du texte
- Robert M. Schmid (Auteur), 2003, Die neuen Aufgaben und Rollen der Bundesdeutschen Verwaltung zwischen transnationalen Programmen und supranationalem Recht in der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13583