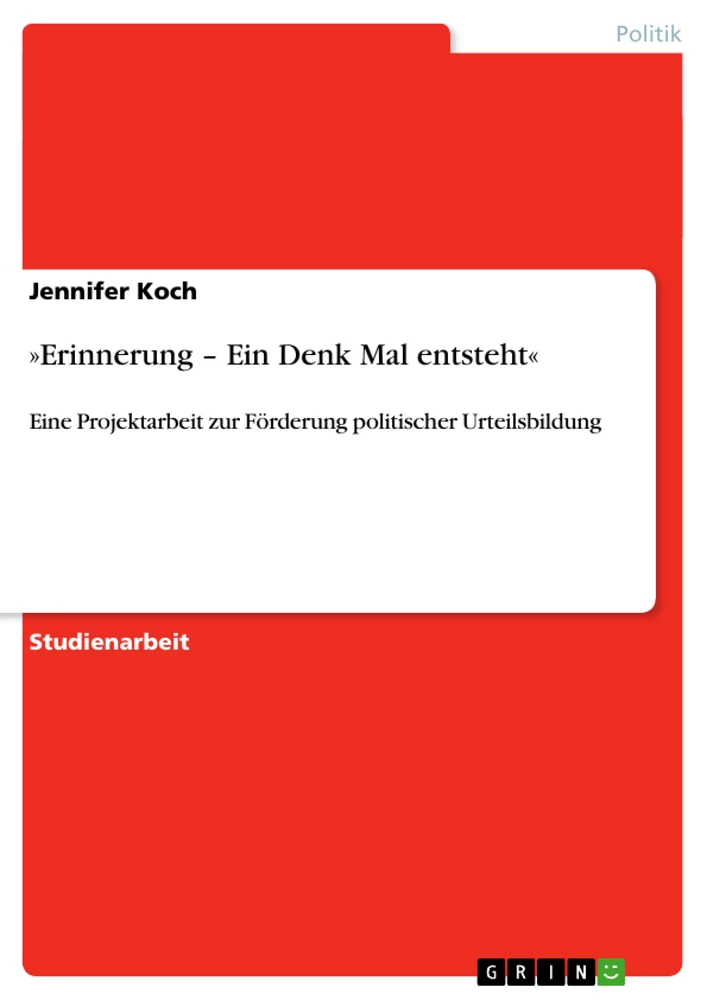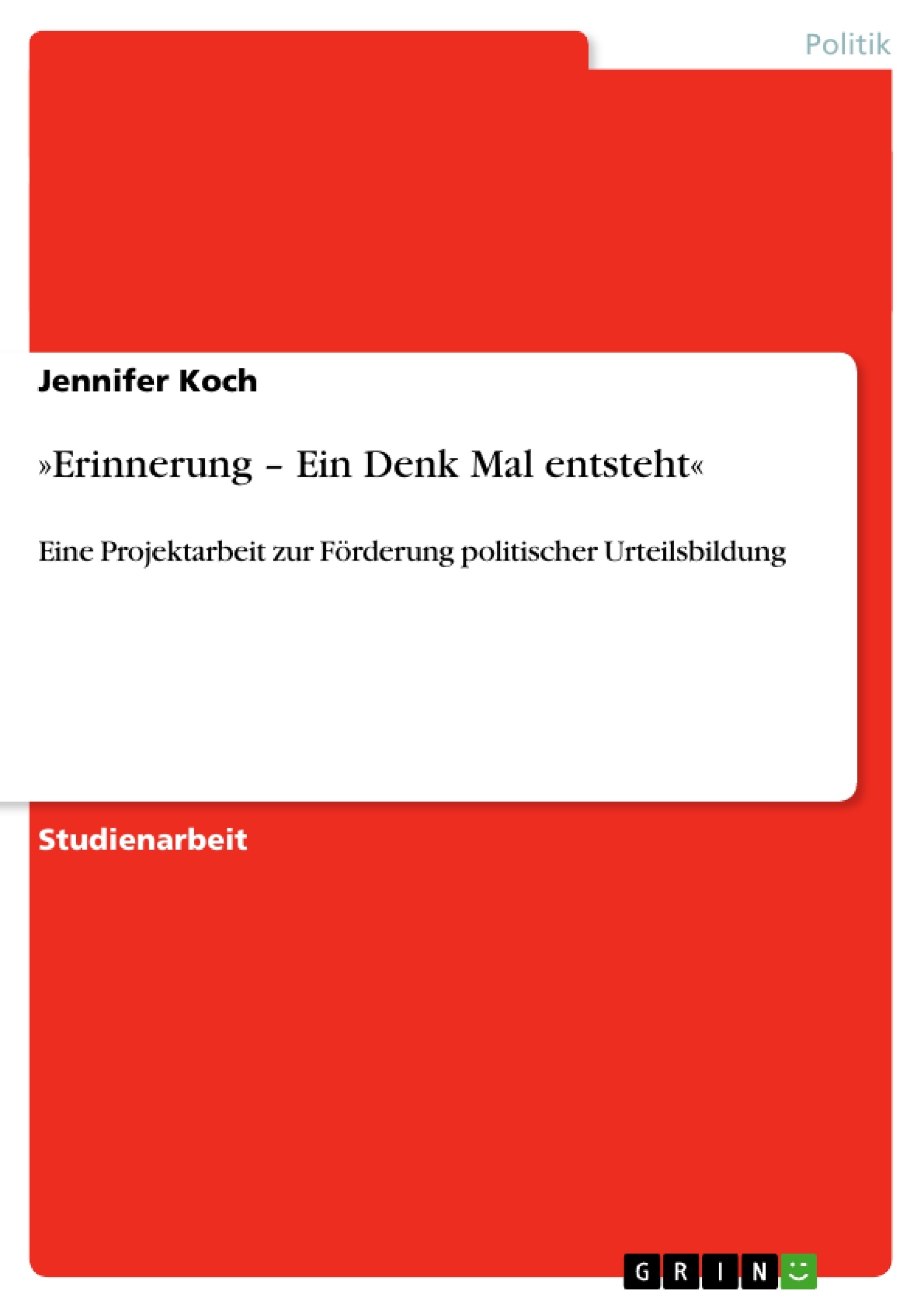Die Relevanz der Shoa für die Erziehung definierte Theodor W. Adorno in seiner Rundfunk-rede »Erziehung nach Auschwitz« (1966) auf folgende Weise: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. (…) Sie zu begründen hätte etwas Ungeheuerliches angesichts des Ungeheuerlichen, das sich zutrug.“ Eine »Erziehung nach Auschwitz« ist bis heute richtungsweisend für die Bildung und meint gewiss nicht „Aneignung von Wissen über Auschwitz“. Adorno verstand darunter vielmehr eine „Erziehung zur Mündigkeit“. Deshalb ist gerade die Institution Schule dazu angehalten, einen entscheidenden Beitrag zu Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit zu leisten.
Für die Herangehensweise an die Thematik existieren vielfältige didaktische Methoden in unterschiedlichen Schulfächern. Eine ist die der Projektarbeit. Auf der Grundlage des im Sommer 2008 durchgeführten Projekts, »Erinnerung – Ein Denk-Mal entsteht«, wird sich in dieser Arbeit der Methode des Projektunterrichts als Realisierung der politischen Urteilsbildung im Politikunterricht gewidmet werden.
Dabei erfolgt zunächst die Definition des Begriffs der politischen Urteilsbildung. Es wird nachzufragen sein, was unter einem politischen Urteil zu verstehen ist und inwieweit es von anderen Urteilen differenziert werden kann. Im Anschluss daran sollen die Kategorien des politischen Urteils erläutert und schließlich die Bedeutung der politischen Urteilsbildung für den Politikunterricht in den Fokus der Betrachtung genommen werden. In Kapitel 3 erfolgt eine Beschreibung des Projekts, »Erinnerung – Ein Denk-Mal entsteht«. Dabei werden zunächst methodisch-didaktische Vorüberlegungen angestellt. In diesen wird sich der Problematisierung der Shoa im Politikunterricht gewidmet. Daran schließt sich die Planung und Vorgehensweise der Projektphasen an. Die Analyse des Unterrichtsgegenstands sowie die Auswahl bzw. Begründung der Lernziele und Methoden wird direkt anknüpfen. Der tatsächliche Projektablauf, der in tabellarischer Form dargestellt ist, bildet den Abschluss der Ausführungen.
Inhaltsverzeichnis
1. Zu Thema und Aufgabenstellung der Arbeit
2. Theoretische Vorbetrachtung zur politischen Urteilsbildung
2.1 Was ist unter einem politischen Urteil zu verstehen?
2.2 Kategorien der politischen Urteilsbildung
2.3 Relevanz der politischen Urteilsbildung für den Politikunterricht
3. »Erinnerung - Ein Denk-Mal entsteht«. Projektarbeit zur Thematik der Shoa
3.1 Methodisch-didaktische Vorüberlegungen
3.1.1 Problematisierung des Gegenstands – Die Shoa im Politikunterricht
3.1.2 Die Vorgehensweise in den einzelnen Projektphasen
3.1.3 Die Analyse des Unterrichtsgegenstands
3.1.2.1 Die Shoa
3.1.2.2 Das Erinnern und Gedenken
3.1.4 Die Auswahl und Begründung der Lernziele
3.1.5 Die Methoden- und Medienauswahl
3.1.5.1 Der Projektunterricht
3.1.5.2 Assoziativer Bildeinstieg
3.1.5.3. Lernen am historischen Ort – Der Gedenkstättenbesuch
3.2 Praktische Umsetzung - Ablauf der Projektwoche
4. Schlussbetrachtung
5. Literaturverzeichnis.
1. Zu Thema und Aufgabenstellung der Arbeit
Die Relevanz der Shoa für die Erziehung definierte Theodor W. Adorno in seiner Rundfunkrede »Erziehung nach Auschwitz« (1966) auf folgende Weise: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. (…) Sie zu begründen hätte etwas Ungeheuerliches angesichts des Ungeheuerlichen, das sich zutrug.“[1] Eine »Erziehung nach Auschwitz« ist bis heute richtungsweisend für die Bildung und meint gewiss nicht „Aneignung von Wissen über Auschwitz“[2]. Adorno verstand darunter vielmehr eine „Erziehung zur Mündigkeit“[3]. Deshalb ist gerade die Institution Schule dazu angehalten, einen entscheidenden Beitrag zu Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit zu leisten.
Für die Herangehensweise an die Thematik existieren vielfältige didaktische Methoden in unterschiedlichen Schulfächern. Eine ist die der Projektarbeit. Auf der Grundlage des im Sommer 2008 durchgeführten Projekts, »Erinnerung – Ein Denk-Mal entsteht«, wird sich in dieser Arbeit der Methode des Projektunterrichts als Realisierung der politischen Urteilsbildung im Politikunterricht gewidmet werden.
Dabei erfolgt zunächst die Definition des Begriffs der politischen Urteilsbildung. Es wird nachzufragen sein, was unter einem politischen Urteil zu verstehen ist und inwieweit es von anderen Urteilen differenziert werden kann. Im Anschluss daran sollen die Kategorien des politischen Urteils erläutert und schließlich die Bedeutung der politischen Urteilsbildung für den Politikunterricht in den Fokus der Betrachtung genommen werden. In Kapitel 3 erfolgt eine Beschreibung des Projekts, »Erinnerung – Ein Denk-Mal entsteht«. Dabei werden zunächst methodisch-didaktische Vorüberlegungen angestellt. In diesen wird sich der Problematisierung der Shoa im Politikunterricht gewidmet. Daran schließt sich die Planung und Vorgehensweise der Projektphasen an. Die Analyse des Unterrichtsgegenstands sowie die Auswahl bzw. Begründung der Lernziele und Methoden wird direkt anknüpfen.[4] Der tatsächliche Projektablauf, der in tabellarischer Form dargestellt ist, bildet den Abschluss der Ausführungen.[5]
2. Theoretische Vorbetrachtung zur politischen Urteilsbildung
2.1 Was ist unter einem politischen Urteil zu verstehen?
Bevor politische Urteile in den Fokus der Betrachtung genommen werden, erscheint es notwendig, den Begriff Urteil zunächst zu erläutern. Peter Weinbrenner gibt in seinem Aufsatz »Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts«[6] eine gelungene Basisdefinition. Demnach sind „Urteile im weitesten Sinne […] alle Aussagen eines Individuums über Menschen und Sachen, die konstatierenden und/oder qualifizierenden Charakter haben.“[7] Ausgehend von dieser Definition urteilen Schülerinnen und Schüler offenbar in ihrer Alltagswelt zunächst auf ähnliche Weise implizit oder explizit, nämlich in Form von Urteilen beispielsweise über Hobbys, Mode, Musik oder Trends.[8] Folglich ist ein Urteil immer eine „subjektive Situationsbestimmung und Weltdeutung“[9], mit der das Individuum sein Verhältnis zur Lebenswelt ausdrückt und Position zu dieser bezieht.[10]
Die Differenz zu einem politischen Urteil besteht darin, dass diesem ferner ein Werturteil inhärent ist[11]. „Wenn wir politisch urteilen, dann beiziehen wir eine Position, dann müssen wir uns für oder gegen etwas oder gegen jemanden entscheiden, d. h., notwendigerweise Partei ergreifen.“[12] Offensichtlich beruht ein politisches Urteil auf einer „Abwägungsüberlegung […] zwischen Positionen, Individuen, Gruppen im Hinblick auf normative Ansprüche, in der Regel Gerechtigkeitsansprüche.“[13]
Dabei lassen sich Kriterien des politischen Urteilens ausmachen, die das Urteil des Individuums beeinflussen. Hierzu zählen individuelle Interessen des / der Urteilenden, induktive Wertvorstellungen, ideologische Substitute, Disposition und Vertrauen in eine politische Person sowie die subjektive Betroffenheit von der Thematik.[14]
Die politischen Urteile können aufgrund dieser Kriterien jedoch nur schwer von moralischen Urteilen differenziert werden,[15] schließlich sind Letztere ebenso „präskriptive Urteile und deren Rechtfertigung.“[16] Diesen liegen stets bestimmte Wert- und Normvorstellungen zugrunde, die allgemeingültig sind.[17] D. h., diese nehmen eine zeitliche- und räumliche Geltung in Anspruch, sodass dem moralischen Urteil „in der Regel eine implizite oder explizite Verpflichtung zum Handeln [entspricht].“[18] Daher kann das moralische Urteil als eine Sonderform bzw. Untergruppe des politischen Urteils definiert werden, das sich durch die „vier Merkmale Präskriptivität, Universalisierbarkeit, Rechtfertigungszwang und Verpflichtung zum Handeln qualifiziert.“[19]
Politische Urteile bedürfen jedoch eines Motivationsanstoßes. Hiefür fungiert der Konflikt meist als Motor. Diese Funktion des Konflikts kann sich auch im politischen Unterricht zunutze gemacht werden. Immerhin kann dieser in verschiedenen Erscheinungsformen auftreten,[20] sodass er sich hervorragend für die politische Urteilsbildung innerhalb des politischen Lernens eignet.[21]
2.2 Kategorien der politischen Urteilsbildung
Die Realisierung und die Qualität des politischen Urteils sind von sechs Kategorien abhängig. Deren Signifikanz lässt sich aus folgender Maxime ableiten: „Je mehr die [folgenden Kategorien] im individuellen Prozeß der politischen Urteilsbildung berücksichtigt, d. h. reflektiert und integriert werden, desto qualifizierter, komplexer und differenzierter ist das politische Urteil.“[22] Signifikanz und Qualität des Urteils hängen also von der Anzahl der in den Urteilsprozess einfließenden Kategorien und deren Beschaffenheit ab.
Die erste Kategorie ist die des Wissens um Fakten. Schließlich ist ein politisches Urteil nur mit entsprechendem Wissen und Kenntnissen über einen Sachverhalt, ein Ereignis oder eine Person möglich.[23] Wissen steht allerdings nicht isoliert als lexikalisches Wissen zur Verfügung, sondern dieses ist in mannigfach differenzierten Formen und Wissensstrukturen integriert und im mentalen Gedächtnis gespeichert.[24] Kurzum, Wissen ist „kontextgebunden“[25] und muss in „übergreifende Strukturen und Sinnzusammenhänge eingebettet werden.“[26] Nur auf diese Weise ist es dem Individuum zugänglich.[27] Korrektes Wissen allein genügt jedoch nicht für eine politische Urteilsbildung, da politischen Urteilen, wie bereits ausgeführt wurde, stets auch Wertentscheidungen inhärent sind.[28]
„Die subjektiven Wertsetzungen sind im Grunde Gefühlsregungen mit dem Anspruch auf allgemeine Geltung.“[29] Deshalb versucht das Individuum mit moralischen Urteilen seine persönlichen Werte zu abstrahieren, aber auch anderen aufzuerlegen und dabei parallel zu fundieren.[30] Auch wenn Werte „nicht verifizierbar oder falsifizierbar [sind], [haben sie] als metaphysische Aussagen […] nichts mit wissenschaftlicher Wahrheit zu tun, sie sind einfach psychische Gegebenheiten.“[31] Dabei sind Werte dennoch entscheidend für die Qualität des politischen Urteils hinsichtlich der Frage nach „apodiktische[r] oder […] konsensuelle[r] Wertvorstellung [in dem Urteil].“[32] Apodiktisch meint, dass diese Wertvorstellungen als absolut, bindend und allgemeingültig angesehen werden.[33] Konsensuell verweist darauf, dass diese Wertvorstellungen „kommunikativ vermittelt, argumentativ begründet und als Ergebnis eines Konsensbildungsprozesses aller Beteiligten und Betroffenen freiwillig anerkannt werden.“[34] So lässt sich durchaus konstatieren, dass die vorhandene Einstellungs- bzw. Wertevariable des Individuums für das politische Urteil essenzieller ist, als die des Wissens.[35]
Diese Wissens- und Wertvariablen erfordern allerdings einer Integration in eine übergeordnete Sinnrelation.[36] Diese Sinnrelation muss dem Individuum mittels einer entsprechenden „Kategorien- und Theorien[variable] als Deutungsmuster“[37] vermittelt werden. Deshalb bedarf das Individuum für die Konfrontation mit seiner Umwelt „insofern einer organisierten Vorstellung und Strukturierung.“[38] Diesem Prozess liegt eine Sozialtheorie zugrunde, die es dem Individuum ermöglicht, „eine Konzeptualisierung der jeweiligen Situation, also die ‘Bildung von Interpretationsschemata für die inneren Zusammenhänge zwischen individuellem Handeln und sozialem System’“[39] herzustellen. Derartige „sinnstiftende[…] Kategorien [können] Interesse, Ideologie, Verantwortung, Menschenwürde, Zumutbarkeit, Legitimität, Gemeinwohl, Wirksamkeit, Folgen [sowie] Verantwortlichkeit [sein]“[40].
Doch dies allein genügt für eine Urteilsbildung nicht. So muss nach der Theorie Sutors der Urteilsbildung stets eine Situations- und Möglichkeitserörterung vorausgehen.[41] Gemäß dessen Ansicht basiert ein Urteil auf notwendigen Grundlagen. Zum einen zählt er hierzu die individuellen Interessen und Bedürfnisse des Einzelnen aber auch das Gemeinwohl im Hinblick auf den Konflikt.[42] Zum anderen haben die Bürger natürlich gewisse Grenzen ihrer Belastbarkeit hinsichtlich dem, was ihnen zugemutet werden kann.[43] Weitere Variablen nach Sutor sind die „Lösbarkeit des Konflikts innerhalb des dafür vorgesehenen gesetzlichen Rahmens“[44] und abschließend die Evolution eigener Lösungsanregungen bzw. Positionen hinsichtlich des Konflikts. Hierzu zählt auch das Abwägen möglicher Konsequenzen von getroffenen Entscheidungen.[45] Der Konflikt fungiert auch in der Theorie Sutors als die „zentrale Urteilskategorie“[46] des politischen Urteils. Demnach vollzieht sich „politische Urteilsbildung [stets] im Spannungsfeld von Konflikt und Konsens.“[47]
Im Prozess der Urteilsentwicklung spielt auch die Variable der Disposition eine entscheidende Rolle, denn „die subjektiven Verarbeitungsmuster der Schülerinnen und Schüler [sind] von den bereits ausgebildeten Verhaltensdispositionen, insbesondere den psychischen Voraussetzungen abhäng[ig].“[48] Die Schülerinnen und Schüler sind eben keine tabula rasa,[49] sondern ihr Urteil verändert sich, hinsichtlich der Entwicklungsstruktur, in dem Sinne, dass alte Strukturen durch neue erweitert werden, indem „jeweils die neuen Elemente der einzelnen Variablen integriert bzw. ausgesondert werden.“[50]
Wie neue Urteile integriert werden, hängt von den bereits ausgebildeten Verhaltensdispositionen und Grundqualifikationen ab. Auch die Qualität des politischen Urteils wird von diesen Dispositionen bedingt, sodass das Urteil einen entsprechend „hohen Grad an Integration, Differenzierung und Komplexität aufweist.“[51]
[...]
[1] Zitiert nach BpB (Hrsg.) Erinnern und Verschweigen, S. 1.
[2] Ehmann, Annegret/Rathenow, Hans-Fred, Nationalsozialismus und Holocaust in der Historisch-politischen Bildung, in: Brinkmann, Annette (Hrsg.), Lernen aus der Geschichte. Projekte zu Nationalsozialismus und Holocaust in Schule und Jugendarbeit, Bonn 2000, S. 26.
[3] Ebd., S. 26.
[4] Bei der Diskussion der Methoden ist darauf hinzuweisen, dass sich im Rahmen dieser Arbeit nur auf drei ausgewählte Methoden beschränkt werden kann.
[5] Der Projektablauf kann, wenn es gewünscht wird, zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit den Arbeitsergebnissen digital nachgereicht werden.
[6] Vgl. Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing, Peter/Weißeno, Georg (Hrsg.), Politische Urteilsbildung. Zentrale Aufgabe für den Politikunterricht (=Reihe Politik und Bildung, Bd. 12), Schwalbach 1997, S. 73.
[7] Ebd., S. 74.
[8] Vgl. Kuhn; Hans-Werner, Problemskizze. Politische Urteilsbildung in der fachdidaktischen Diskussion, in: Kuhn, Hans-Werner (Hrsg.), Urteilsbildung im Politikunterricht. Ein multimediales Projekt (=Reihe Politik und Bildung, Bd. 21), Schwalbach/Ts. 2003, S. 12.
[9] Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S.74.
[10] Vgl. Ebd., S. 74.
[11] Vgl Ebd., S. 74.
[12] Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S.74.
[13] Ebd., S.74.
[14] Vgl. Kuhn; Hans-Werner, Problemskizze, in: Kuhn (Hrsg.), Urteilsbildung im Politikunterricht, S. 12.
[15] Vgl. Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S.75.
[16] Ebd., S. 75.
[17] Vgl. Ebd., S. 75.
[18] Ebd., S. 75.
[19] Ebd., S. 75.
[20] Denkbar wäre ein Dilemma, Paradoxon oder einfach als Konflikt hinsichtlich von Prinzipien. Vgl. hierzu auch Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S. 74.
[21] Vgl. Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S.74.
[22] Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S. 76.
[23] Vgl. Ebd., S. 76.
[24] Vgl. Ebd., S. 77.
[25] Ebd., S. 77.
[26] Ebd., S. 77.
[27] Vgl. Ebd., S. 77.
[28] Vgl. Ebd., S. 77.
[29] Ebd., S. 77.
[30] Vgl. Ebd., S. 77.
[31] Ebd., S. 77.
[32] Ebd., S. 78.
[33] Vgl. Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S. 78.
[34] Ebd., S. 78.
[35] Vgl. Ebd., S. 77.
[36] Vgl. Ebd., S. 78-79.
[37] Ebd., S. 79.
[38] Ebd., S. 79.
[39] Ebd., S. 79.
[40] Ebd., S. 79.
[41] Vgl. Ebd., S. 79.
[42] Vgl. Ebd., S. 79.
[43] Vgl. Ebd., S. 79.
[44] Ebd., S. 79.
[45] Vgl. Weinbrenner, Peter, Politische Urteilsbildung als Ziel und Inhalt des Politikunterrichts, in:Massing/Weißeno (Hrsg.), Politische Urteilsbildung, S. 79.
[46] Ebd., S. 79.
[47] Ebd., S. 79.
[48] Ebd., S. 79.
[49] Vgl. Ebd., S. 79
[50] Ebd., S. 79.
[51] Ebd., S. 80.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Erziehung nach Auschwitz“ laut Adorno?
Nach Adorno ist die Forderung, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, die allererste an die Erziehung. Es geht dabei um eine „Erziehung zur Mündigkeit“ statt reiner Wissensaneignung.
Was versteht man unter politischer Urteilsbildung?
Es ist die Fähigkeit, Position zu politischen Sachverhalten zu beziehen, wobei dem politischen Urteil im Gegensatz zum Alltagsurteil immer ein Werturteil inhärent ist.
Welche Kategorien beeinflussen die Qualität eines politischen Urteils?
Wichtige Kategorien sind Faktenwissen, subjektive Wertsetzungen, Sinnrelationen (Deutungsmuster) sowie die Fähigkeit zur argumentativen Begründung.
Warum ist Projektarbeit für die Thematik der Shoa geeignet?
Projektarbeit ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung, wie z.B. das Lernen an historischen Orten (Gedenkstättenbesuche), was die politische Urteilsbildung fördert.
Was ist der Unterschied zwischen einem politischen und einem moralischen Urteil?
Moralische Urteile sind eine Sonderform politischer Urteile, die durch Merkmale wie Präskriptivität, Universalisierbarkeit und Rechtfertigungszwang gekennzeichnet sind.
- Quote paper
- Jennifer Koch (Author), 2009, »Erinnerung – Ein Denk Mal entsteht« , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135907