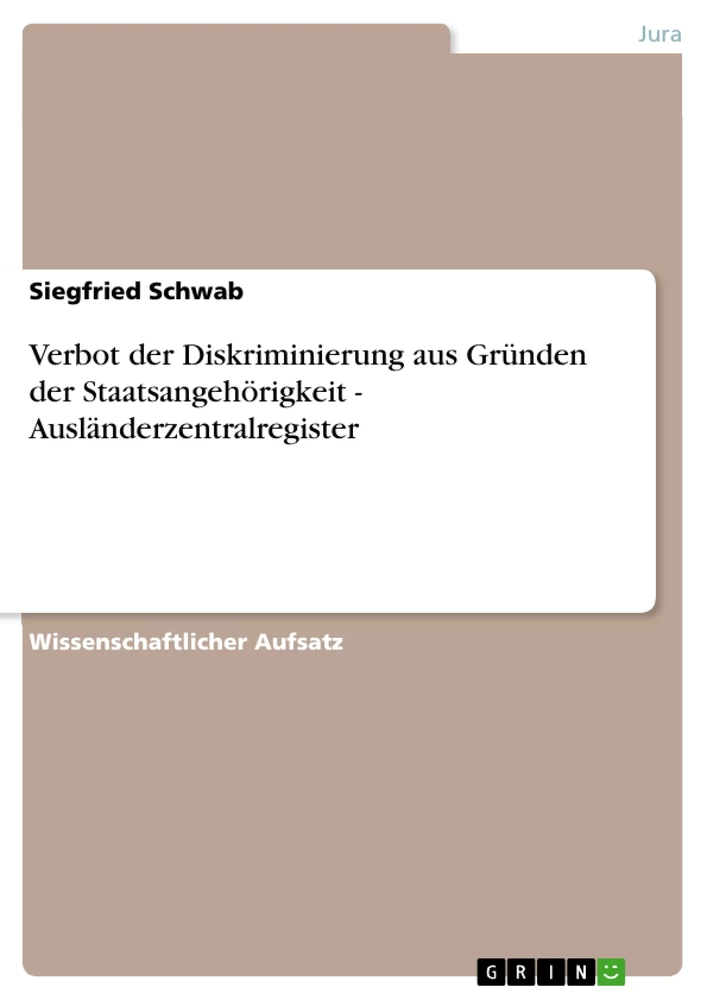Ein System zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Unionsbürgern, die keine Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats sind, wie das System, das mit dem Gesetz über das Ausländerzentralregister vom 02.09.1994 in der Fassung des Gesetzes vom 21.06.2005 eingerichtet wurde und das die Unterstützung der mit der Anwendung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften betrauten nationalen Behörden bezweckt, entspricht nur dann dem im Licht des Verbots jeder Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ausgelegten Erforderlichkeitsgebot gem. Art. 7 lit. e der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, wenn es nur die Daten enthält, die für die Anwendung der entsprechenden Vorschriften durch die genannten Behörden erforderlich sind, und sein zentralisierter Charakter eine effizientere Anwendung dieser Vorschriften in Bezug auf das Aufenthaltsrecht von Unionsbürgern erlaubt, die keine Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats sind.
Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Ausländerzentralregister (AZRG) führt das Bundesamt, das dem Bundesministerium des Inneren unterstellt ist, das Ausländerzentralregister (AZR), ein zentrales Register, in dem bestimmte personenbezogene Daten u.a. derjenigen Ausländer zusammengefasst werden, die sich nicht nur vorübergehend im deutschen Hoheitsgebiet aufhalten. Wie sich aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern vom 4. 6. 1996 zum AZRG und zur AZRG-Durchführungsverordnung ergibt, werden diejenigen Ausländer erfasst, die sich für einen Zeitraum von über drei Monaten in diesem Hoheitsgebiet aufhalten. Die entsprechenden Informationen werden in zwei getrennt geführten Datenbeständen zusammengefasst. Ein Datenbestand enthält die personenbezogenen Daten von Ausländern, die in Deutschland leben oder gelebt haben, der andere die personenbezogenen Daten von Ausländern, die ein Visum beantragt haben.
Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit - Ausländerzentralregister[1]
Ein System zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Unionsbürgern, die keine Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats sind, wie das System, das mit dem Gesetz über das Ausländerzentralregister vom 02.09.1994 in der Fassung des Gesetzes vom 21.06.2005 eingerichtet wurde und das die Unterstützung der mit der Anwendung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften betrauten nationalen Behörden bezweckt, entspricht nur dann dem im Licht des Verbots jeder Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ausgelegten Erforderlichkeitsgebot gem. Art. 7 lit. e der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, wenn es nur die Daten enthält, die für die Anwendung der entsprechenden Vorschriften durch die genannten Behörden erforderlich sind, und sein zentralisierter Charakter eine effizientere Anwendung dieser Vorschriften in Bezug auf das Aufenthaltsrecht von Unionsbürgern erlaubt, die keine Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats sind.
Jedenfalls lassen sich die Speicherung und Verarbeitung von namentlich genannte Personen betreffenden personenbezogenen Daten im Rahmen eines Registers wie des Ausländerzentralregisters zu statistischen Zwecken nicht als erforderlich i. S. von Art. 7 lit. e der Richtlinie 95/46/EG ansehen.
Art. 12 Abs. 1 EG ist dahin auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat verwehrt, zur Bekämpfung der Kriminalität ein System zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu errichten, das nur Unionsbürger erfasst, die keine Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats sind.
Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Ausländerzentralregister (AZRG) führt das Bundesamt, das dem Bundesministerium des Inneren unterstellt ist, das Ausländerzentralregister (AZR), ein zentrales Register, in dem bestimmte personenbezogene Daten u.a. derjenigen Ausländer zusammengefasst werden, die sich nicht nur vorübergehend im deutschen Hoheitsgebiet aufhalten. Wie sich aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern vom 4. 6. 1996 zum AZRG und zur AZRG-Durchführungsverordnung ergibt, werden diejenigen Ausländer erfasst, die sich für einen Zeitraum von über drei Monaten in diesem Hoheitsgebiet aufhalten. Die entsprechenden Informationen werden in zwei getrennt geführten Datenbeständen zusammengefasst. Ein Datenbestand enthält die personenbezogenen Daten von Ausländern, die in Deutschland leben oder gelebt haben, der andere die personenbezogenen Daten von Ausländern, die ein Visum beantragt haben.
Herr Huber, ein österreichischer Staatsangehöriger, ließ sich 1996 in Deutschland nieder, um dort den Beruf des selbstständigen Versicherungsagenten auszuüben. Über ihn sind zahlreiche persönliche Daten im Ausländerzentralregister gespeichert. Er sieht sich durch die Verarbeitung der ihn betreffenden Daten im AZR insbesondere deshalb diskriminiert, weil es keine entsprechende Datenbank für deutsche Staatsangehörige gibt. Deshalb beantragte er am 22.07.2000 die Löschung dieser Daten. Am 29.09.2000 lehnte die seinerzeit für die Führung des AZR zuständige Behörde diesen Antrag ab. Widerspruch und Klage blieben erfolglos.
Das OVG NRW hat beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Ist die generelle Verarbeitung personenbezogener Daten ausländischer Unionsbürger in einem zentralen Fremdenregister vereinbar mit dem Verbot einer an die Staatsangehörigkeit anknüpfenden Diskriminierung von Unionsbürgern, die ihr Recht ausüben, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (Art. 12 Abs. 1 EG i.V. mit Art. 17 EG und Art. 18 Abs. 1 EG)?
2. Ist eine solche Verarbeitung vereinbar mit dem Verbot einer Beschränkung der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats (Art. 43 Abs. 1 EG)?
3. Ist eine solche Verarbeitung vereinbar mit dem Erforderlichkeitsgebot des Art. 7 lit. e der Richtlinie 95/46/EG?
Die Daten, die das AZR nach den Angaben in der Vorlageentscheidung über Herrn Huber enthält, sind personenbezogene Daten i. S. von Art. 2 lit. a der Richtlinie 95/46/EG[2], da es sich um „ Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person“ handelt. Ihre Erhebung, Aufbewahrung und Übermittlung durch die mit der Führung des Registers, in dem sie zusammengefasst sind, betraute Stelle sind daher eine „Verarbeitung personenbezogener Daten“ i. S. von Art. 2 lit. b dieser Richtlinie. Allerdings nimmt Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 95/46/EG von deren Anwendungsbereich ausdrücklich u. a. Verarbeitungen personenbezogener Daten aus, die die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die Sicherheit des Staates und die Tätigkeiten des Staates im strafrechtlichen Bereich betreffen.[3] Wenn somit die Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Anwendung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften und zu statistischen Zwecken in den Anwendungsbereich der Richtlinie 95/46/EG fällt, so gilt dies nicht für die Verarbeitung solcher Daten mit dem Ziel der Bekämpfung der Kriminalität. Folglich ist die Gemeinschaftsrechtskonformität der Verarbeitung personenbezogener Daten in einem Register wie dem AZR zum einen im Hinblick auf ihre Funktion der Unterstützung der mit der Anwendung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften betrauten Behörden und ihre Nutzung zu statistischen Zwecken am Maßstab der Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG und - angesichts der dritten Vorlagefrage - insbesondere des in Art. 7 lit. e dieser Richtlinie niedergelegten Erforderlichkeitserfordernisses, so wie es im Licht der Gebote des Vertrags, darunter insbesondere des Verbots jeder Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit nach Art. 12 Abs. 1 EG[4], auszulegen ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Funktion zur Bekämpfung der Kriminalität am Maßstab des Gemeinschaftsprimärrechts zu überprüfen.
[...]
[1] EuGH, Urteil vom 16.12.2008 - C 524/06, NVwZ 2009, 379ff mit vertiefenden Hinweisen und Anmerkungen von Prof. Dr. Dr. Siegfried Schwab, Mag. rer. publ. unter Mitarbeit von Diplom-Betriebswirtin (BA) Silke Schwab.
[2] Artikel 2 - Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie, Amtsblatt Nr. L 281 vom 23/11/1995 S. 31-50, bezeichnet der Ausdruck
a) "personenbezogene Daten" alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person ("betroffene Person"); als bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind;
b) "Verarbeitung personenbezogener Daten" ("Verarbeitung") jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Speichern, die Organisation, die Aufbewahrung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Benutzung, die Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der Bereitstellung, die Kombination oder die Verknüpfung sowie das Sperren, Löschen oder Vernichten;
c) "Datei mit personenbezogenen Daten" ("Datei") jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, gleichgültig ob diese Sammlung zentral, dezentralisiert oder nach funktionalen oder geographischen Gesichtspunkten aufgeteilt geführt wird;
d) "für die Verarbeitung Verantwortlicher" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften festgelegt, so können der für die Verarbeitung Verantwortliche bzw. die spezifischen Kriterien für seine Benennung durch einzelstaatliche oder gemeinschaftliche Rechtsvorschriften bestimmt werden;
e) "Auftragsverarbeiter" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet;
f) "Dritter" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die Daten zu verarbeiten;
g) "Empfänger" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die Daten erhält, gleichgültig, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines einzelnen Untersuchungsauftrags möglicherweise Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger;
h) "Einwilligung der betroffenen Person" jede Willensbekundung, die ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt und mit der die betroffene Person akzeptiert, dass personenbezogene Daten, die sie betreffen, verarbeitet werden.
[3] (Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Ausübung von Tätigkeiten erfolgt, die nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen, beispielsweise Tätigkeiten gemäß den Titeln V und VI des Vertrags über die Europäische Union, und auf keinen Fall auf Verarbeitungen betreffend die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die Sicherheit des Staates (einschließlich seines wirtschaftlichen Wohls, wenn die Verarbeitung die Sicherheit des Staates berührt) und die Tätigkeiten des Staates im strafrechtlichen Bereich;
[4] Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Vertrags ist in seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten, Art. 12 Abs. 1 EGV. Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 251 Regelungen für das Verbot solcher Diskriminierungen treffen.
Artikel 12 Abs. 1 enthält jetzt das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, das früher in Artikel 7 Absatz 1 EWG-Vertrag gestanden hat. Dieses Verbot hat nun auch in Artikel 21 Absatz 2 der in Nizza feierlich proklamierten Grundrechtscharta seinen Niederschlag gefunden, ABl. 2000 Nr. C 364 S. 1)
Das Diskriminierungsverbot ist ein Strukturprinzip der Gemeinschaft und erfüllt zugleich die Funktion, den einzelnen rechtlichen Schutz angedeihen zu lassen. Es stellt eine Ausprägung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dar, EuGH – Hochstrass/EuGH, 147/79 – Slg. 1980, 3005 (3019); kritisch Rossi, in: EUR 2000, S. 197) Der Vertrag von Amsterdam hat in Artikel 13 weitere Diskriminierungsverbote vorgesehen. Deren Konkretisierung ist von Umsetzungsakten des Rates abhängig, Rossi, in: EUR 2000, S. 197; Zuleeg, in: von der Groeben/Schwarze, EU-/EGV-Kommentar, Art. 12, RN 4. Art. 12 EGV geht über den Gedanken des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes hinaus. Er knüpft das Diskriminierungsverbot an ein verbotenes Unterscheidungsmerkmal, die Staatsangehörigkeit an. Insoweit handelt es sich um ein absolutes Diskriminierungsverbot, Bei unmittelbarer Diskriminierung nimmt auch von Bogdandy in: Grabitz/Hilf, EU-Kommentar, Art. 6 EGV RN 23, ein absolutes Diskriminierungsverbot an; ebenso Epiney in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV-Kommentar, Art. 12 EGV, RN 39 bei “formellen” Diskriminierungen. Nur zwingende Ausnahmegründe können dieses Verbot noch einschränken.
Der EuGH betrachtet das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit lediglich als besondere Ausformung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Danach dürfen vergleichbare Lagen nicht unterschiedlich behandelt werden, soweit eine Differenzierung nicht objektiv gerechtfertigt ist, EuGH – Hochstrass/EuGH, 147/79 – Slg. 1980, 3005 (3019). Das Verbot des Artikels 12 Abs. 1 ist danach lediglich als relatives Diskriminierungsverbot einzuordnen. Eine Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit allein genügt für das Verbot nicht, weil eine Rechtfertigung für eine Differenzierung bestehen kann, Epiney, Art. 12 EG, RN 42; Epiney, Diskriminierungen S. 94–100; Kischel, in: EuGRZ 1997, S. 1 (5). Gegen das Diskriminierungsverbot wird allerdings dann verstoßen, wenn eine Ungleichbehandlung willkürlich ist, EuGH – Merkur/Kommission, 43/72 – Slg. 1973, 1055 (1074), wo das einschlägige Diskriminierungsverbot allerdings nicht näher bezeichnet wird. Allein nachvollziehbare sachliche Gründe reichen nicht, um eine willkürliche Entscheidung auszuscheiden. Es muss vielmehr eine Güter- und Interessenabwägung im Lichte der Vertragsziele erfolgen, Zuleeg, a.a.O., RN 3. Der EuGH betont, dass Artikel 12 Absatz 1 nicht nur offene, sondern auch versteckte Diskriminierungen erfasst, EuGH – Pastoors und Trans-Cap, C-29/95 - Slg. 1997, I-285 (306); Ebenso Epiney, Diskriminierungen, S. 103–110; dies . Art. 12 EG RN 13; von Bogdandy, Art. 6 EGV, RN12 ff. Verboten sind deshalb alle Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale als dem der Staatsangehörigkeit tatsächlich zum gleichen Ergebnis führen, EuGH – Boussac/Gerstenmeier, 22/80 – Slg. 1980, 3427 (3436). Diese Auslegung ergibt sich schon aus dem Wortlaut des Artikels 12 (“ jede Diskriminierung”) und folgt aus der Orientierung an dem "effet utile" der Norm, Epiney, Art. 12 RN 15. Eine derart weit gefasste Auslegung ist geboten, um die Wirksamkeit eines der Grundprinzipien der Gemeinschaft zu wahren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ausländerzentralregister (AZR)?
Das AZR ist ein zentrales Register in Deutschland, in dem personenbezogene Daten von Ausländern gespeichert werden, die sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten.
Warum klagte Herr Huber gegen das AZR?
Der österreichische Staatsangehörige sah sich diskriminiert, da seine Daten zentral gespeichert wurden, während es für deutsche Staatsangehörige keine vergleichbare Datenbank gibt.
Was entschied der EuGH zum Thema Diskriminierung im AZR?
Der EuGH urteilte, dass ein solches System nur dann zulässig ist, wenn es für aufenthaltsrechtliche Zwecke erforderlich ist. Eine Speicherung allein zur Kriminalitätsbekämpfung nur für EU-Ausländer ist diskriminierend.
Ist die Datennutzung zu statistischen Zwecken im AZR erlaubt?
Nach Ansicht des EuGH ist die Speicherung namentlich genannter personenbezogener Daten allein zu statistischen Zwecken nicht als erforderlich anzusehen.
Welche Rolle spielt die Richtlinie 95/46/EG?
Diese Richtlinie regelt den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und setzt das Erforderlichkeitsgebot für staatliche Register fest.
- Citation du texte
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Auteur), 2009, Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit - Ausländerzentralregister, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136266