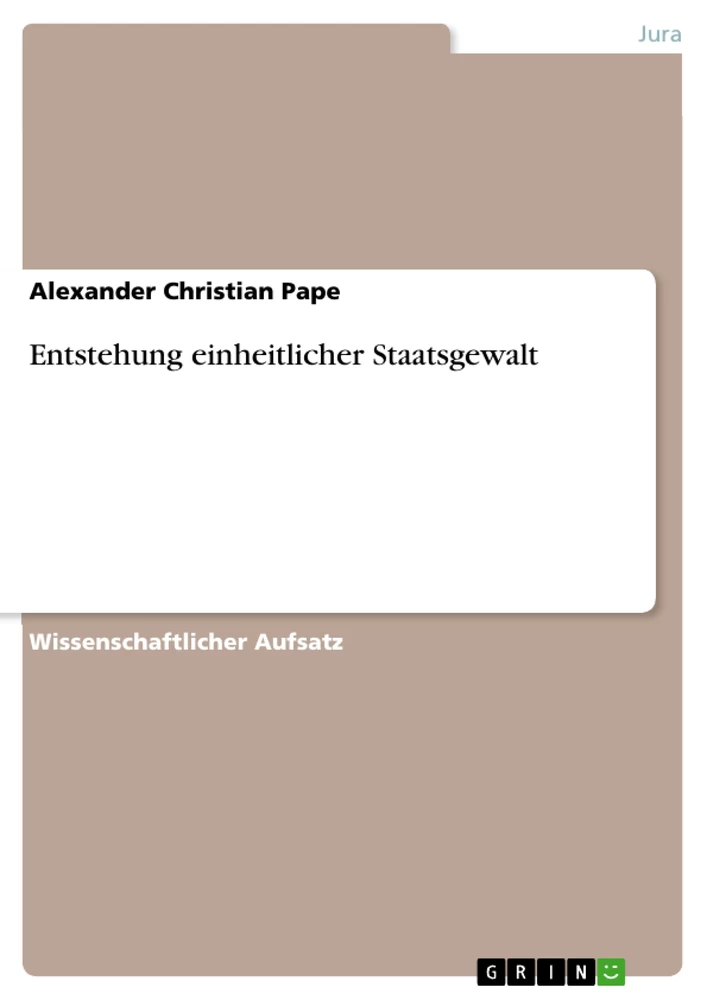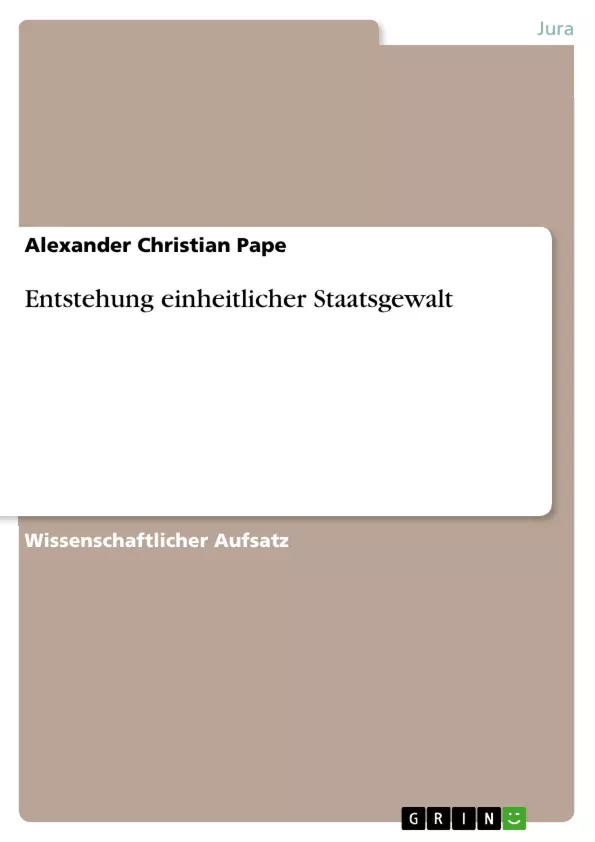Einführung
Im Rahmen einer globalisierten Welt und einer zunehmenden Vernetzung auf wirtschaftlicher, sozialer und politischer Ebene scheint die Bedeutung von Staaten stetig an Bedeutung zu verlieren, was paradox klingt, da das europäische Modell dieses Ordnungsprinzips mittlerweile den kompletten Erdball bedeckt. Die Vereinten Nationen haben mittlerweile 193 souveräne Staaten anerkannt. Eine genaue und umfassende Definition des Begriffes „Staat“ ist bislang jedoch nicht erfolgt, da unter mehreren Wissenschaftsdisziplinen unzählige verschiedene Herangehensweisen existieren...
Einführung
Im Rahmen einer globalisierten Welt und einer zunehmenden Vernetzung auf wirtschaftlicher, sozialer und politischer Ebene scheint die Bedeutung von Staaten stetig an Bedeutung zu verlieren, was paradox klingt, da das europäische Modell dieses Ordnungsprinzips[1] mittlerweile den kompletten Erdball bedeckt. Die Vereinten Nationen haben mittlerweile 193 souveräne Staaten anerkannt. Eine genaue und umfassende Definition des Begriffes „Staat“ ist bislang jedoch nicht erfolgt, da unter mehreren Wissenschaftsdisziplinen unzählige verschiedene Herangehensweisen existieren. Arthur Benz hat in seinem Werk „Der moderne Staat“ mit der institutionsorientierten, funktionsorientierten, handlungsorientierten und der mittelorientierten Definition des Staatsbegriffs vier Hauptgruppen unterschieden.[2] Eine populäre und aus dem Bereich der Staatslehre stammende Erläuterung ist die sogenannte „Drei-Elementen-Lehre“ nach Georg Jellinek, die den „Staat“ als institutionelle Einheit von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt betrachtet und somit soziale, territoriale und organisatorisch-instrumentelle Aspekte miteinbezieht.[3] Als ein wichtiges Indiz moderner Staatlichkeit wird hierbei die souveräne Staatsgewalt betrachtet, die „ (a) nach innen das Monopol legitimer physischer Gewaltanwendung bedeutet, (b) nach außen die rechtliche Unabhängigkeit von anderen Instanzen.“[4] Das Wachstum von einem mittelalterlichen Vorläufer zentraler Staatsgewalt bis hin zu einem mittlerweile fast übermächtigen Staat stellte sich als langwieriger Prozess dar.
Historische Entwicklung vor dem Absolutismus
Die Ursprünge des Gedankengebildes eines modernen Staatsbegriffes liegen im Europa des 17. Jahrhunderts in der Epoche des Absolutismus, wenngleich die historische Entwicklung ab dem Jahre 1000 berücksichtigt werden sollte. Das feudalistische Herrschaftssystem des Mittelalters zeichnete sich durch das „Fehlen einer zentralen Führung, durch eine kleinräumige Organisation der Herrschaftsverhältnisse und eine ausgeprägte Informalisierung aus“[5] Es existierte kein eindeutig hierarchisch gegliedertes Herrscherverhältnis, da zwischen König und Vasallen ein Abhängigkeitsverhältnis mit wechselseitiger Kontrolle bestand. Aufgrund des Umstandes, dass die Machtverhältnisse aufgeteilt waren, kann von einer „Gewaltenteilung“[6] gesprochen werden, da Landesherren und Ritter über eigenständige Herrscherrechte verfügten. Die Aufteilung der Machtverhältnisse führte aber stärker zu einer Hemmung ausführender Organe, da die Kompetenzen nicht klar verteilt waren. Durch die enge Vernetzung untereinander und die damit verbundene Einschränkung in der Machtausübung der Fürsten wurde der Aufbau ergiebiger Verwaltungsinstitutionen unterbunden, der Dualismus zwischen Fürsten und Ständen jedoch verstärkt. Aufgrund der wirtschafts- und machtpolitischen internen Konflikte und der hinzukommenden äußeren Veränderungen, wie beispielweise dem Aufkommen der Dreifelderwirtschaft, verlor die Feudalgesellschaft zunehmend an Relevanz.[7]
Abgelöst wurde diese von dem sogenannten Ständestaat, der sich in zwei bedeutenden Punkten von den feudalen Ordnungsmerkmalen unterschied. Zum einen wurden die persönlichen Vertragsbindungen durch unpersönliche Körperschaften abgelöst, zum anderen entwickelten sich Ämtersysteme, was zu einer schrittweisen Institutionalisierung von Herrschaft führte.[8] Indem Amt und Person voneinander getrennt werden sollten, trat eine elementare Veränderung in der Gestaltung von Machtausübung ein, die sich in der Repräsentation bestimmter Legislativ- oder Exekutivaufgaben widerspiegelten. Ähnlich wie im Feudalsystem findet man in der ständischen Herrschaftsordnung Kompetenz- und Herrschaftsvernetzungen, die mit einer Aufteilung von Gewalt verbunden waren, entweder zwischen König, Adel, Klerus und Bauern oder zwischen Kaiser und Landesfürsten. Herrschaftsausübung war also dementsprechend nur in Kooperation, meist in Versammlungen, wie den Reichstagen, möglich. Sowohl durch Interessenkonflikte, als auch durch die Zerstückelung der Herrschaftsgebiete wirkte sich diese Form der Machtausübung für die Regenten negativ aus. Besonders in den Phasen der Glaubenskriege, speziell im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges, wurde eine Konzentration der Herrschaftsbefugnisse immer unumgänglicher, da die vorhanden ständischen Strukturen allein nicht mehr ausreichend waren, um der Bevölkerung Sicherheit zu geben und Frieden zu erhalten.[9]
Zentralisierung im Absolutismus
Der mittelalterliche Machthaber bezog seine Legitimation aus „fremden“ Quellen, nämlich durch eine von der Kirche befürwortete, damit sakrale, Position. Dadurch war diese von außen leicht angreifbar und potenziell gefährdet.[10] Durch die voranschreitende Reformation in Europa und den damit einhergehenden massiven Einflussverlust der römisch-katholischen Kirche gewannen die weltlichen Monarchen an Macht. Zwar wurde die Berufung auf die göttliche Legitimation noch nicht verworfen, aber die weltlichen Herrscher haben an Unabhängigkeit gewonnen. Auf diesem Nährboden der Geschichte entwickelte sich in Europa ein Staatengebilde, das in Frankreich seine Reinform entwickelte und das wir heute ‚Absolutismus‘ nennen. Dieses zeichnete sich vor allem durch eine enorme Machtkonzentration auf den Monarchen aus. Dieser besaß ein Gewaltmonopol, das ihn ermächtigt Gesetze zu erlassen, Steuern zu erheben und außenpolitische Maßnahmen eigenmächtig durchzuführen. Zu seinen elementaren Machtmitteln gehörten ein stehendes Heer, ein gewaltiger bürokratischer Verwaltungsapparat sowie gerichtliche Institutionen, die alleinige Befugnis zu Rechtsentscheidungen erhielten. Somit vereinigte er alle modernen staatlichen Gewalten in Form von Legislative, Exekutive und Judikative auf sich.[11] Weitere Stützen der Macht waren für den Herrscher die Staatskirche sowie der Merkantilismus, der als eigenes Wirtschaftssystem die Konsolidierung des Staatshaushaltes als oberstes Ziel besaß. Der Staat wird zum Lenker wirtschaftlicher und sozialer Prozesse, er „übernahm Versorgungsaufgaben, sorgte für die Entwicklung der Wirtschaft (Merkantilismus) und griff bei sozialen Problemen regulierend ein (Armenfürsorge und Armenrecht).“[12]
[...]
[1] Reinhard, Wolfgang: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2002, S. 15.
[2] Vgl. Benz, Arthur: Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse, Oldenbourg 2001, S. 70ff.
[3] Vgl. ebd., S.70.
[4] Reinhard, Wolfgang: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2002, S. 16.
[5] Benz, Arthur: Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse, Oldenbourg 2001, S. 11.
[6] Hiermit ist nicht das heutige Verständnis von einer zentrierten Staatsgewalt mit einheitlichem Gewaltmonopol und einer Verteilung auf mehrere Staatsorgane gemeint, sondern eine Verschachtelung verschiedener Machtträger, die die Handlungsfähigkeit des Regenten erschwerte.
[7] Vgl. Benz, Arthur: Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse, Oldenbourg 2001, S. 13.
[8] Vgl. ebd., S 14.
[9] [9] Vgl. Benz, Arthur: Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse, Oldenbourg 2001, S. 16.
[10] Vgl. Reinhard, Wolfgang: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2002, S. 21.
[11] Vgl. Benz, Arthur: Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse, Oldenbourg 2001, S. 18.
[12] Ebd. S. 18.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Drei-Elementen-Lehre“ von Georg Jellinek?
Nach Jellinek definiert sich ein Staat durch die drei Elemente: Staatsvolk, Staatsgebiet und souveräne Staatsgewalt.
Wie unterschied sich das feudale System vom modernen Staat?
Im Feudalismus fehlte eine zentrale Führung. Herrschaft war kleinräumig, informell und basierte auf persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen zwischen König und Vasallen ohne klare Hierarchie.
Was kennzeichnete den Ständestaat?
Im Ständestaat wurden persönliche Bindungen durch unpersönliche Körperschaften ersetzt. Es entwickelten sich erste Ämtersysteme, wodurch Herrschaft institutionalisiert wurde.
Warum kam es im Absolutismus zur Zentralisierung der Macht?
Kriege (wie der Dreißigjährige Krieg) machten eine starke Zentralgewalt nötig, um Sicherheit und Frieden zu garantieren. Monarchen nutzten den Einflussverlust der Kirche, um ihre eigene Macht zu festigen.
Was bedeutet das „Gewaltmonopol“ des Monarchen?
Es bedeutet, dass allein der Herrscher das Recht zur legitimen physischen Gewaltanwendung hat und alle Staatsgewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) in seiner Person vereint.
Welche Rolle spielte der Merkantilismus für den Staat?
Der Merkantilismus war ein Wirtschaftssystem, das den Staatshaushalt konsolidieren sollte. Der Staat griff regulierend in die Wirtschaft ein, um Macht und Reichtum zu mehren.
- Citation du texte
- Alexander Christian Pape (Auteur), 2009, Entstehung einheitlicher Staatsgewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137417