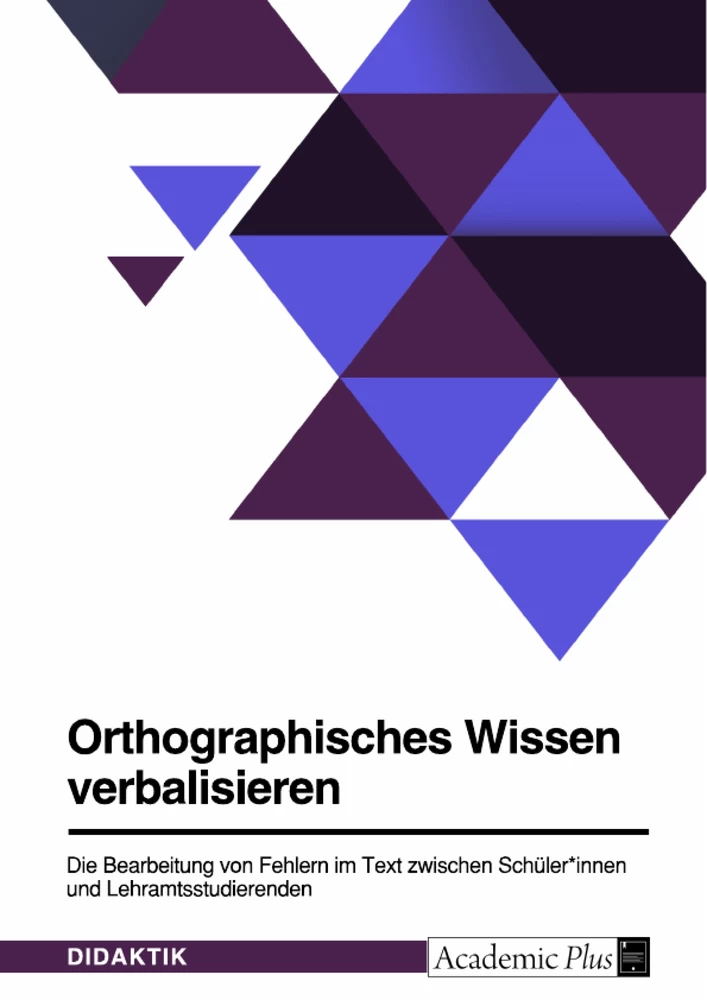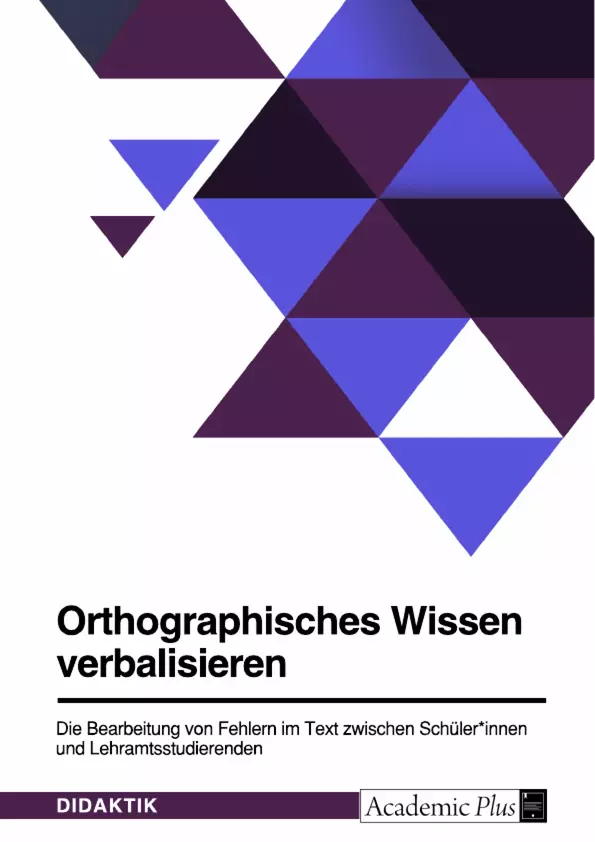Diese Arbeit thematisiert das Verbalisieren (können) orthographischen Wissens. Es handelt sich hierbei um eine empirische Arbeit, bei der mit mehreren Proband*innen Rechtschreibinterviews geführt und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Es wird die Frage untersucht, inwiefern die Bereiche des orthographischen Wissens (problemlösend, metakognitiv, deklarativ, prozedural) sich hierbei unterscheiden. Klassische Rechtschreibphänomene wie die Doppelkonsonantenbuchstabenschreibung, das Dehnungs-h, die Auslautverhärtung kamen dabei zur Anwendung.
Die Gestaltung des Orthographieunterrichts ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. In der Deutschdidaktik wird die Methode Rechtschreibgespräche als erfolgversprechend gehandelt, um die orthographische Kompetenz von Schüler*innen zu fördern, da u.a. das Verbalisieren eigener Wissensbestände zum nachhaltigen Abspeichern dieser führe. Dabei kann das Versprachlichen orthographischen Wissens jedoch nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden.
Rechtschreibgespräche müssen in der Praxis sorgfältig vorbereitet und schrittweise in der Klasse etabliert werden. Dementsprechend muss eine Lehrkraft Rechtschreibstrategien und -regeln kennen, anwenden und vermitteln können und – im Sinne des Vormachens – die Kompetenz besitzen, über orthographische Probleme sprechen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Orthographie als System
- 2.1 Phonematisches Prinzip
- 2.2 Syllabisches Prinzip
- 2.3 Morphematisches Prinzip
- 3. Orthographische Phänomene und Strategien
- 3.1 Dehnungs-h
- 3.2 Auslautverhärtung
- 3.3 Konsonantengemination
- 3.4 Stammschreibung
- 3.5 Strategien
- 4. Wissen und Können im Bereich der Orthographie
- 4.1 Deklaratives Wissen
- 4.2 Prozedurales Wissen
- 4.3 Problemlösungswissen
- 4.4 Metakognitives Wissen
- 4.5 Zwischenresümee
- 5. Wissen verbalisieren (können) – explizites vs. implizites Wissen
- 6. Orthographisches Wissen und Können von (angehenden) Deutschlehrkräften und Sechstklässler*innen
- 6.1 Was müssen (angehende) Deutschlehrkräfte können und wissen?
- 6.2 Was müssen Schüler*innen der sechsten Klasse können und wissen?
- 7. Forschungsdesign
- 7.1 Fragestellung und Ziele
- 7.2 Stichprobenbeschreibung
- 7.3 Datenerhebung
- 7.3.1 Methodisches Vorgehen
- 7.3.2 Ablauf
- 7.4 Analyse des Erhebungsmaterials
- 7.5 Methodisches Vorgehen bei der Datenauswertung
- 8. Ergebnisse
- 8.1 Entwicklung des Kategoriensystems
- 8.2 Darstellung des Kategoriensystems
- 8.3 Ergebnisdarstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Verbalisieren orthographischen Wissens bei Lehramtsstudierenden des Faches Deutsch und Schüler*innen der sechsten Klasse. Ziel ist ein qualitativer Vergleich, der das Verhältnis zwischen implizitem und explizitem orthographischen Wissen im Kontext von Rechtschreibgesprächen beleuchtet. Die Studie analysiert, wie gut die Teilnehmer*innen orthographische Probleme verbalisieren können.
- Verbalisierung orthographischen Wissens
- Vergleich expliziten und impliziten Wissens
- Analyse von Rechtschreibstrategien
- Unterschiede zwischen angehenden Lehrkräften und Schüler*innen
- Bedeutung von Rechtschreibgesprächen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Orthographie für beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg und den damit verbundenen Auftrag des Orthographieunterrichts. Sie hebt die multifaktorielle Beeinflussung des Rechtschreiberwerbs hervor, wobei die Lehrkraft eine zentrale Rolle spielt. Die Arbeit konzentriert sich auf Rechtschreibgespräche als Methode zur Förderung orthographischer Kompetenz und die damit verbundene Notwendigkeit, orthographisches Wissen verbalisieren zu können. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Verbalisierungsvermögens von Lehramtsstudierenden und Sechstklässler*innen, um das Verhältnis von implizitem und explizitem Wissen zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Orthographie, Rechtschreibgespräche, explizites Wissen, implizites Wissen, Verbalisierung, Deutschunterricht, Lehramtsstudierende, Sechstklässler*innen, qualitative Forschung, Rechtschreibstrategien, Wissensvermittlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Verbalisierung orthographischen Wissens
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie untersucht die Fähigkeit von Lehramtsstudierenden des Faches Deutsch und Schüler*innen der sechsten Klasse, orthographisches Wissen zu verbalisieren. Im Fokus steht der qualitative Vergleich zwischen implizitem und explizitem orthographischem Wissen im Kontext von Rechtschreibgesprächen.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Die Studie möchte den Unterschied im Verbalisieren orthographischer Probleme zwischen angehenden Lehrkräften und Sechstklässler*innen herausarbeiten und das Verhältnis von implizitem und explizitem Wissen in diesem Kontext beleuchten. Es geht darum, zu analysieren, wie gut die Teilnehmer*innen orthographische Probleme beschreiben und erklären können.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Verbalisierung orthographischen Wissens, der Vergleich zwischen explizitem und implizitem Wissen, die Analyse von Rechtschreibstrategien, die Unterschiede zwischen den beiden Teilnehmergruppen (Lehramtsstudierende und Sechstklässler*innen) und die Bedeutung von Rechtschreibgesprächen für die Förderung orthographischer Kompetenz.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel, beginnend mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Orthographie und den Fokus der Studie auf Rechtschreibgespräche darlegt. Es folgt ein Abschnitt zur Theorie der Orthographie, dann zur Beschreibung des Forschungsdesigns (Fragestellung, Stichprobe, Datenerhebung und -auswertung). Die Ergebnisse werden präsentiert und analysiert. Schlüsselwörter definieren den Themenbereich.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Genaueres zum methodischen Vorgehen, inklusive der Datenerhebung und der Analyse des Erhebungsmaterials, ist im Kapitel "Forschungsdesign" detailliert beschrieben.
Welche Teilnehmergruppen wurden untersucht?
Die Studie untersucht Lehramtsstudierende des Faches Deutsch und Schüler*innen der sechsten Klasse. Der Vergleich dieser beiden Gruppen soll Aufschluss über den Unterschied im orthographischen Wissen und dessen Verbalisierung geben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Studie werden in einem eigenen Kapitel dargestellt. Es wird unter anderem ein Kategoriensystem zur Analyse der Daten vorgestellt und die Ergebnisse anhand dieses Systems interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen können aus der Studie gezogen werden?
Die Schlussfolgerungen der Studie werden im letzten Teil der Arbeit präsentiert und diskutiert. Sie beziehen sich auf das Verhältnis von implizitem und explizitem Wissen, die Bedeutung der Verbalisierung orthographischen Wissens und die Implikationen für den Deutschunterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Orthographie, Rechtschreibgespräche, explizites Wissen, implizites Wissen, Verbalisierung, Deutschunterricht, Lehramtsstudierende, Sechstklässler*innen, qualitative Forschung, Rechtschreibstrategien, Wissensvermittlung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Orthographisches Wissen verbalisieren. Die Bearbeitung von Fehlern im Text zwischen Schüler*innen und Lehramtsstudierenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1377079