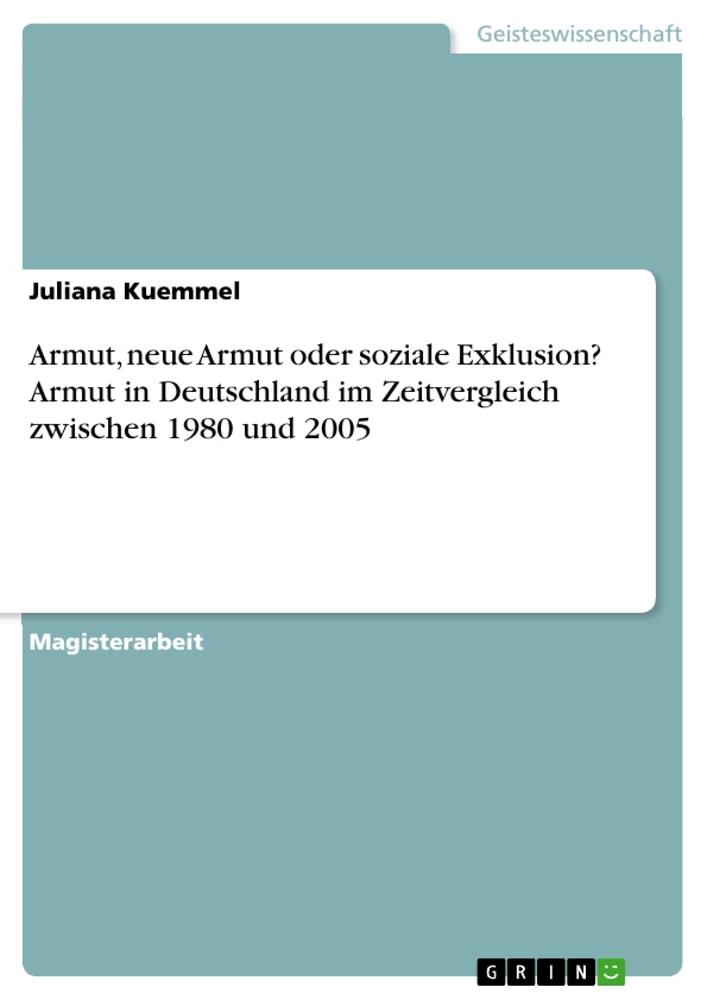Seit den 90er Jahren ist der Anteil der Armen an der Bevölkerung in Deutschland um knapp 50 Prozent gestiegen. Der dritte Armutsbericht der Bundesregierung zeigt ähnlich alarmierende Tendenzen: Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat sich die Armutsquote in den Jahren 2000 bis 2006 von 11,8% auf 18,3 % erhöht. Ein knappes Viertel der Bevölkerung müsste als arm gelten, würden alle staatlichen Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld und ähnliches wegfallen. Eine Studie zur Einkommensentwicklung in den Industrieländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), kam zu dem Ergebnis, dass in keinem anderen Industrieland die Zunahme von Armut und ungleicher Verteilung von Einkommen in den Jahren 2000 bis 2005 so stark war wie in der BRD.
Eine drastische, aber keineswegs neue Entwicklung, die seit den 80er Jahren mit der Einführung des Begriffs „neue Armut“ sowohl in den Fokus der Sozialwissenschaften, wie auch der öffentlichen Debatte gerückt ist. Probleme, wie massenhafte, strukturelle Erwerbslosigkeit und Armut, die zu Zeiten der Industrialisierung bereits überwunden geglaubt schienen, tauchen wieder auf, verstärken und verfestigen sich sogar. Seit Mitte der 90er Jahre haben die unterschiedlichsten Probleme, die sich als Konsequenzen dieser Entwicklung ergeben, den Obertitel „soziale Exklusion“ (soziale Ausgrenzung) zugeschrieben bekommen.
Zunehmende Verunsicherung, bis hin zur Perspektivlosigkeit, seien nicht nur in den untersten Schichten, sondern auch insbesondere in den Mittelschichten festzustellen.
Die französischen Sozialwissenschaftler Francois Dubet und Didier Lapeyronnie sehen mittlerweile gar keine soziale Frage mehr, sondern nur noch viele unterschiedliche soziale Probleme. Ausgrenzung habe Ausbeutung ersetzt; was bedeuten würde, dass das Problem der Ausbeutung durch Arbeit und damit einhergehende soziale Ungleichheit und prekäre Lebenslagen, nicht mehr so stark im Vordergrund stehen würden, wie die schon vollzogene oder drohende neue Spaltung in der Gesellschaft. Hat Ausgrenzung Ausbeutung als drängende soziale Frage ersetzt? Befindet sich die Gesellschaft der BRD in einem neuartigen Spaltungsprozess, jenseits „alter Ungleichheiten“ und herkömmlicher Armutsstrukturen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Eine gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Problemstellung
- 1.2 Begriffsbestimmungen und Literaturüberblick
- 2 Armut
- 2.1 Armutskonzepte
- 2.2 Armut im historischen Kontext
- 2.2.1 Historische Entwicklung der Ausgrenzungsproblematik: Robert Castel
- 2.2.2 Der Umgang mit Armut in Europa: Serge Paugam
- 2.2.3 Entwicklung von Armut und Wohlfahrtsstaat in Deutschland
- 3 Soziale Exklusion: Literaturüberblick
- 3.1 USA / angelsächsische Länder: Konzept der „urban underclass“
- 3.2 Entstehung des Exlusionsbegriffs in der französischen Soziologie
- 3.3 Der Exklusionsdiskurs in Deutschland: Literaturüberblick
- 3.3.1 Modi und Dimensionen der gesellschaftlichen Zugehörigkeit: Martin Kronauer
- 3.3.2 Exklusion in der Systemtheorie
- 3.3.3 Soziale Exklusion und andere Armuts- und Ungleichheitskonzepte: Petra Böhnke
- 3.4 Zusammenfassung des Forschungsstandes über soziale Exklusion
- 3.5 Aufbau der Untersuchung
- 4 Empirische Untersuchung von Armut in der BRD seit 1980
- 4.1 Arbeitslosigkeit und Armut
- 4.1.1 Armutsgefährdung und Erwerbsbeteiligung
- 4.1.2 Arbeitsmarktentwicklung
- 4.1.3 Dauer von Arbeitslosigkeit, Häufigkeit, und Langzeitarbeitslosigkeit
- 4.1.4 Struktur der Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf: Die am stärksten betroffenen Gruppen
- 4.1.5 Gründe für Anstieg und Verfestigung von Arbeitslosigkeit
- 4.1.6 Folgen von (Langzeit-) Arbeitslosigkeit
- 4.1.6.1 Persönliche Konsequenzen von Langzeitarbeitslosigkeit
- 4.1.6.2 Gesamtgesellschaftliche Auswirkungen von Arbeitslosigkeit
- 4.1.6.3 Verunsicherungen auch in der Mitte der Gesellschaft?
- 4.1.7 Soziale Rechte und Absicherung Arbeitsloser: Paradigmenwechsel des Sozialstaats
- 4.1.7.1 Die Transformation von einer Versicherungsleistung in eine Fürsorgeleistung
- 4.1.7.2 Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln und Doktrin der Beweislastumkehr
- 4.1.7.3 Kontrolle und Sanktionierung Arbeitsloser
- 4.2 Armut und Geschlecht: Rechtliche Angleichung ohne Beseitigung der Ungleichheiten
- 4.2.1 Arbeitsmarktsituation und Arbeitslosigkeit
- 4.2.2 Einkommensarmut von Frauen und Männern im Vergleich
- 4.2.3 Risikogruppe Alleinerziehende
- 4.2.4 Armutslagen und soziale Sicherung: Abbau der Familiensubsidarität vs. Re-Familiarisierung und Traditionalisierung
- 4.3 Die Variable Alter im Bezug auf das Armutsrisiko: Kinderarmut
- 4.3.1 Kinder- und Jugendarmut: „Infantilisierung“ von Armut
- 4.3.2 Dauer und Dynamik von Kinderarmut
- 4.3.3 Folgen von Kinderarmut
- 4.4 Jugendliche und Armut: Die Risikogruppe der Jugendlichen ohne Ausbildung
- 4.4.1 Veränderungen bei Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot
- 4.4.2 Veränderung der Zusammensetzung der Gruppe ausbildungsloser Jugendlicher
- 4.4.3 Platzierung Jugendlicher mit Migrationshintergrund im Bildungssystem
- 4.5 Altersarmut: „Eine einmalige historische Konstellation(...)“
- 4.5.1 Ältere Arbeitnehmer
- 4.5.2 Rentner
- 4.5.3 Ausblick in die Zukunft
- 4.6 Armut und Familie
- 4.6.1 Die Entwicklung von Armut und Familienstand im Zeitverlauf
- 4.6.2 Soziodemografische Zusammensetzung von Familien
- 4.6.3 Armutsdynamik unterschiedlicher Haushaltstypen
- 4.7 Armut und Migrationshintergrund
- 4.7.1 Historische Entwicklung der Migration in Deutschland
- 4.7.2 Struktur der Menschen mit Migrationshintergrund
- 4.7.3 Arbeitslosigkeit und Armut
- 4.7.4 Die Einkommenssituation von Migranten
- 4.7.5 Migrationshintergrund als Armutsfaktor, oder eine generelle Schichtproblematik?
- 5 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse
- 5.1 Ergebnisse: Arbeitslosigkeit und Armut
- 5.2 Ergebnisse: Armut und Geschlecht
- 5.3 Ergebnisse: Jugendliche und Ausbildungslosigkeit
- 5.4 Ergebnisse: Kinderarmut
- 5.5 Ergebnisse: Altersarmut
- 5.6 Ergebnisse: Familie und Armut
- 5.7 Ergebnisse: Migrationshintergrund und Armut
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Wandel von Armut in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1980 und 2006. Ziel ist es, die Entwicklung von Armut und sozialer Exklusion zu analysieren und die Zusammenhänge mit verschiedenen sozioökonomischen Faktoren zu beleuchten.
- Entwicklung von Armutskonzepten
- Der Einfluss von Arbeitslosigkeit auf Armut
- Armut im Kontext von Geschlecht, Alter und Familienstand
- Die Rolle von Migration bei Armut
- Vergleichende Analyse der Armutsentwicklung in Ost- und Westdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Magisterarbeit ein und skizziert die gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Relevanz der Untersuchung zum Wandel von Armut in Deutschland. Es werden Begriffsbestimmungen vorgenommen und ein Überblick über die relevante Literatur gegeben.
2 Armut: Der zweite Abschnitt befasst sich eingehend mit verschiedenen Armutskonzepten und deren historischen Entwicklung. Er analysiert die historische Entwicklung der Ausgrenzungsproblematik, unter Einbezug von theoretischen Ansätzen von Robert Castel und Serge Paugam. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung von Armut und Wohlfahrtsstaat in Deutschland gewidmet.
3 Soziale Exklusion: Literaturüberblick: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Forschungsstand zum Thema soziale Exklusion. Es werden unterschiedliche Perspektiven, insbesondere aus den USA, Frankreich und Deutschland, verglichen und diskutiert, wobei die Arbeiten von Martin Kronauer und Petra Böhnke im Fokus stehen. Der Aufbau der empirischen Untersuchung wird ebenfalls vorgestellt.
4 Empirische Untersuchung von Armut in der BRD seit 1980: Der Kern der Arbeit besteht in der empirischen Untersuchung von Armut in der BRD. Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Armut und Arbeitslosigkeit, Geschlecht, Alter, Familienstand und Migrationshintergrund, jeweils mit detaillierten Daten und Analysen über die Entwicklung in den untersuchten Zeiträumen. Der Einfluss des sich wandelnden Sozialstaats und dessen Auswirkungen werden ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Armut, Soziale Exklusion, Arbeitslosigkeit, Geschlecht, Alter, Familie, Migration, Deutschland, Wohlfahrtsstaat, Zeitvergleich (1980-2006), Empirische Untersuchung, Sozioökonomische Faktoren.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Wandel von Armut in der Bundesrepublik Deutschland (1980-2006)
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert den Wandel von Armut und sozialer Exklusion in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1980 und 2006. Sie untersucht die Zusammenhänge zwischen Armut und verschiedenen sozioökonomischen Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Geschlecht, Alter, Familienstand und Migrationshintergrund.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Armutskonzepten, den Einfluss von Arbeitslosigkeit auf Armut, Armut im Kontext von Geschlecht, Alter und Familienstand, die Rolle von Migration bei Armut und einen Vergleich der Armutsentwicklung in Ost- und Westdeutschland.
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Armutskonzepte und analysiert die historische Entwicklung der Ausgrenzungsproblematik unter Einbezug theoretischer Ansätze von Robert Castel und Serge Paugam. Im Kontext der sozialen Exklusion werden Perspektiven aus den USA, Frankreich und Deutschland verglichen, mit einem Fokus auf die Arbeiten von Martin Kronauer und Petra Böhnke.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Armutskonzepten und deren historischer Entwicklung, einen Literaturüberblick zur sozialen Exklusion, eine empirische Untersuchung von Armut in der BRD seit 1980 und abschließend eine Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse. Die empirische Untersuchung analysiert den Zusammenhang von Armut mit Arbeitslosigkeit, Geschlecht, Alter, Familienstand und Migrationshintergrund detailliert.
Welche Daten werden in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung analysiert den Zusammenhang von Armut mit verschiedenen Faktoren anhand von Daten zur Entwicklung in den Jahren 1980 bis 2006. Details zu den konkreten Datenquellen werden in der Arbeit selbst beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse fasst die Erkenntnisse zu den Zusammenhängen zwischen Armut und den untersuchten sozioökonomischen Faktoren zusammen. Konkrete Schlussfolgerungen und Interpretationen der Ergebnisse finden sich im letzten Kapitel der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Armut, Soziale Exklusion, Arbeitslosigkeit, Geschlecht, Alter, Familie, Migration, Deutschland, Wohlfahrtsstaat, Zeitvergleich (1980-2006), Empirische Untersuchung, Sozioökonomische Faktoren.
- Arbeit zitieren
- Juliana Kuemmel (Autor:in), 2009, Armut, neue Armut oder soziale Exklusion? Armut in Deutschland im Zeitvergleich zwischen 1980 und 2005, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137822